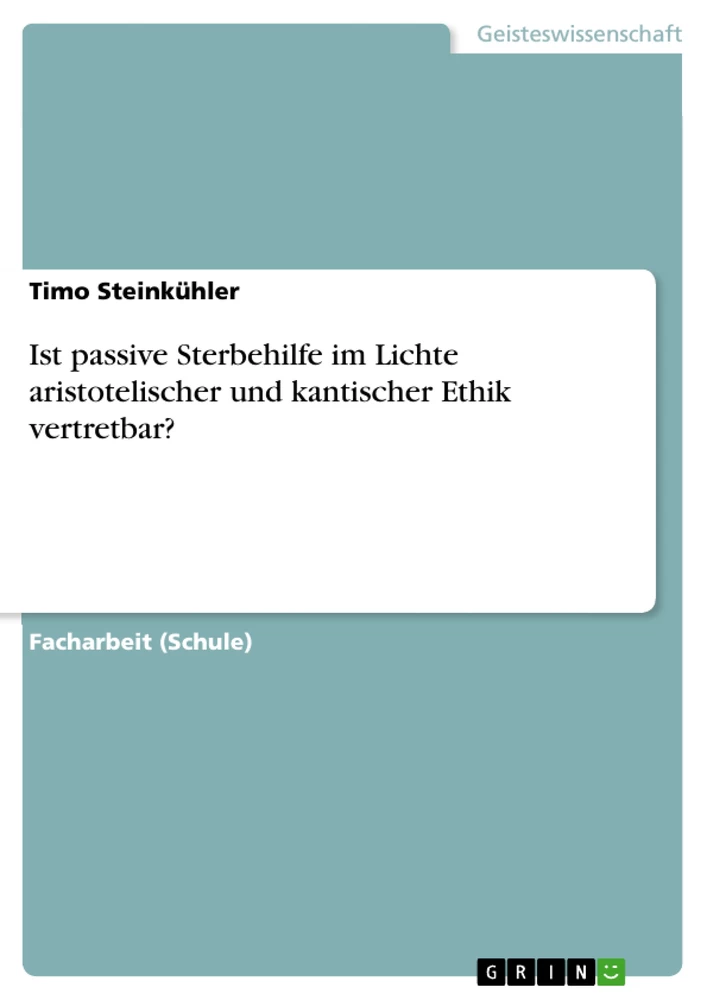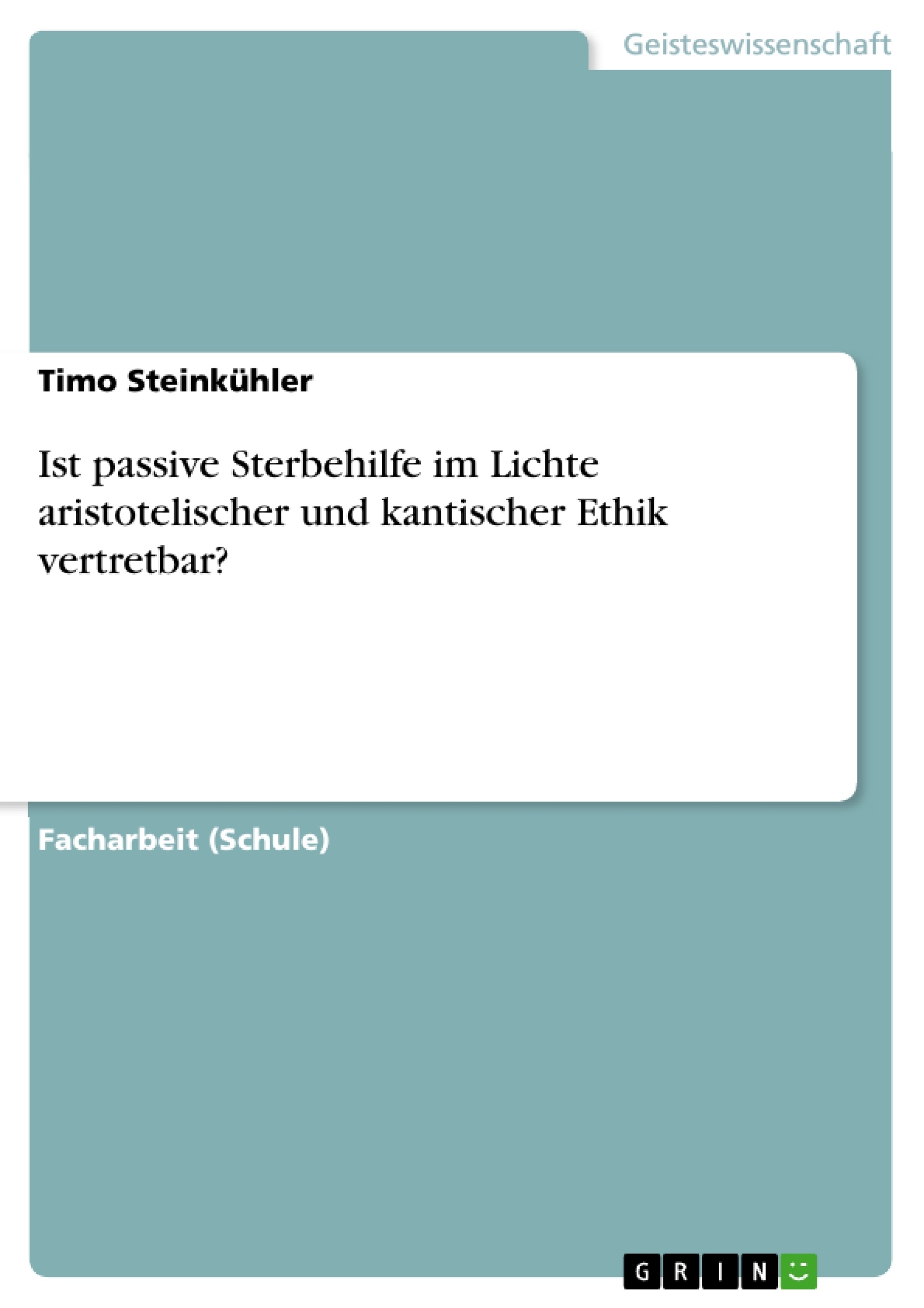Ist Sterbehilfe vertretbar? Dies ist eine der bekanntesten ethischen Fragen überhaupt. Sie wird schon seit langer Zeit diskutiert und Sterbehilfe ist in Deutschland verboten.
Trotzdem wird diese Frage immer wieder gestellt und irgendwie hat sich jeder über sie schon einmal seine Gedanken gemacht oder darüber sogar mit anderen Leuten diskutiert. Sterbehilfe ist ein Thema, das man auf ganz unterschiedliche Weisen angehen kann und daher auch zu keiner eindeutigen Meinung kommt, die von allen akzeptiert wird.
An dieser Stelle wäre es interessant zu erfahren, was große Philosophen zu dieser Frage sagen würden. Ich habe mir Immanuel Kant und Aristoteles ausgesucht, da diese beiden zwei der wichtigsten Ethiken aufgestellt haben, nach denen sich auch heute noch viele Menschen richten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeine Einleitung
- 1.2 Definition von Sterbehilfe
- 1.2.1 Aktive Sterbehilfe
- 1.2.2 Indirekte Sterbehilfe
- 1.2.3 Passive Sterbehilfe
- 2 Aristoteles: Der Begriff der „Eudämonie“
- 3 Kant und Sterbehilfe
- 3.1 Der kategorische Imperativ
- 3.2 Andere Ansatzmöglichkeiten bei Kant
- 4 Schluss
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Eigene Meinung
- 4.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Vertretbarkeit passiver Sterbehilfe unter ethischen Gesichtspunkten, indem sie die Ansätze von Aristoteles und Kant heranzieht. Ziel ist es, durch die Analyse der jeweiligen ethischen Systeme neue Perspektiven auf die Debatte um passive Sterbehilfe zu eröffnen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe
- Aristoteles' Konzept der Eudämonie und seine Relevanz für die Frage der Sterbehilfe
- Kants kategorischer Imperativ und seine Anwendung auf die Thematik
- Ethische Bewertung passiver Sterbehilfe im Kontext der untersuchten ethischen Systeme
- Analyse der Problematik passiver Sterbehilfe im Spannungsfeld zwischen medizinischen Möglichkeiten und ethischen Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Allgemeine Einleitung: Die Einleitung führt in die ethische Problematik der Sterbehilfe ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vertretbarkeit passiver Sterbehilfe. Sie begründet die Wahl von Aristoteles und Kant als zentrale Bezugspunkte und erläutert die Herausforderungen, die sich aus der zeitlichen Distanz zu diesen Denkern ergeben. Der Fokus wird auf passive Sterbehilfe gelegt, da diese im Vergleich zur aktiven Sterbehilfe ethisch weniger eindeutig bewertet wird und dennoch religiös und gesellschaftlich kontrovers diskutiert wird.
1.2 Definition von Sterbehilfe: Dieses Kapitel differenziert zwischen aktiven, indirekten und passiven Formen der Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe wird als absichtliche Tötung auf Verlangen beschrieben und als strafbar in Deutschland gekennzeichnet. Indirekte Sterbehilfe beschreibt eine Behandlung, bei der der Tod eine ungewollte Nebenwirkung ist. Passive Sterbehilfe wird als Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen definiert. Die Komplexität dieser Unterscheidung wird herausgestellt, besonders im Hinblick auf die Frage, ob der Abbruch einer Behandlung immer zum Tod führt.
2 Aristoteles: Der Begriff der „Eudämonie“: Dieses Kapitel erläutert Aristoteles' Konzept der Eudämonie (Glückseligkeit) als höchstes Ziel menschlichen Handelns. Es wird dargelegt, dass Eudämonie ein umfassendes und letztlich unerreichbares Ziel ist, das die Erfüllung aller anderen Ziele einschließt, inklusive eines glücklichen Lebens und Todes. Die Analyse des Begriffs der Eudämonie legt die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der Frage, wie Aristoteles' Ethik auf die passive Sterbehilfe angewendet werden kann.
Schlüsselwörter
Passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Aristoteles, Eudämonie, Kant, kategorischer Imperativ, Ethik, Moral, Lebensverlängerung, medizinische Behandlung, ethische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Ethische Bewertung passiver Sterbehilfe
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Diese Facharbeit untersucht die ethische Vertretbarkeit von passiver Sterbehilfe. Sie analysiert die Ansätze von Aristoteles und Kant, um neue Perspektiven auf diese Debatte zu eröffnen.
Welche Arten von Sterbehilfe werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen aktiver, indirekter und passiver Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist die absichtliche Tötung auf Verlangen, indirekte Sterbehilfe eine Behandlung mit ungewollter Todesfolge als Nebenwirkung, und passive Sterbehilfe die Unterlassung oder der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Die Komplexität dieser Unterscheidung, besonders beim Abbruch von Behandlungen, wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Aristoteles in der Analyse?
Die Arbeit untersucht Aristoteles' Konzept der Eudämonie (Glückseligkeit) als höchstes Ziel menschlichen Handelns. Es wird analysiert, wie dieses umfassende Ziel, welches ein glückliches Leben und Sterben einschließt, auf die Frage der passiven Sterbehilfe angewendet werden kann.
Welche Rolle spielt Kant in der Analyse?
Die Arbeit befasst sich mit Kants kategorischem Imperativ und dessen Anwendung auf die Thematik der passiven Sterbehilfe. Es wird untersucht, wie dieser ethische Ansatz die Problematik beleuchtet.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe, Aristoteles' Konzept der Eudämonie und dessen Relevanz, Kants kategorischer Imperativ und seine Anwendung, die ethische Bewertung passiver Sterbehilfe im Kontext der untersuchten ethischen Systeme und die Analyse der Problematik im Spannungsfeld zwischen medizinischen Möglichkeiten und ethischen Prinzipien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine allgemeine Einleitung mit der zentralen Forschungsfrage, ein Kapitel zur Definition von Sterbehilfe, ein Kapitel zu Aristoteles und seinem Konzept der Eudämonie, ein Kapitel zu Kant und seinem kategorischen Imperativ, und abschließend eine Zusammenfassung mit eigener Meinung und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Aristoteles, Eudämonie, Kant, kategorischer Imperativ, Ethik, Moral, Lebensverlängerung, medizinische Behandlung, ethische Bewertung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, durch die Analyse der ethischen Systeme von Aristoteles und Kant neue Perspektiven auf die Debatte um passive Sterbehilfe zu eröffnen.
- Quote paper
- Timo Steinkühler (Author), 2012, Ist passive Sterbehilfe im Lichte aristotelischer und kantischer Ethik vertretbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194992