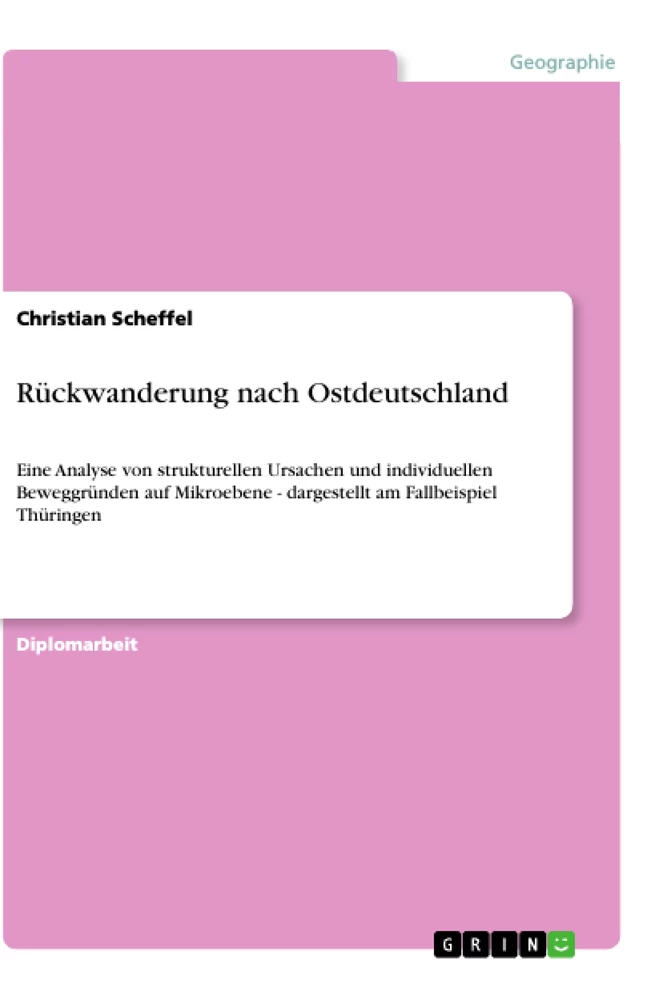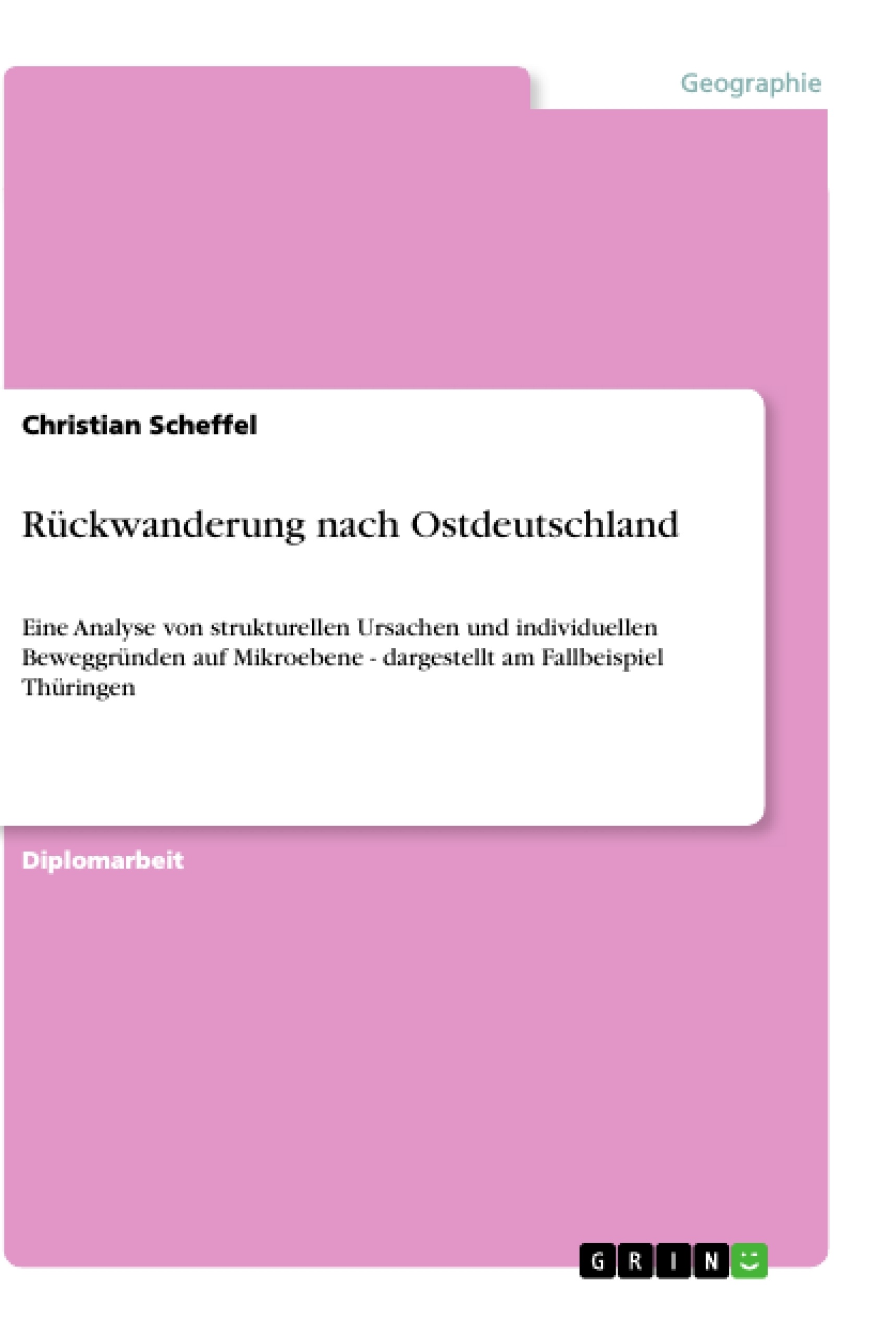Die Rückwanderung von ehemals aus Ostdeutschland abgewanderten Personen findet als Thema in der Wissenschaft, der Politik und den Medien zunehmend Beachtung. Aus bereits vorliegenden renommierten Untersuchungen geht hervor, dass rund ein Fünftel aller ursprünglichen Abwanderer in die Neuen Bundesländer zurückgekehrt sind.
Bisher bestehen jedoch nur wenige Kenntnisse über die strukturellen Ursachen und individuellen Beweggründe, die eine Rückkehr der Akteure nach Ostdeutschland beeinflussen. Mit den immensen Subventionen in den Neuen Bundesländern seit der Deutschen Wiedervereinigung haben sich die (arbeitsmarkt-)strukturellen Bedingungen wesentlich verbessert. In diesem Zusammenhang soll geklärt werden, ob sich die Strukturbedingungen derart verändert haben, dass sie eine Rückwanderung von ehemals aus Ostdeutschland fortgezogenen Personen verursachen. Andererseits können auch individuelle Beweggründe, die aus der Unzufriedenheit der Akteure mit ihrer Lebenssituation in Westdeutschland resultieren, eine Rückkehr motivieren. Die Klärung der Frage, ob es strukturelle Ursachen und/oder individuelle Beweggründe sind, die die Rückwanderung der Akteure bedingen, ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit.
In der umfassenden Erklärung des Rückwanderungsphänomens werden biographische Veränderungen im Lebensverlauf der Akteure berücksichtigt und zugleich die Bedeutung des individuell verfügbaren Sozialkapitals sowie der regionalen Verbundenheit im Rückwanderungsprozess untersucht.
Die Ermittlung der strukturellen Ursachen und individuellen Beweggründe, die die Rückwanderung der Akteure nach Ostdeutschland beeinflussen, erfolgt auf Mikro-Ebene, d.h. durch Befragung der Rückkehrer. In die empirischen Untersuchungen konnten zugleich Personen einbezogen werden, die eine Rückkehr nach Ostdeutschland beabsichtigten, aber seit ihrer Abwanderung in den Alten Bundesländern verblieben sind. Aus dem Vergleich beider Befragungsgruppen erfolgt eine Analyse der einzelnen Determinanten, die zum Vollzug bzw. zur Unterlassung einer Rückwanderung führen.
Für die Primärdatenerhebung wurde exemplarisch das Bundesland Thüringen ausgewählt.
Inhaltsverzeichnis
- A Ausgangsbasis und Vorgehensweise der Untersuchung
- 1 Einleitende Vorbemerkung
- 2 Aufbau der Arbeit
- 3 Zielsetzungen und forschungsleitende Fragestellungen
- 4 Geographischer Bezug zur Thematik
- B Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen
- 5 Definitionen und Typisierungen von Wanderungen
- 5.1 Definition und Abgrenzung des Begriffes Wanderung
- 5.2 Definition und Abgrenzung des Begriffes Rückwanderung
- 5.3 Typisierungsversuche von Wanderungen
- 5.4 Typisierungsversuche von Rückwanderungen
- 5.4.1 Rückwanderungstypologien differenziert nach räumlichen Strukturbedingungen und Wanderungsverlauf
- 5.4.2 Rückwanderungstypologien differenziert nach Intentionen und Rückkehrmotiven
- 6 Theoretische Erklärungsansätze von Wanderungen und deren Aussagekraft zur Erklärung des Rückwanderungsprozesses
- 6.1 Klassische Erklärungsansätze in der Wanderungsforschung
- 6.1.1 Die Migrationsgesetze nach RAVENSTEIN
- 6.1.2 Die Theorie der Wanderung von LEE
- 6.1.3 Die neoklassische makroökonomische Theorie
- 6.1.4 Die Segmentationstheorie nach PIORE
- 6.1.5 Die systemtheoretischen Ansätze
- 6.1.6 Die neoklassische mikroökonomische Theorie
- 6.1.7 Die Neue Migrationsökonomie
- 6.1.8 Verhaltensorientierte Ansätze
- 6.1.9 Handlungstheoretische Ansätze
- 6.1.10 Zwischenfazit und Evaluierung der klassischen Wanderungstheorien hinsichtlich ihrer Anwendung und Erklärung der Rückwanderung
- 6.2 Neuere Erklärungsansätze in der Wanderungsforschung
- 6.2.1 Der Migrationssystem-Ansatz
- 6.2.2 Die Theorie der transnationalen Migration
- 6.2.3 Die Netzwerktheorie
- 6.2.4 Die Theorie der kumulativen Verursachung
- 6.3 Zusammenfassung
- 7 Der Rückwanderungsprozess – eine sozialgeographisch-handlungstheoretische Interpretation
- 7.1 Der Begriff Handlung
- 7.2 Die Rückwanderung als Handlungsprozess
- 7.3 Die Handlungsziele eines Akteurs im Rückwanderungsprozess
- 7.4 Der Zusammenhang zwischen räumlicher und sozialer Mobilität im Rückwanderungsprozess
- 7.5 Die Dauer des Rückwanderungsprozesses
- 8 Determinanten im Rückwanderungsprozess
- 8.1 Strukturelle Ursachenfaktoren der Rückwanderung
- 8.2 Individuelle Beweggründe der Rückwanderung
- 8.3 Soziale Netzwerke und Sozialkapital
- 8.3.1 Sozialkapital – eine Begriffsbestimmung
- 8.3.2 Soziale Netzwerke und Sozialkapital – eine handlungstheoretische Konzeption
- 8.3.3 Die Bedeutung von Vertrauen innerhalb sozialer Netzwerke
- 8.3.4 Annahmen über den Einfluss sozialer Netzwerke und des Sozialkapitals im Rückwanderungsprozess der Akteure nach Ostdeutschland
- 8.4 Rückwanderungen im Kontext biographischer Ereignisse im Lebensverlauf
- 8.5 Rückwanderung im Haushaltskontext
- 9 Die regionale Verbundenheit
- 9.1 Heimat
- 9.1.1 Die Entwicklung des Begriffes Heimat
- 9.1.2 Die inhaltlichen Dimensionen des Heimat-Begriffes
- 9.1.3 Die Zukunft der individuellen Heimatverbundenheit
- 9.2 Regionale Identität und Regionalbewusstsein
- 9.2.1 Begriffsabgrenzung von regionaler Identität und Regionalbewusstsein
- 9.2.2 Raumrelevante Aspekte von regionaler Identität und Regionalbewusstsein
- 9.2.3 Die planungspolitische Bedeutung des Konzeptes der regionalen Identität und des Regionalbewusstseins
- 9.3 Zusammenfassung
- 10 Die regionalpolitische Bedeutung der Rückwanderung nach Ostdeutschland
- 10.1 Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die regionale Wirtschafts- und Sozialstruktur
- 10.2 Humankapitalverlust und Fachkräftemangel in Ostdeutschland
- 10.3 Die Wanderungen von Hochqualifizierten
- 10.3.1 Definition des Begriffskomplexes brain drain, brain gain und brain circulation
- 10.3.2 Mögliche positive Effekte der Rückwanderungen von Hochqualifizierten in den Herkunftsländern
- 10.4 Exkurs: Rückwanderungsinitiativen und -agenturen in Ostdeutschland
- 11 Binnenwanderungen in der Bundesrepublik Deutschland
- 11.1 Die deutsch-deutschen Wanderungen vor der Deutschen Wiedervereinigung (1950 bis 1990)
- 11.2 Die Binnenwanderungen zwischen Ost- und Westdeutschland von 1991 bis 2008
- 11.2.1 Das Wanderungsvolumen im Zeitverlauf
- 11.2.2 Differenzierung des Wanderungsvolumens nach Alter und Geschlecht
- 11.2.3 Räumliche Wanderungsverflechtungen zwischen Ost- und Westdeutschland
- 11.3 Exkurs: Möglichkeiten und Grenzen der Wanderungsstatistik des Statistischen Bundesamtes Deutschland
- 11.4 Bestimmung des Volumens der Rückwanderung nach Ostdeutschland
- C Empirische Untersuchungen
- 12 Entwurf eines theoretischen Untersuchungsrahmens
- 13 Methodische Vorgehensweise
- 13.1 Untersuchungsdesign
- 13.2 Räumliche Analyseebene und Auswahl des Untersuchungsraumes
- 13.3 Bestimmung der Informationsquelle und Erhebungsmethodik
- 13.4 Verwendung der Befragungsergebnisse
- 14 Strukturanalyse des Untersuchungsraumes
- 14.1 Verwaltungsmäßige und naturräumliche Gliederung
- 14.2 Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur
- 14.2.1 Bevölkerungsstand und -entwicklung
- 14.2.2 Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur
- 14.2.3 Die Entwicklung der Wanderungsbewegungen mit den Alten Bundesländern
- 14.2.4 Die Siedlungsstruktur
- 14.3 Die Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur
- 14.3.1 Die Entwicklung der Beschäftigtenstruktur
- 14.3.2 Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit
- 14.3.3 Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit
- 14.3.4 Die Entwicklung des Lohnniveaus
- 14.4 Wohn- und Lebensbedingungen
- 14.4.1 Verkehrsinfrastruktur und Erreichbarkeit
- 14.4.2 (Kinder-)Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur
- 14.4.3 Wohnungsmarkt und Wohnungsversorgung
- 14.4.4 Lebenshaltungskosten
- 14.5 Zusammenfassung
- 15 Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- 15.1 Charakterisierung von Rückwanderern und potenziellen Rückwanderern nach soziodemographischen Merkmalen
- 15.1.1 Geschlecht der Auskunftspersonen
- 15.1.2 Alter der Auskunftspersonen
- 15.1.3 Haushaltsgröße der Auskunftspersonen
- 15.1.4 Familienstand der Auskunftspersonen
- 15.1.5 Bildungsabschluss der Auskunftspersonen
- 15.1.6 Berufliche Tätigkeit der Auskunftspersonen
- 15.2 Einflussfaktoren im Abwanderungsprozess der Auskunftspersonen aus Ostdeutschland
- 15.3 Dauer des Aufenthalts in Westdeutschland
- 15.4 Herkunfts- und Rückkehrort der Rückwanderer in Ostdeutschland
- 15.5 Rückkehr- und Arbeitsort der Rückwanderer
- 15.6 Strukturelle Ursachen und individuelle Beweggründe für die Rückwanderung nach Thüringen
- 15.6.1 Bewertung der Auskunftspersonen über die Veränderung der strukturellen Rahmenbedingungen in Thüringen
- 15.6.2 Rückwanderung nach Thüringen – strukturelle Ursachen und individuelle Beweggründe in Westdeutschland
- 15.6.3 Rückwanderung nach Thüringen – strukturelle Ursachen und individuelle Beweggründe in Thüringen
- 15.6.4 Multikausalität des Rückwanderungsprozesses
- 15.6.5 Die wichtigsten Gründe der Auskunftspersonen für die Rückkehr nach Thüringen bzw. für den Verbleib in den Alten Bundesländern
- 15.6.6 Biographische Ereignisse im Lebensverlauf der Auskunftspersonen
- 15.6.7 Dauer des Rückwanderungsprozesses
- 15.7 Die Bedeutung des Sozialkapitals im Rückwanderungsprozess
- 15.8 Die Bedeutung der Heimatverbundenheit im Rückwanderungsprozess nach Thüringen
- 15.9 Die Zufriedenheit der Auskunftspersonen nach der Rückwanderung
- 15.10 Bedingungen für einen dauerhaften Verbleib der Rückwanderer in Thüringen
- D Schlussbetrachtung
- 16 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen
- 17 Fazit
- Analyse der strukturellen Ursachen der Rückwanderung (Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Lebenshaltungskosten).
- Identifizierung individueller Beweggründe für die Rückkehr (familiäre Bindungen, Heimweh, berufliche Entwicklung).
- Untersuchung des Einflusses von Sozialkapital und sozialen Netzwerken auf die Rückwanderung.
- Bewertung der regionalen Verbundenheit und ihrer Bedeutung für die Rückkehrentscheidung.
- Analyse der regionalpolitischen Implikationen der Rückwanderung für Ostdeutschland.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die strukturellen Ursachen und individuellen Beweggründe für Rückwanderungen aus West- nach Ostdeutschland, speziell nach Thüringen. Es wird untersucht, inwieweit sich die strukturellen Rahmenbedingungen in beiden Regionen auf die Rückkehrentscheidungen auswirken und welche Rolle individuelle Motive spielen.
Zusammenfassung der Kapitel
A Ausgangsbasis und Vorgehensweise der Untersuchung: Dieser Abschnitt liefert eine Einleitung zur Thematik der Rückwanderung nach Ostdeutschland, beleuchtet den historischen Kontext nach der Wiedervereinigung und die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Er skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
B Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die bestehenden Theorien zur Migration und Rückwanderung. Es werden sowohl klassische Ansätze (z.B. die neoklassische Theorie, die Netzwerktheorie) als auch neuere Entwicklungen (z.B. der Migrationssystem-Ansatz, der Transnationalismus) diskutiert und kritisch bewertet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Handlungstheorie als Grundlage der Analyse, die sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren berücksichtigt. Die verschiedenen Typologien von Wanderungs- und Rückwanderungsprozessen werden kritisch bewertet und ihre Aussagekraft zur Erklärung der Rückwanderung diskutiert.
C Empirische Untersuchungen: Dieser Abschnitt beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung, inklusive des Untersuchungsdesigns, der Auswahl des Untersuchungsraumes (Thüringen) und der Erhebungsmethodik (Fragebögen). Die Ergebnisse der Befragung von Rückwanderern und potenziellen Rückwanderern werden in Bezug auf soziodemografische Merkmale, Abwanderungsmotive, Rückkehrmotive, die Dauer des Aufenthalts in Westdeutschland und die Bedeutung des Sozialkapitals analysiert.
Schlüsselwörter
Rückwanderung, Ostdeutschland, Thüringen, Binnenwanderung, Arbeitsmarkt, Humankapital, Sozialkapital, soziale Netzwerke, Heimat, regionale Identität, Regionalbewusstsein, Handlungstheorie, lebenszyklische Ereignisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rückwanderung nach Ostdeutschland - Fokus Thüringen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die strukturellen Ursachen und individuellen Beweggründe für Rückwanderungen aus West- nach Ostdeutschland, mit speziellem Fokus auf Thüringen. Sie untersucht den Einfluss struktureller Rahmenbedingungen beider Regionen auf Rückkehrentscheidungen und die Rolle individueller Motive.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse struktureller Ursachen der Rückwanderung (Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Lebenshaltungskosten), Identifizierung individueller Beweggründe (familiäre Bindungen, Heimweh, berufliche Entwicklung), Untersuchung des Einflusses von Sozialkapital und sozialen Netzwerken, Bewertung der regionalen Verbundenheit und ihrer Bedeutung für die Rückkehrentscheidung, sowie die Analyse regionalpolitischer Implikationen für Ostdeutschland.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf einen umfassenden Überblick bestehender Theorien zur Migration und Rückwanderung. Sowohl klassische Ansätze (neoklassische Theorie, Netzwerktheorie) als auch neuere Entwicklungen (Migrationssystem-Ansatz, Transnationalismus) werden diskutiert und kritisch bewertet. Die Handlungstheorie bildet die Grundlage der Analyse, indem sie sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren berücksichtigt. Verschiedene Typologien von Wanderungs- und Rückwanderungsprozessen werden kritisch beleuchtet.
Welche Methodik wird angewendet?
Die empirische Untersuchung verwendet ein quantitatives Design. Der Untersuchungsraum ist Thüringen. Die Datenerhebung erfolgt mittels Fragebögen. Die Ergebnisse werden in Bezug auf soziodemografische Merkmale, Abwanderungsmotive, Rückkehrmotive, die Dauer des Aufenthalts in Westdeutschland und die Bedeutung des Sozialkapitals analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Befragung charakterisieren Rückwanderer und potenzielle Rückwanderer nach soziodemografischen Merkmalen. Sie analysieren Einflussfaktoren im Abwanderungsprozess, die Dauer des Aufenthalts in Westdeutschland, Herkunfts- und Rückkehrorte, strukturelle Ursachen und individuelle Beweggründe für die Rückwanderung nach Thüringen, die Bedeutung von Sozialkapital und Heimatverbundenheit, sowie die Zufriedenheit der Rückwanderer und Bedingungen für einen dauerhaften Verbleib.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit beantwortet die Forschungsfragen, indem sie die Ergebnisse der empirischen Untersuchung mit den theoretischen Grundlagen verbindet und ein umfassendes Bild der Rückwanderung nach Thüringen zeichnet. Es wird ein Fazit gezogen, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und mögliche Implikationen für die Regionalpolitik diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Rückwanderung, Ostdeutschland, Thüringen, Binnenwanderung, Arbeitsmarkt, Humankapital, Sozialkapital, soziale Netzwerke, Heimat, regionale Identität, Regionalbewusstsein, Handlungstheorie, lebenszyklische Ereignisse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: A. Ausgangsbasis und Vorgehensweise, B. Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen und C. Empirische Untersuchungen. Jeder Teil umfasst mehrere Kapitel, die im Detail im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind (siehe oben im Dokument).
- Citar trabajo
- Christian Scheffel (Autor), 2012, Rückwanderung nach Ostdeutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194972