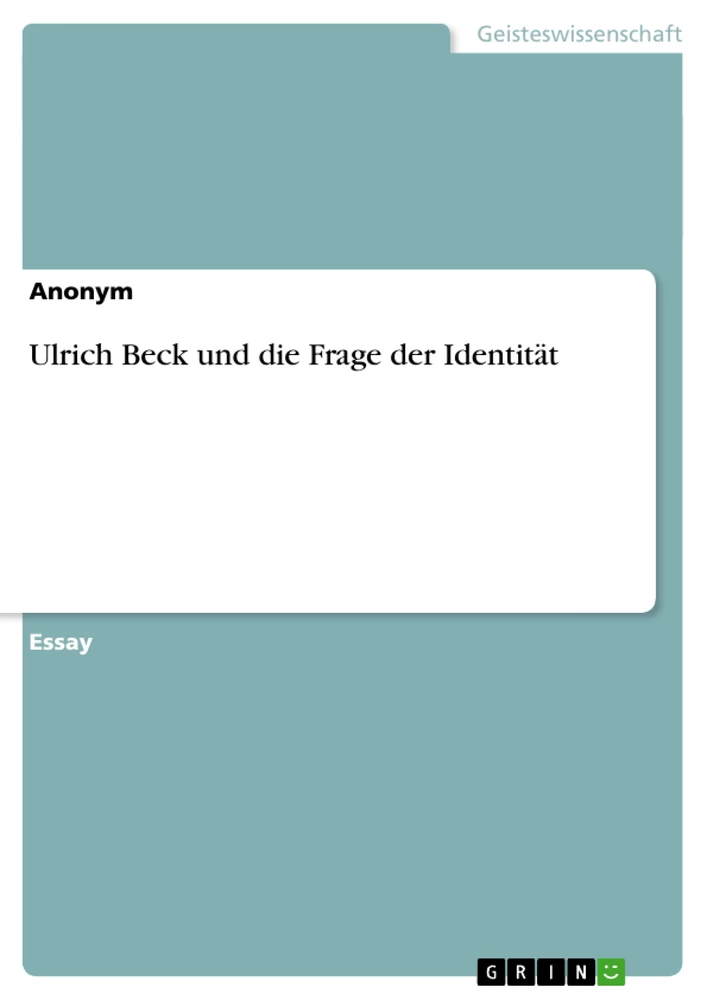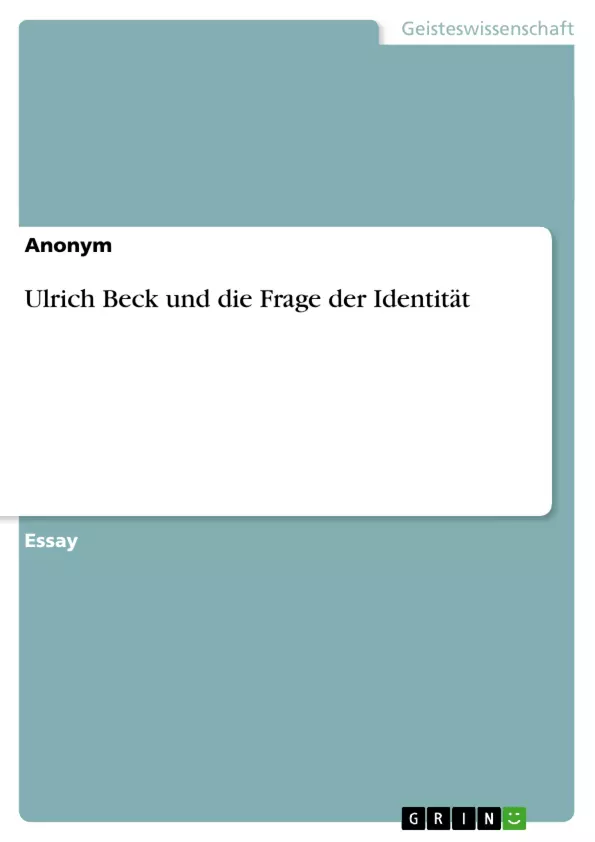Ulrich Beck ist einer der bekanntesten deutschen Soziologen unserer Zeit, dessen Werke zur Krisendynamik der gegenwärtigen Gesellschaftsentwicklung große Bedeutung erlangten.
Einleitung
Ulrich Beck ist einer der bekanntesten deutschen Soziologen unserer Zeit, dessen Werke zur Krisendynamik der gegenwärtigen Gesellschaftsentwicklung große Bedeutung erlangten.
Mit seiner Analyse der modernen Gesellschaft als eine „Risikogesellschaft“, die mit ihren selbst produzierten Risiken konfrontiert wird („reflexive Moderne“), warf er ein neues Licht auf die Identitätsdebatte und hat damit eine kontroverse Beurteilung der Identitätschancen junger Menschen ausgelöst [1]
In seinem Werk „ Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ ist die Gegenwart, „die aus den Fugen zu geraten scheint“ [2] beispielsweise gekennzeichnet durch selbst produzierte ökologische Katastrophen, individuelle Sinnkrisen und soziale Ungleichheiten. Die Grundthese der Theorie lautet, dass wir uns in einer Umbruchphase der Moderne befinden, die sich aus den Strukturen einer klassischen Industriegesellschaft herauslöst und eine neue Gestalt, die so genannte (industriegesellschaftliche) Risikogesellschaft, annimmt.
Neben der Theorie einer „reflexiven Moderne“,die in der Risikogesellschaft mündet, steht vor allem die „Individualisierungsthese“ im Mittelpunkt des Werkes. Sie besagt, „dass das traditionsbestimmte stahlharte Gehäuse der Hörigkeit, das die kapitalistisch geprägte Industriegesellschaft den Subjekten als Korsett aufzwingt, in einem Prozess hochgradiger gesellschaftlicher Wandlungsdynamik aufgelöst werden“. [3] Durch eine zunehmende Individualisierung sowie einen Kontinuitätsbruch mit traditionellen Bindungen und der einer Identitäten Verortung in Klasse und Schicht, wird der Einzelne freier in seiner Identitätsbildung und sieht sich mit einer steigenden Anzahl an Wahlmöglichkeiten konfrontiert.
Für Beck umfasst die Individualisierungsprozess drei Phasen, die ich im folgenden Erläutern werde. Gleichzeitig möchte ich jedoch anmerken, dass sich Ulrich Becks „Individualisierungsthese“ lediglich auf westliche Industriegesellschaften bezieht.
Die Drei Phasen der Individualisierung nach Beck
1. Freisetzunqsdimension
Im Zuge der Modernisierung konstatiert Ulrich Beck die Aufhebung der Strukturierung von Lebenslagen nach traditionellen Großgruppen, wie Ständen, Klassen und Schichten, aber auch eine Freisetzung aus den Geschlechtslagen von Männern und Frauen.
Ursächlich dafür sind u.a. die Ausdifferenzierung und Ausweitung des Arbeitsmarktes, eine steigende Mobilität der Menschen, die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, sowie die wachsende soziale Sicherheit im Wohlfahrtsstaat.
Die abnehmenden sozialen Bindungen werden ersetzt durch eine qualitative Zahl neuer, aber flüchtigerer Kontakte. Der Qualitätsverlust, der mit der neuen Quantität einhergeht, mündet in einer abnehmenden Intimität, die einst identitätsstiftend wirkte.
Des Weiteren behauptet Beck, dass das Individuum durch eine Ausdifferenzierung seiner Lebenswelt unterschiedliche Rollen in den jeweils verschiedenen Funktionsbereichen spielt. Für die Rollen (Arbeit, Familie, Freizeitaktivitäten etc.), die das Individuum heute teilweise simultan spielen muss, gibt es jedoch keine eindeutigen, kollektiven Muster als Vorgabe, sondern viele verschiedene Optionen zwischen denen sich der Einzelne entscheiden muss.
2. Entzauberunqsdimension
Unter einer Entzauberung der Gesellschaft versteht Beck den Schwund von verbindlichen Sinnsystemen, auf die sich die Menschen beziehen.
Sie beinhaltet beinhaltet die „Entzauberung" von Gewissheiten und die Freisetzung des Individuums zu eigenen Entscheidungen. Erkennbar wird dies laut Beck am "Ausdünnen von Traditionen, [4] und am Verlust an Glauben, Klassenbewusstsein, Nachbarschafts- und Vereinsbindungen etc..
Eine gesellschaftliche Entzauberung meint folglich, dass „kollektive und[4] gruppenspezifische Sinnquellen ( wie z.B. Klassenbewusstsein) der industriegesellschaftlichen Kultur, die noch weit ins 20. Jahrhundert hinein die westlichen Demokratie- und Wirtschaftsgesellschaften gestützt haben, aufgezehrt bzw. aufgelöst werden. Dies führt u.a. dazu, dass „mehr und mehr alle Definitionsleistungen (Identitätsbildung, Anm. C.Barz) den Individuen selbst auferlegt werden". [5] Es gibt kaum noch kollektive Identitäten, die einen jungen Menschen in seiner Identitätsarbeit unterstützen. Anders ausgedrückt, „die alltägliche Lebenswelt der Menschen ist zersplittert in eine Vielfalt von Entscheidungssituationen, für die es (nicht trotz sondern wegen der breiten Angebotspalette) keine verlässlichen 'Rezepte' mehr gibt. [6]
3. Reintegrations- und Kontrolldimension
Die dritte These der Individualisierung spricht von einer neuen „sozialen Einbindung" der vorher freigesetzten Individuen, einen Reintegrationsprozess. Durch die vorher beschriebenen Prozesse ist das Individuum angehalten, eigene Entscheidungen zu treffen.
Durch Institutionen, Regeln, aber auch durch Trenderscheinungen wird der Einzelne dennoch in seinen Entscheidungen, wer er ist und wie er handelt, gelenkt.
Ulrich Beck bezeichnet diesen Vorgang als „Re-Integrations- und Kontrolldimension", welche wesentlich durch eine Verrechtlichung des Lebens und durch eine Einschränkung der gewonnenen Individualität gekennzeichnet ist. Vielfältige institutionelle Eingriffe standardisieren Lebenslagen und Lebenswege, wodurch die Freisetzungsbestrebungen gemindert werden.
Als Beispiele können hierfür die Einbindung in das Bildungssystem und die Anforderungen des Arbeitsmarktes genannt werden:
„Ständisch geprägte, klassenkulturelle oder familiäre Lebenslaufrhythmen werden überlagert und ersetzt durch institutionelle Lebensläufe.“[7]
Fasst man die drei Dimensionen von Becks „Individualisierungsthese“ zusammen, lässt sich folgendes für das Individuum und seine Identitätsbildung datieren: Die Entzauberung raubt den Menschen ihren traditionellen Handlungsrahmen bei der Suche nach ihrer Identität und dem Sinn des Lebens. Durch die Freisetzung aus traditionellen Gefügen sind sie angehalten, eigenständig neue soziale Bindungen herzustellen. Die Verrechtlichung des Lebens, eine verstärkte Institutionalisierung aber auch Trends lenken die Vorstellung von Individualität und der eigenen Identität.
Die Konsequenz Bastelbiographie
Durch die soziokulturellen Veränderungen der Identitätsbildung ist der Einzelne der „Individualisierungsthese“ folgend angehalten, sich selbst zwischen verschiedenen Sinnsystemen zu entscheiden, wobei es sich dabei nicht um langfristige Verbindungen handelt.
Es findet dadurch regelmäßig eine Umorientierung in neue soziale Rollen statt, bei der regelmäßig einzelne Teile der Identität aktualisiert werden.
Der von Beck so bezeichnete „Sinnbastler“ ist ein Repräsentant für das, was Beck eine „Bastelexistenz“ nennt.
Charakteristisch für diese Art der Biographie oder Existenz ist, dass es den Einzelnen selbst obliegt, die Bastelei seiner Identität vorzunehmen, dabei jedoch immer beeinflusst durch leitende institutionelle Normen und Forderungen.
„Das Subjekt löst sich infolge dieser Prozesse immer mehr von den
vorgegebenen biographischen Entwurfsschablonen und Schnittmustern und muss die Lebensentwürfe in eigene Regie nehmen.“[8]
Die These einer „ Risikogesellschaft“ bedeutet im Hinblick auf eine Problematik der eigenen Identitätsarbeit, dass die Gesellschaft auf Grund einer zunehmenden „Unübersichtlichkeit“ bzw. Intransparenz, bedingt durch erweiterte Wahlmöglichkeiten, immer weniger Orientierungshilfe bei der Suche nach der Identität bietet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Ulrich Becks Theorie der „Risikogesellschaft“ das Individuum bei der Suche nach der Antwort auf die Frage nach seiner Identität bzw. „ Wer bin ich“ gesellschaftlich auf sich alleine gestellt ist.
„ Wenn das Individuum wissen will, wer es ist, dann hat es sich selbst du erfinden".[9]
„Das alltägliche Ringen um das eigene Leben ist zur Kollektiverfahrung für die westliche Welt geworden."[10]
Literaturverzeichnis:
Abels, Heinz, Identität, Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2006.
Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1986.
Hitzler, Ronald/ Honer, Anne, Bastelexistenz.Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung, in: Beck, Ulrich (Hrsg.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1994.
Keupp, Heiner/ Höfer, Renate (Hrsg.), Identitätsarbeit heute.Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1997.
Schwarte, Johannes, Der werdende Mensch. Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft heute, Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 2002.
Beck, Ulrich, Die Individualisierungsdebatte, in: Schäfers, Bernhard (Hrsg.), Soziologie in Deutschland, Leske und Budrich: Opladen 1995.
[...]
[1] Vgl. Schwarte, Johannes, Der werdende Mensch. Persönlichkeitsentwicklung heute, Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 2002, S. 260.
[2] Beck, Ulrich, Moderne, Suhrkamp-Frankfurt am Main 1986, 12.
[3] Keupp, Heiner/ Höfer, Renate Hrsg.), Identitätsarbeit heute.Klassische aktuelle Perspektiven Identitätsforschung, 1997, 16.
[4] Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1986, S.187.
[5] Beck, Ulrich, Die Individualisierungsdebatte, in: Schäfers, Bernhard ( Hrsg.), Soziologie in Deutschland, Leske und Budrich: Opladen 1995, S.185.
[6] Hitzler, Ronald/ Honer, Anne, Bastelexistenz.Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung, in: Beck, Ulrich (Hrsg.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1994, S.308.
[7] Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1986.
[8] Keupp, Heiner/ Höfer, Renate (Hrsg.), Identitätsarbeit heute.Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 1997,S.16.
[9] Abels, Heinz, Identität, Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2006, S. 232.
[10] Beck, Ulrich, Die Individualisierungsdebatte, in: Schäfers, Bernhard (Hrsg.), Soziologie in Deutschland, Leske und Budrich: Opladen 1995, S. 41.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ulrich Beck unter der „Risikogesellschaft“?
Es beschreibt eine moderne Gesellschaft, die mit selbst produzierten Risiken (ökologisch, sozial, individuell) konfrontiert ist, die über traditionelle Strukturen hinausgehen.
Was besagt die „Individualisierungsthese“?
Sie besagt, dass Menschen aus traditionellen Bindungen (Klasse, Schicht, Familie) freigesetzt werden und ihre Identität zunehmend selbst gestalten müssen.
Was sind die drei Phasen der Individualisierung nach Beck?
Die Phasen sind: 1. Freisetzungsdimension (Lösung aus Traditionen), 2. Entzauberungsdimension (Verlust von Handlungssicherheiten) und 3. Reintegrationsdimension (neue Einbindung durch Institutionen).
Was ist eine „Bastelbiographie“?
Da vorgegebene Lebensmuster fehlen, muss das Individuum seine Identität und seinen Lebenslauf aus verschiedenen Optionen selbst „zusammenbasteln“.
Welche Rolle spielen Institutionen im Individualisierungsprozess?
Trotz gewonnener Freiheit wird das Individuum durch Institutionen (Bildungssystem, Arbeitsmarkt) und Regeln wieder in standardisierte Lebensläufe eingebunden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Ulrich Beck und die Frage der Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194853