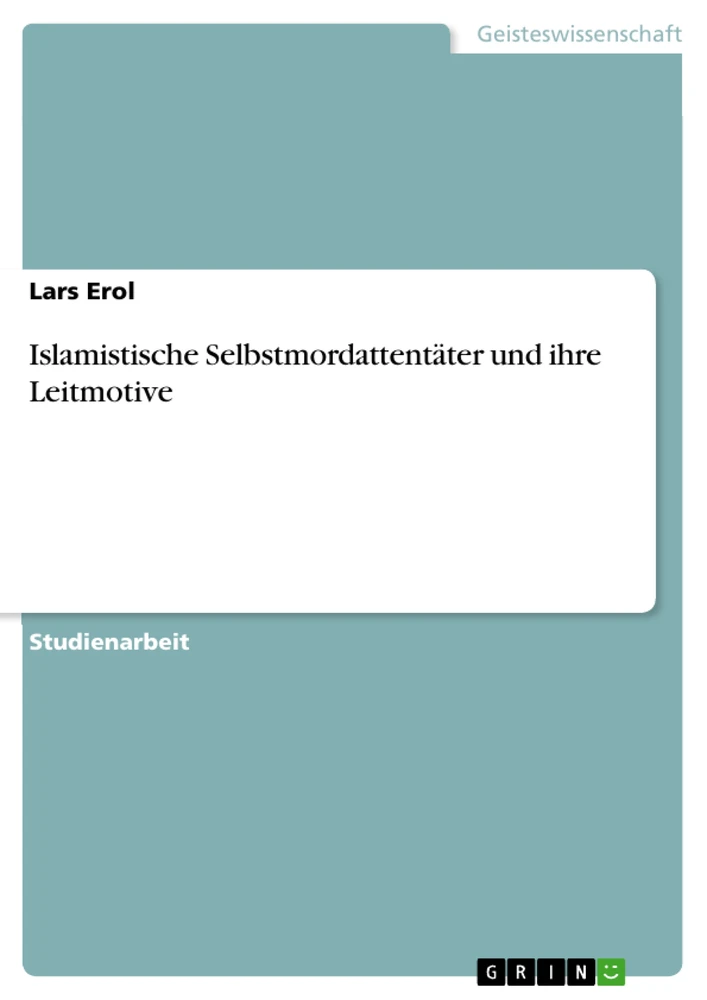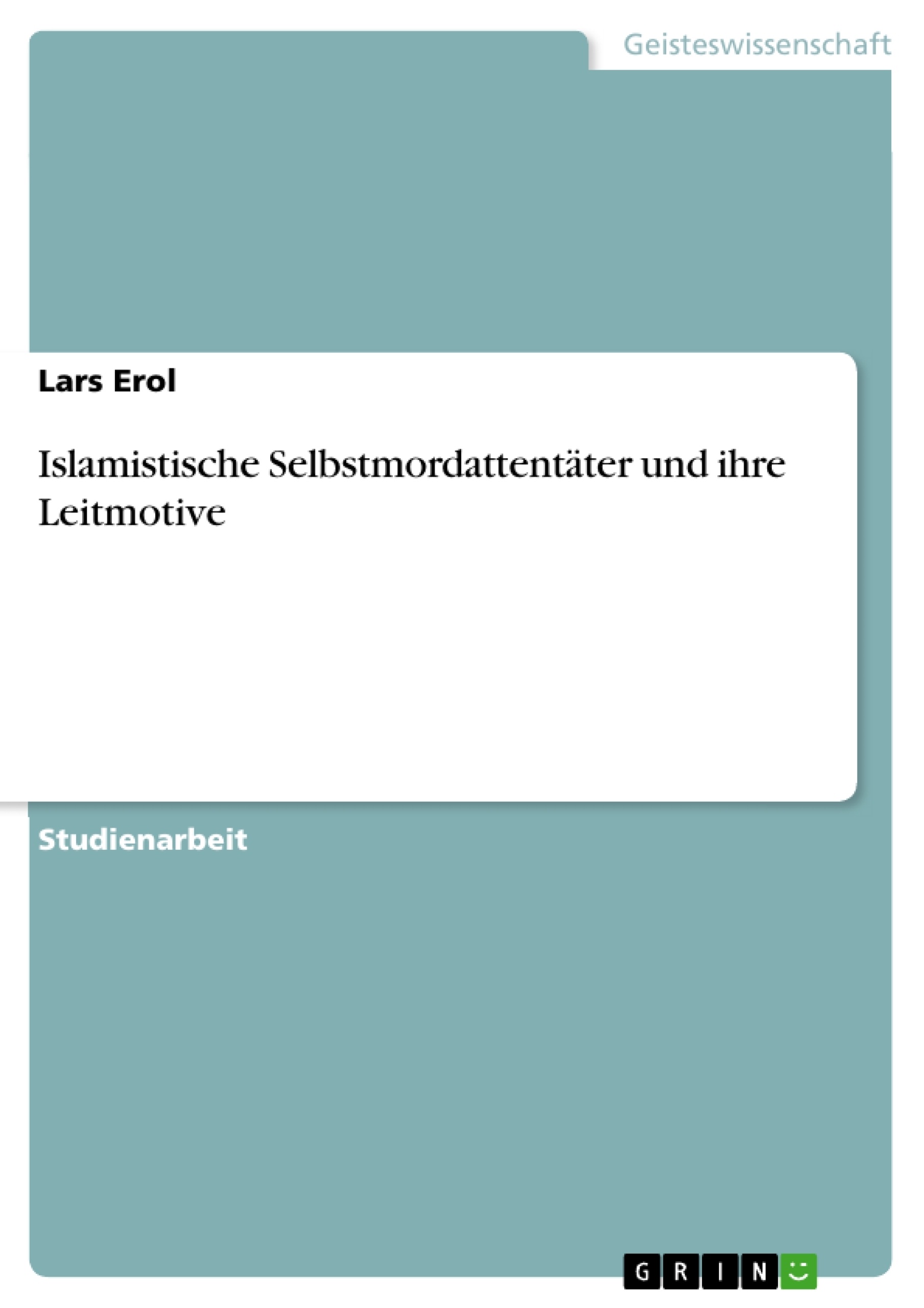Suicide bombing, heilige Bombe, Islamikaze, Selbstmordattentat, Selbsttötungschanschlag – Das Phänomen, mit dem sich die internationale Sicherheitspolitik seit dem Ende der 60er Jahre auseinandersetzen muss, hat viele Namen. Ausgehend von islamistisch geprägten Organisationen bedroht es aktuell vor allem die westlichen Gesellschaften, die von ihnen als amerikanische, israelische und europäische definiert werden. Spätestens seit den Anschlägen in Madrid im März 2004 und den Anschlägen in London im Juli 2005 ist die Bedrohung, die von diesem Phänomen ausgeht, für uns, den im europäischen Raum lebenden Menschen, bewusst geworden. Eine sicherheitspolitische Auseinandersetzung mit diesem Thema erscheint daher verpflichtend. Sie könnte für präventive Vorkehrungen oder militärische Interventionen dienen. Vielmehr versucht diese Arbeit jedoch zu klären, welche Vorstellungen, Gründe, Zwänge, oder Träume eine Gruppierung, in diesem Fall der Islamisten, so paralysieren können, dass sie ihrem eigenen Leben und dem Leben anderer Menschen keinen Wert mehr beimessen. Die individualpsychologischen Motive, wie Rache, Vergeltung oder die Belohnung für einen Märtyrer im Dies- und Jenseits, sind nur sekundär von Relevanz für diese Ausarbeitung.
Trotz dessen ist es unabdingbar sich zunächst anzusehen, welche religiösen Normen und ideologischen Vorstellungen von Islamisten ihr gemeinsames Grundethos bilden. Um dieses Ethos auf einen Selbstmordattentäter zu übertragen bedarf es einer genauen historischen Analyse, um womöglich ein Trauma festzustellen, welches destruktive Handlungen hervorrufen kann. Daraufhin wird erörtert, welche Tatsachen ein altruistischer Selbstmord, dem Selbstmord zum Wohl der Allgemeinheit, nach der Meinung der Islamisten, unerlässlich machen. Die Auswirkungen und Reaktionen auf ganze Wellen von islamistischen Selbstmordattentaten werden im letzten Teil dieser Arbeit behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen zum Verständnis
- 2.1 Religiöse und gesellschaftliche Legitimation der Selbstmordattentate
- 2.2 Die Ideologie des Islamismus
- 3. Die Ursache, das Motiv und die Wirkung der Attentate
- 3.1 Die Machtverschiebung und das Trauma
- 3.2 Das altruistische Selbstmordattentat zur Wiederherstellung der Machtverhältnisse
- 3.3 Die Wirkung der Selbstmordattentate
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Motive islamistischer Selbstmordattentäter. Sie geht der Frage nach, welche Vorstellungen und Überzeugungen Individuen dazu bewegen, ihr eigenes Leben und das anderer zu opfern. Die individualpsychologischen Motive treten dabei in den Hintergrund; im Vordergrund steht die Analyse der religiösen und gesellschaftlichen Legitimation solcher Akte.
- Religiöse und gesellschaftliche Legitimation von Selbstmordattentaten im Islam
- Die Rolle der Ideologie des Islamismus
- Das Konzept des altruistischen Selbstmords und seine Bedeutung im Kontext von Machtverschiebungen und Trauma
- Die Wirkung und die gesellschaftlichen Reaktionen auf islamistische Selbstmordattentate
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema islamistische Selbstmordattentate ein und beschreibt die Relevanz des Themas für die internationale Sicherheitspolitik. Sie betont den Fokus der Arbeit auf den zugrundeliegenden Überzeugungen und Motiven der Attentäter, anstatt auf individualpsychologischen Aspekten. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz: Zuerst wird das religiöse und ideologische Fundament beleuchtet, danach die Begründung des altruistischen Selbstmords aus der Sicht der Islamisten, und schließlich die Auswirkungen der Attentate.
2. Grundlagen zum Verständnis: Dieses Kapitel untersucht die religiösen und gesellschaftlichen Grundlagen, die Selbstmordattentate im islamistischen Kontext legitimieren. Es analysiert die verschiedenen Interpretationen des Korans und der Überlieferungen des Propheten Mohammed, insbesondere im Bezug auf den "Dschihad". Es wird die Rolle von religiösen Autoritäten und der öffentlichen Meinung in der Legitimierung solcher Taten hervorgehoben. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Märtyrertod im Vergleich zum Selbstmord werden detailliert diskutiert, inklusive statistischer Daten zur öffentlichen Meinung in Palästina bezüglich der Akzeptanz von Selbstmordattentaten. Die Meinungsbildung der Gesellschaft und deren Einfluss auf potentielle Attentäter wird als zentraler Faktor dargestellt.
Schlüsselwörter
Islamistische Selbstmordattentate, Dschihad, Märtyrertod, religiöse Legitimation, gesellschaftliche Legitimation, Machtverschiebung, Trauma, altruistischer Selbstmord, öffentliche Meinung, Ideologie des Islamismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse Islamistischer Selbstmordattentate
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Motive hinter islamistischen Selbstmordattentaten. Der Fokus liegt dabei auf der religiösen und gesellschaftlichen Legitimation dieser Akte, weniger auf individualpsychologischen Faktoren. Die Arbeit untersucht die zugrundeliegenden Überzeugungen und Vorstellungen, die Individuen dazu bewegen, ihr eigenes Leben und das anderer zu opfern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die religiöse und gesellschaftliche Legitimation von Selbstmordattentaten im Islam, die Rolle der Ideologie des Islamismus, das Konzept des altruistischen Selbstmords im Kontext von Machtverschiebungen und Trauma, sowie die Wirkung und gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Attentate.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen zum Verständnis (inkl. religiöser und gesellschaftlicher Legitimation und der Ideologie des Islamismus), Die Ursache, das Motiv und die Wirkung der Attentate (inkl. Machtverschiebung, Trauma und altruistischem Selbstmord), und Fazit.
Was wird im Kapitel "Grundlagen zum Verständnis" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die religiösen und gesellschaftlichen Grundlagen, die Selbstmordattentate im islamistischen Kontext legitimieren. Es analysiert Interpretationen des Korans und der Überlieferungen des Propheten Mohammed bezüglich des "Dschihad", die Rolle religiöser Autoritäten und der öffentlichen Meinung, und unterschiedliche Perspektiven auf den Märtyrertod im Vergleich zum Selbstmord. Statistische Daten zur öffentlichen Meinung in Palästina werden ebenfalls berücksichtigt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Motive islamistischer Selbstmordattentäter und will verstehen, welche Vorstellungen und Überzeugungen diese Akte rechtfertigen. Individualpsychologische Motive treten dabei in den Hintergrund.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Islamistische Selbstmordattentate, Dschihad, Märtyrertod, religiöse Legitimation, gesellschaftliche Legitimation, Machtverschiebung, Trauma, altruistischer Selbstmord, öffentliche Meinung, Ideologie des Islamismus.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt seine Relevanz für die internationale Sicherheitspolitik und betont den Fokus auf die Überzeugungen und Motive der Attentäter. Der methodische Ansatz – Beleuchtung des religiösen und ideologischen Fundaments, Begründung des altruistischen Selbstmords aus Sicht der Islamisten und die Auswirkungen der Attentate – wird skizziert.
- Citar trabajo
- Lars Erol (Autor), 2011, Islamistische Selbstmordattentäter und ihre Leitmotive, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194849