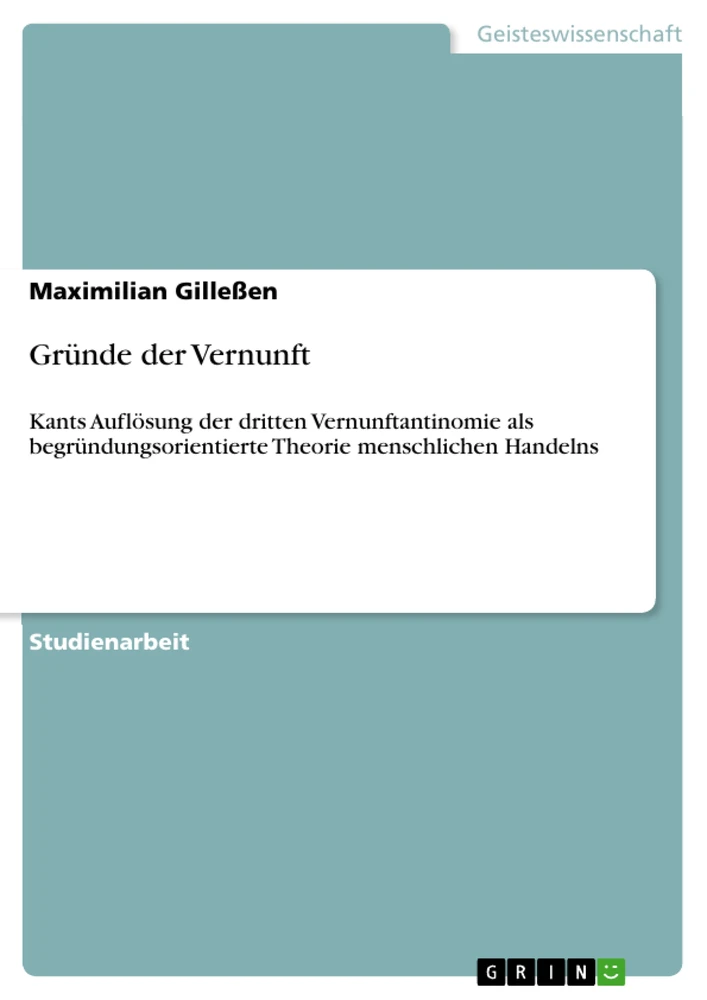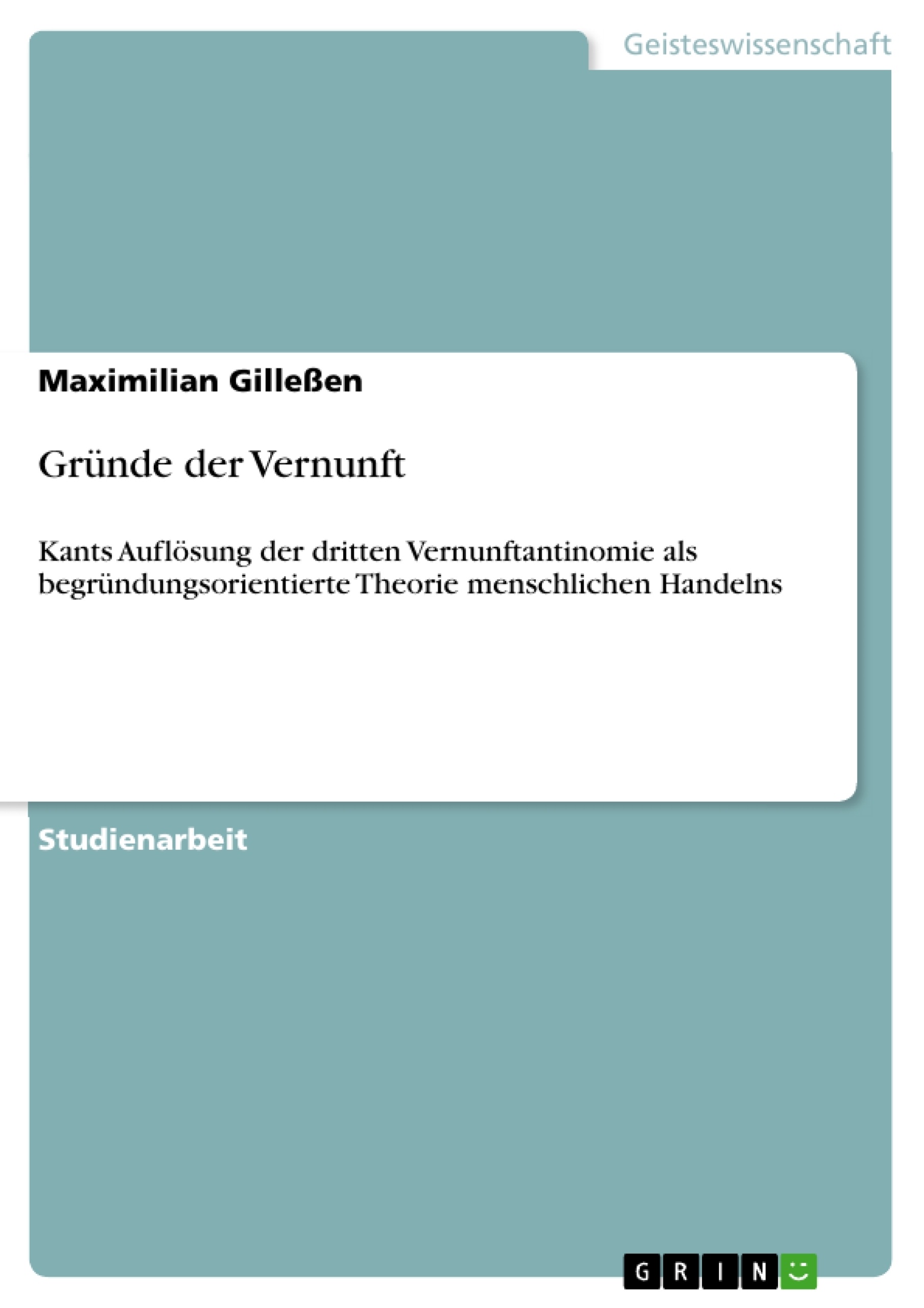Die Frage, „ob ich in meinen Handlungen frei, oder, wie andere Wesen, an dem Faden der Natur und des Schicksals geleitet sei“ (A 463/ B491) ist für die Philosophie Kants von höchster Relevanz: Nicht nur, dass Freiheit einen der „Grundsteine der Moral und Religion“ (ebd.) ausmacht, sie begründet auch das Ideal aller Aufklärung: sein eigenes Denken und Handeln von selbst bestimmen zu können.
Die Freiheitsproblematik bildet innerhalb von Kants Werk die Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. Davon zeugt wohl am klarsten die Auflösung der dritten Antinomie in der Kritik der reinen Vernunft, an die sich nahtlos die Einleitung zur Kritik der praktischen Vernunft anschließen ließe. Denn in der Auflösung beabsichtigt Kant zwar, wie er selber mit aller Deutlichkeit betont, nur zu erweisen, dass die Idee der Freiheit einer durchgehenden kausalen Determination der Natur nicht widerspräche, aber eben diese (Denk-)Möglichkeit ist es, auf der sich die praktische Philosophie seiner nachfolgenden Werke gründen wird.
Das thematische Gravitationszentrum der vorliegenden Arbeit wird die Rekonstruktion der Auflösung als begründungsorientierte Theorie menschlichen Handelns bilden. Leitend wird dabei die These sein, dass Kants Argumentation wesentlich auf der Einsicht beruht, dass wir menschliches Handeln in der Regel als begründetes und ver-stehbares zu interpretieren versuchen, insofern wir davon ausgehen, dass es durch „Gründe der Vernunft“ bestimmt worden sei. Diese Auffassung setzt aber notwendig eine Differenz zwischen Gründen als intentionalen, begrifflich – oder: präpositional – vermittelten Gehalten und naturkausalen Ursachen voraus: Was sein soll, lässt sich nicht ableiten, aus dem, was ist. Bei dieser (de)ontologischen Differenz setzt Kants These im Rahmen seines transzendenalen Idealismus an, dass Begriffe die „intelligibelen Ursachen“ des Verhaltens eines Subjekts als Wirkungen in der Erscheinungswelt seien.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Der Begriff der transzendentalen Freiheit im Kontext der dritten Antinomie
- Das Begründungsverhältnis zwischen tranzendentaler und praktischer Freiheit
- Die Auflösung der dritten Antinomie
- Der transzendentale Idealismus als Schlüssel zur Auflösung der dritten Antinomie
- Empirischer und intelligibeler Charakter
- Ursachen und Gründe
- Eine eigene Ordnung – Vernunft und intelligibeler Charakter
- Das Verhältnis zwischen intelligibelem und empirischem Charakter
- Der empirische Charakter als sinnliches Zeichen des intelligibelen
- Der intelligibele Charakter als transzendentale Ursache des empirischen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, Kants Auflösung der dritten Antinomie der reinen Vernunft als eine begründungsorientierte Theorie menschlichen Handelns zu rekonstruieren. Sie zeigt, dass Kants Argumentation wesentlich auf der Einsicht beruht, dass wir menschliches Handeln in der Regel als begründetes und verstehbar zu interpretieren versuchen.
- Der Begriff der transzendentalen Freiheit in der dritten Antinomie
- Das Begründungsverhältnis zwischen transzendentaler und praktischer Freiheit
- Die Auflösung der dritten Antinomie
- Der intelligibele Charakter als transzendentale Ursache des empirischen
- Das Verhältnis zwischen intelligibelem und empirischem Charakter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zur Einführung
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Freiheit, die für Kants Philosophie von höchster Relevanz ist. Die Freiheitsproblematik bildet innerhalb von Kants Werk die Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, wie es die Auflösung der dritten Antinomie in der Kritik der reinen Vernunft zeigt.
2. Der Begriff der transzendentalen Freiheit im Kontext der dritten Antinomie
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der dritten Antinomie der reinen Vernunft, die den Widerspruch behandelt, in den die Vernunft gerät, wenn sie angesichts der Unabschließbarkeit kausaler Begründung die Möglichkeit des Unbedingten zu denken versucht. Kant bezeichnet diesen von den Gesetzen der Naturkausalität unabhängigen Anfang als eine „Kausalität durch Freiheit“ und bestimmt sie als ein Vermögen, einen Zustand schlechthin anzufangen.
3. Das Begründungsverhältnis zwischen tranzendentaler und praktischer Freiheit
Der dritte Abschnitt betrachtet die Beziehung zwischen dem kosmologischen Freiheitsbegriff, der auf die Möglichkeit von Freiheit überhaupt in der Gestalt eines unbedingten Anfangs zielt, und dem individuellen, vor allem für die Moralphilosophie relevanten Freiheitsbegriff. Kant zeigt, dass die transzendentale Idee der Freiheit die Grundlage für den praktischen Freiheitsbegriff bildet.
4. Die Auflösung der dritten Antinomie
Dieses Kapitel beleuchtet die Auflösung der dritten Antinomie durch Kant. Er argumentiert, dass die Idee der Freiheit einer durchgehenden kausalen Determination der Natur nicht widerspricht. Diese (Denk-)Möglichkeit bildet die Grundlage für die praktische Philosophie Kants.
5. Das Verhältnis zwischen intelligibelem und empirischem Charakter
Der fünfte Abschnitt der Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem intelligibelen und dem empirischen Charakter. Kant argumentiert, dass der empirische Charakter als sinnliches Zeichen des intelligibelen Charakters verstanden werden kann, und dass der intelligibele Charakter die transzendentale Ursache des empirischen Charakters ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: transzendentale Freiheit, praktische Freiheit, dritte Antinomie, Vernunft, intelligibeler Charakter, empirischer Charakter, Ursachen, Gründe, begründungsorientierte Theorie, Handlung, Moral, Aufklärung, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft.
- Quote paper
- Maximilian Gilleßen (Author), 2010, Gründe der Vernunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194807