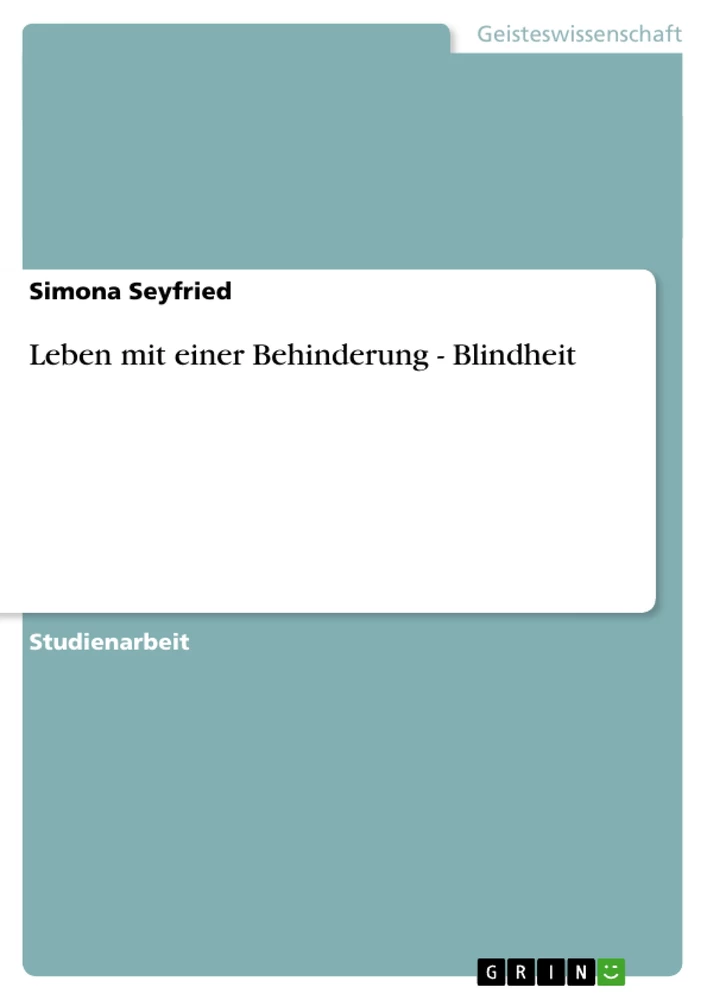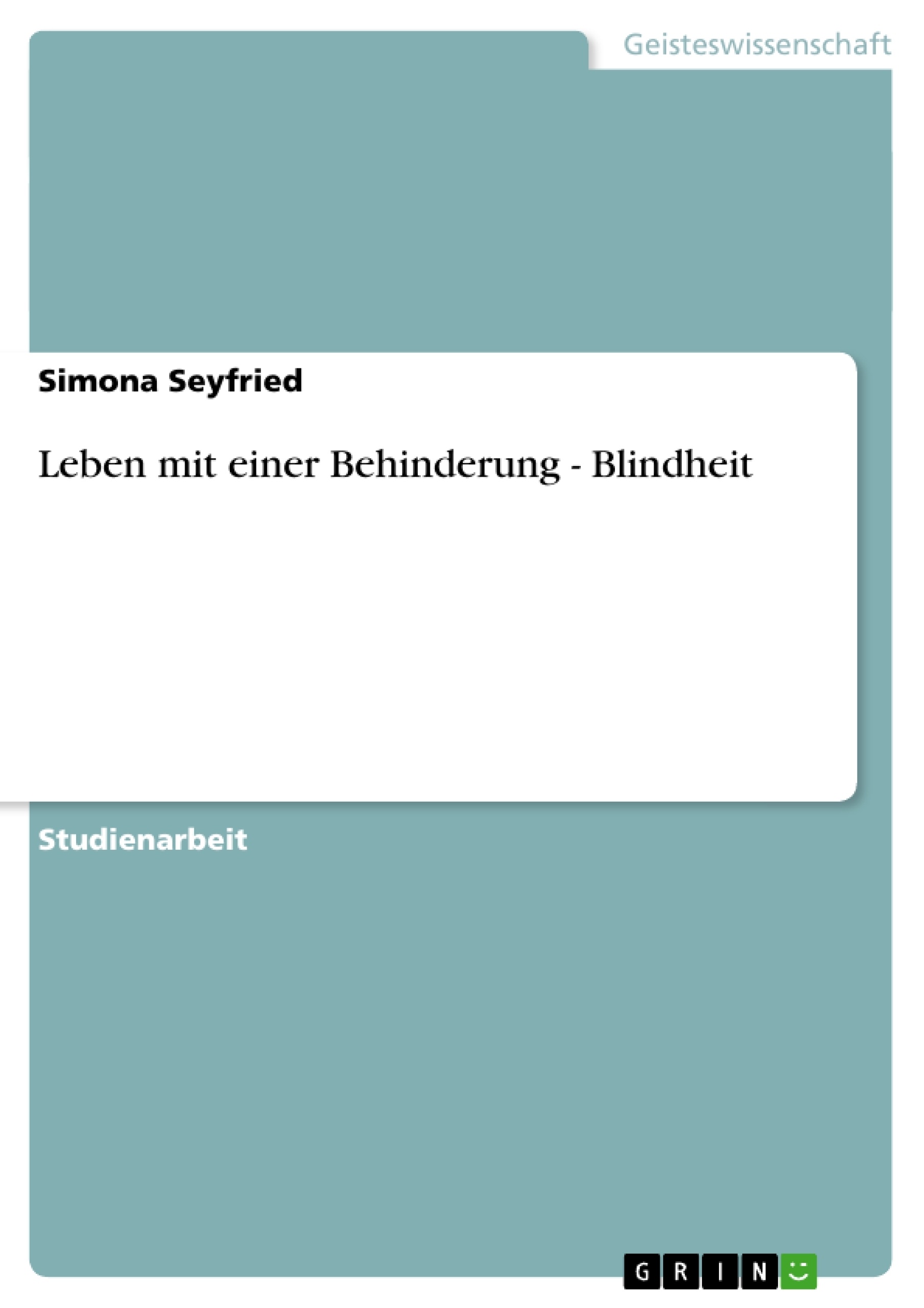Im Laufe meines Lebens hatte ich einige Begegnungen mit Blinden und stark sehbehinderten Menschen. Diese Begegnungen haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Seit dieser Zeit frage ich mich hin und wieder, wie es wohl wäre plötzlich zu erblinden. Wie würde sich mein Leben verändern? Was würde ich vermissen? Wie komme ich im Alltag zurecht?
Auf einige Fragen habe ich nach meinem Experiment als blinde Person eine Antwort erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das eigene Erleben
- 1.1 Die Wahrnehmung von sich selbst
- 1.2 Die Wahrnehmung der Umwelt
- 2. Das Verhalten
- 2.1 Das eigene Verhalten
- 2.2 Das Verhalten anderer Menschen
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschreibt ein persönliches Experiment der Autorin, in dem sie für eine gewisse Zeit simulierte Blindheit erlebte. Ziel ist es, die eigenen Erfahrungen und Veränderungen im Erleben und Verhalten während dieser Zeit zu dokumentieren und zu analysieren. Die Autorin möchte ihre persönlichen Grenzen erkunden und Rückschlüsse auf das Leben mit einer Blindheit ziehen.
- Die Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt im Zustand der simulierten Blindheit.
- Veränderungen im eigenen Verhalten und der Interaktion mit anderen Menschen.
- Die Auswirkungen der Blindheit auf den Alltag und die sozialen Beziehungen.
- Die Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Umgang mit der simulierten Behinderung.
- Der Vergleich der eigenen Erfahrungen mit den Erfahrungen von Menschen, die von Geburt an blind sind.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das eigene Erleben: Die Autorin beschreibt ihre anfänglichen Schwierigkeiten und das Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag ohne Sehvermögen. Sie berichtet über die zunehmende Abhängigkeit von anderen Menschen und die damit verbundene Belastung. Besonders die Beeinträchtigung der Selbstwahrnehmung, wie z.B. die Einschätzung der eigenen Körperhaltung und die Kontrolle der Essensmenge, wird hervorgehoben. Die Autorin beschreibt auch die Veränderungen in ihrem emotionalen Zustand, von anfänglicher Verzweiflung bis hin zu einer allmählichen Anpassung und dem Entdecken kleiner Erfolge im selbständigen Handeln. Sie betont die Isolation und den Rückzug aus dem sozialen Leben, der sich aus der Behinderung ergab. Die anfängliche Überforderung durch Geräusche und die Schwierigkeiten mit dem Gleichgewichtssinn werden ebenfalls ausführlich geschildert, sowie ein Vergleich mit den Erfahrungen von Menschen, die von Geburt an blind sind, und deren besserer Anpassung an diese Situation.
2. Das Verhalten: Dieses Kapitel setzt die Schilderung der Erfahrungen fort und fokussiert sich auf die Auswirkungen der simulierten Blindheit auf das Verhalten der Autorin. Es beschreibt Veränderungen im eigenen Verhalten, wie z.B. vermehrte Langsamkeit und Ungeschicklichkeit in Bewegungen, sowie die Reduktion der Kommunikation und sozialen Kontakte. Die Autorin analysiert ihre Reaktionen auf die veränderte Wahrnehmung und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie reflektiert über die Veränderung ihrer Interaktion mit anderen Menschen, die zwischen anfänglicher Überforderung durch die ständige Notwendigkeit von Hilfe und der allmählichen Akzeptanz der Situation schwankt. Der Kontrast zwischen der eigenen Erfahrung und dem Verhalten von geborenen Blinden wird weitergeführt und vertieft. Es wird auch thematisiert, wie sich die Umgebungsgeräusche auf die Autorin auswirken.
Schlüsselwörter
Blindheit, simulierte Behinderung, Wahrnehmung, Verhalten, Selbstwahrnehmung, Umweltwahrnehmung, soziale Interaktion, Kommunikation, Alltag, Hilflosigkeit, Anpassung, Isolation, Erfahrungsbericht, persönliche Grenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Persönliches Experiment zur simulierten Blindheit
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument beschreibt ein persönliches Experiment der Autorin, in dem sie für eine gewisse Zeit simulierte Blindheit erlebte. Es dokumentiert und analysiert ihre Erfahrungen und Veränderungen im Erleben und Verhalten während dieser Zeit. Der Fokus liegt auf der Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt, Veränderungen im Verhalten und der sozialen Interaktion, sowie den Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Umgang mit der simulierten Behinderung. Ein Vergleich mit den Erfahrungen von geborenen Blinden wird ebenfalls gezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Auswirkungen der simulierten Blindheit auf die Wahrnehmung (Selbst- und Umweltwahrnehmung), das Verhalten (eigene Verhaltensänderungen und Interaktion mit anderen), den Alltag und die sozialen Beziehungen. Weitere Aspekte sind die Herausforderungen, Bewältigungsstrategien, Isolation, Hilflosigkeit und die Anpassung an die Situation.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel ("Das eigene Erleben" und "Das Verhalten") und eine Liste mit Schlüsselbegriffen. Die Kapitelzusammenfassungen beschreiben detailliert die Erfahrungen der Autorin während des Experiments.
Was ist die Zielsetzung des Experiments?
Die Autorin wollte ihre eigenen Erfahrungen und Veränderungen im Erleben und Verhalten während der simulierten Blindheit dokumentieren und analysieren. Sie wollte ihre persönlichen Grenzen erkunden und Rückschlüsse auf das Leben mit einer Blindheit ziehen. Ein Vergleich mit den Erfahrungen von Menschen, die von Geburt an blind sind, spielte ebenfalls eine Rolle.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Blindheit, simulierte Behinderung, Wahrnehmung, Verhalten, Selbstwahrnehmung, Umweltwahrnehmung, soziale Interaktion, Kommunikation, Alltag, Hilflosigkeit, Anpassung, Isolation und Erfahrungsbericht.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse des Experiments (Kapitelzusammenfassung)?
Im Kapitel "Das eigene Erleben" beschreibt die Autorin anfängliche Schwierigkeiten, Hilflosigkeit, Abhängigkeit von anderen, Beeinträchtigung der Selbstwahrnehmung, emotionale Veränderungen (Verzweiflung bis Anpassung), Isolation und den Vergleich mit den Erfahrungen von geborenen Blinden. Im Kapitel "Das Verhalten" wird der Fokus auf Verhaltensänderungen (Langsamkeit, Ungeschicklichkeit, reduzierte Kommunikation), die veränderte Interaktion mit anderen und die Auswirkungen von Umgebungsgeräuschen gelegt. Der Vergleich mit den Erfahrungen von geborenen Blinden wird vertieft.
- Arbeit zitieren
- Simona Seyfried (Autor:in), 2010, Leben mit einer Behinderung - Blindheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194799