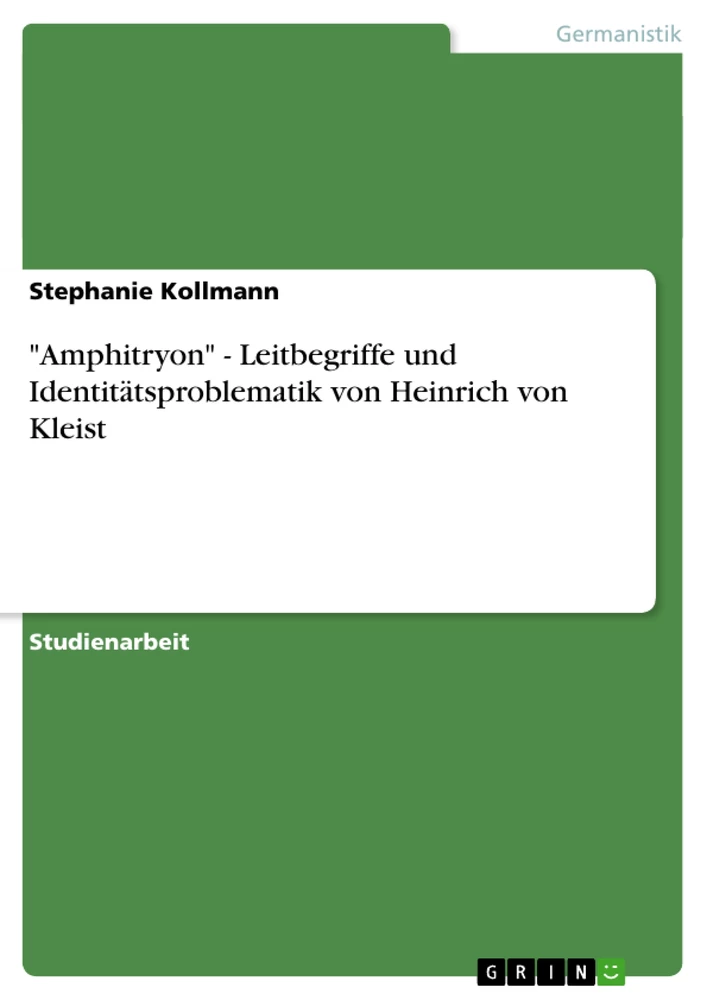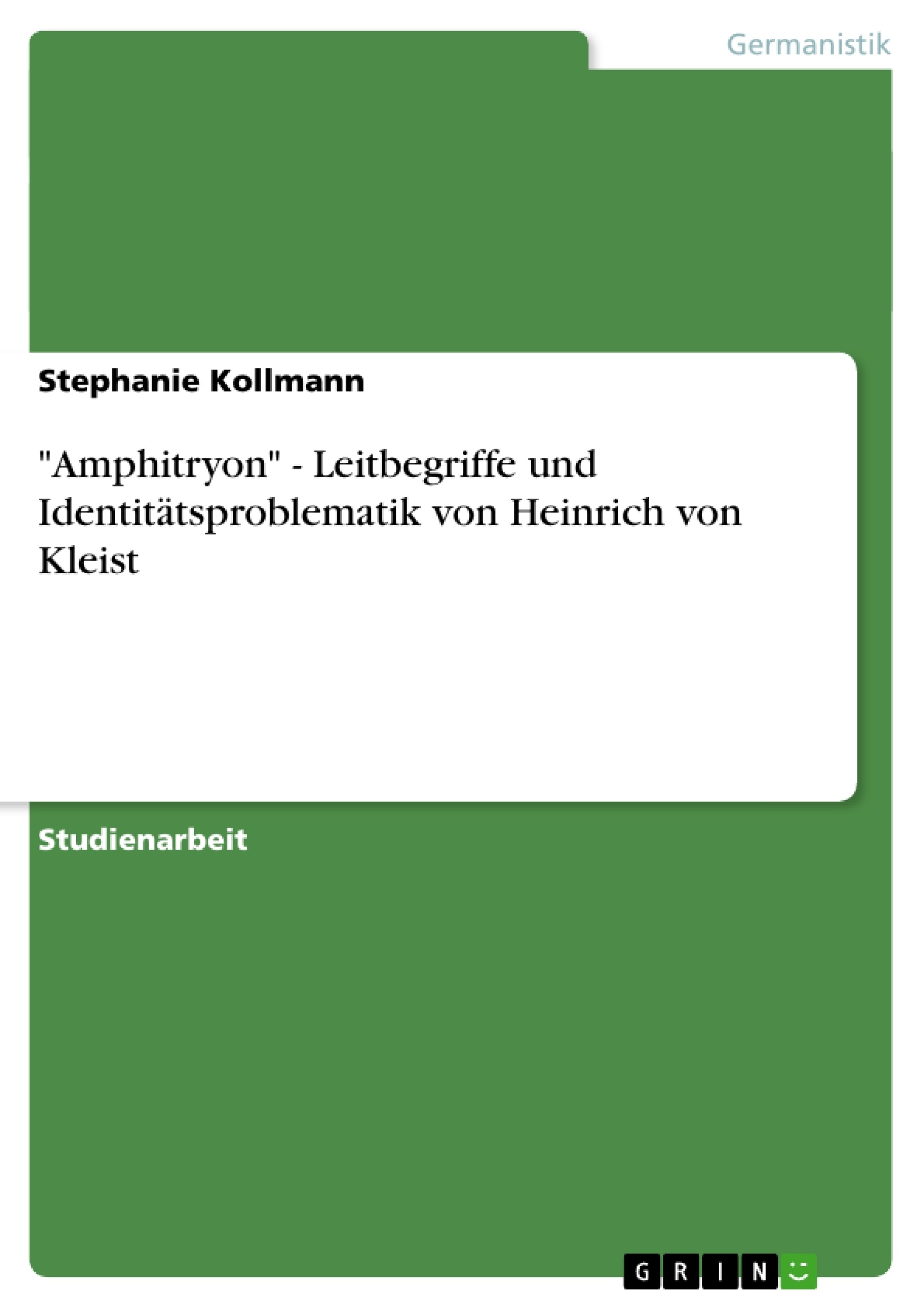Heinrich von Kleists Komödie „Amphitryon“, die er selbst „Ein Lustspiel nach Molière“
nannte, besteht aus drei Akten von jeweils fünf bis elf Szenen pro Akt.
Sie wird durchgängig bestimmt von dem Motiv des Rollentausches und der damit
entstehenden Identitätsproblematik.
Schon im ersten Akt werden die Hauptpersonen vorgestellt und damit auch der
Rollentausch eingeführt. Diese sind:
Amphitryon, der Feldherr der Thebaner und somit Oberster der Thebaner.
Jupiter, Donnergott und Oberster der Götter, der in der Gestalt von Amphitryon
erscheint.
Sosias, Diener des Amphitryon.
Merkur, Diener des Jupiter und Gott, der in der Gestalt von Sosias auftritt.
Alkmene, die Frau von Amphitryon.
Charis, die Frau von Sosias.
Nicht nur das „Herr – Knecht Verhältnis“, sondern auch die optische Erscheinungsform
von Amphitryon und Jupiter sowie Sosias und Merkur sind gleich.
Somit ist der Rollentausch das bestimmende Motiv in dem gesamten Drama.
Gesetzt den Fall, dass dem Zuschauer im Theater das Drama und die Personen
bekannt sind, liegt hier ein Schwerpunkt der Komödie. Etliche komische,
verwunderliche und auch nachdenklich stimmende Szenen entstehen dadurch.
Denn wer findet es nicht komisch solchen Verwechslungen zuzusehen? Und wer fragt
sich nicht: Wie würde ich mich wohl verhalten, wenn ich plötzlich meinem eigenen
Spiegelbild gegenüberstehen würde? oder: Woran könnte ich erkennen, ob diese Frau
meine Ehefrau oder nur eine Doppelgängerin ist?
Diese Fragen und Überlegungen schaffen die Identitätsproblematik, denn woran macht
man das „ICH“ fest? Ist es das Verhalten, das innere Gefühl, das Aussehen oder sind
es Belege, die man sehen oder auch nicht sehen kann? Sind das überhaupt stichfeste
Merkmale und Beweise?
Sosias sagt in Vers 710-7151: „Jedoch zuletzt erkannt ich, musst ich mich,
Ein Ich, so wie das andre, anerkennen.
Hier stand’s, als wär die Luft ein Spiegel vor mir,
Ein Wesen völlig wie das meinige, Von diesem Anstand, seht, und diesem Wuchse,
Zwei Tropfen Wasser sind nicht ähnlicher.“ [...]
1 Heinrich von Kleist: Amphitryon. Stuttgart. Reclam. 2002, S. 28
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Identitätsproblem
- Leitbegriffe
- Wahrheit
- Täuschung
- Irrtum
- Traum
- Sinne
- Beweis
- Zeugen
- Erkenntnissicherheit
- Skepsis
- Identitätsproblematik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Identitätsproblematik in Heinrich von Kleists Komödie „Amphitryon“ anhand der Leitbegriffe, die im Stück eine zentrale Rolle spielen. Die Analyse zielt darauf ab, die verschiedenen Facetten der Identitätskrise der Figuren im Kontext des Rollenspiels und der Täuschung zu beleuchten.
- Der Rollentausch als zentrales Motiv und seine Auswirkungen auf die Identitäten der Figuren.
- Die Ambivalenz von Wahrheit und Täuschung und die Schwierigkeiten, diese im Stück zu unterscheiden.
- Die Bedeutung der Sinne und der Beweisführung für die Konstruktion von Identität.
- Die Rolle von Skepsis und Irrtum in der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.
- Die Aktualität des Themas in Kleists Stück und seine Relevanz für die heutige Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die Identitätsproblematik: Die Einführung stellt Kleists „Amphitryon“ als Komödie vor, die durch den Motiv des Rollentausches und die daraus resultierende Identitätsproblematik geprägt ist. Die Hauptfiguren – Amphitryon, Jupiter, Sosias, Merkur, Alkmene und Charis – werden vorgestellt, wobei die Ähnlichkeit zwischen Amphitryon/Jupiter und Sosias/Merkur betont wird. Die Komik des Stückes entsteht aus den Verwechslungen und der Frage, wie man die eigene Identität inmitten von Täuschung und Doppelgängern feststellen kann. Die existenzielle Frage nach dem „Ich“ wird aufgeworfen: Ist es das Verhalten, die Gefühle, das Aussehen, oder objektive Beweise, die die Identität definieren? Sosias' Aussage über die Ähnlichkeit mit seinem Doppelgänger verdeutlicht diese Unsicherheit. Kleists Stück thematisiert ein zeitloses Thema, dessen Aktualität bis in die Gegenwart reicht, wie Anthony Stephens hervorhebt, der das perfekte Rollenspiel und die Ambivalenz zwischen gesellschaftlicher Erwartung und individueller Identität beschreibt.
Leitbegriffe: Dieser Abschnitt analysiert neun Leitbegriffe, die im Zusammenhang mit der Identitätsproblematik in „Amphitryon“ von zentraler Bedeutung sind: Wahrheit, Täuschung, Irrtum, Traum, Sinne, Beweis, Zeugen, Erkenntnissicherheit und Skepsis. Diese Begriffe tauchen in den Versen 1122-1147 auf und bilden den Rahmen für die Diskussion der Identitätskrise. Der Begriff „Wahrheit“ wird als Übereinstimmung von Tatsache und Behauptung definiert und im Kontext des Rollenspiels und der Täuschung hinterfragt. Die Schwierigkeit, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, wird betont, da selbst das Aussehen der Götter nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Die Frage, woran man die Wahrheit erkennen kann, bleibt offen.
Schlüsselwörter
Identitätsproblematik, Rollentausch, Wahrheit, Täuschung, Irrtum, Traum, Sinne, Beweis, Zeugen, Erkenntnissicherheit, Skepsis, Kleist, Amphitryon, Komödie, Rollenspiel.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Amphitryon" - Eine Identitätsanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Identitätsproblematik in Heinrich von Kleists Komödie „Amphitryon“. Sie untersucht, wie der Rollentausch und die damit verbundene Täuschung die Identitäten der Figuren beeinflussen und welche Rolle dabei Begriffe wie Wahrheit, Irrtum und Skepsis spielen. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Facetten der Identitätskrise im Kontext des Stücks und deren Aktualität.
Welche Leitbegriffe werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf neun zentrale Leitbegriffe: Wahrheit, Täuschung, Irrtum, Traum, Sinne, Beweis, Zeugen, Erkenntnissicherheit und Skepsis. Diese Begriffe werden im Kontext des Rollenspiels und der Identitätskrise der Figuren untersucht und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Identität beleuchtet.
Welche Figuren werden in der Analyse betrachtet?
Die Hauptfiguren Amphitryon, Jupiter, Sosias, Merkur, Alkmene und Charis stehen im Mittelpunkt der Analyse. Die Ähnlichkeit zwischen Amphitryon/Jupiter und Sosias/Merkur und die daraus resultierenden Verwechslungen bilden einen zentralen Aspekt der Identitätsproblematik.
Wie wird die Komik des Stücks im Zusammenhang mit der Identitätsproblematik dargestellt?
Die Komik entsteht aus den Verwechslungen und der daraus resultierenden Unsicherheit über die wahre Identität der Figuren. Die Frage, wie man die eigene Identität inmitten von Täuschung und Doppelgängern feststellen kann, ist ein zentrales komisches und zugleich existentielles Element.
Welche Rolle spielt der Rollentausch im Stück?
Der Rollentausch ist das zentrale Motiv des Stücks und hat weitreichende Auswirkungen auf die Identitäten der Figuren. Er stellt die Frage nach der Definition von Identität in den Vordergrund: Ist es das Verhalten, die Gefühle, das Aussehen oder objektive Beweise, die die Identität bestimmen?
Wie wird die Ambivalenz von Wahrheit und Täuschung dargestellt?
Das Stück thematisiert die Schwierigkeit, Wahrheit von Täuschung zu unterscheiden. Selbst das Aussehen der Götter entspricht nicht mehr zwingend der Wirklichkeit, was die Frage nach der Erkennbarkeit der Wahrheit offen lässt.
Welche Bedeutung haben die Sinne und die Beweisführung für die Konstruktion von Identität?
Die Sinne und die Beweisführung spielen eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Identität. Die Analyse untersucht, inwieweit die Wahrnehmung und die verfügbaren Beweise zur Klärung der Identitätskrise beitragen.
Welche Rolle spielen Skepsis und Irrtum in der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität?
Skepsis und Irrtum sind zentrale Elemente der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Die Figuren kämpfen mit der Unsicherheit, ihre wahre Identität zu erkennen, und sind von Irrtümern und Zweifeln geprägt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in die Identitätsproblematik, eine Analyse der Leitbegriffe und eine Zusammenfassung der Kapitel. Die Einführung stellt das Stück vor und beschreibt die Hauptfiguren und die zentrale Thematik. Die Analyse der Leitbegriffe beleuchtet deren Bedeutung im Kontext der Identitätskrise. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Identitätsproblematik, Rollentausch, Wahrheit, Täuschung, Irrtum, Traum, Sinne, Beweis, Zeugen, Erkenntnissicherheit, Skepsis, Kleist, Amphitryon, Komödie, Rollenspiel.
- Quote paper
- Stephanie Kollmann (Author), 2003, "Amphitryon" - Leitbegriffe und Identitätsproblematik von Heinrich von Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19472