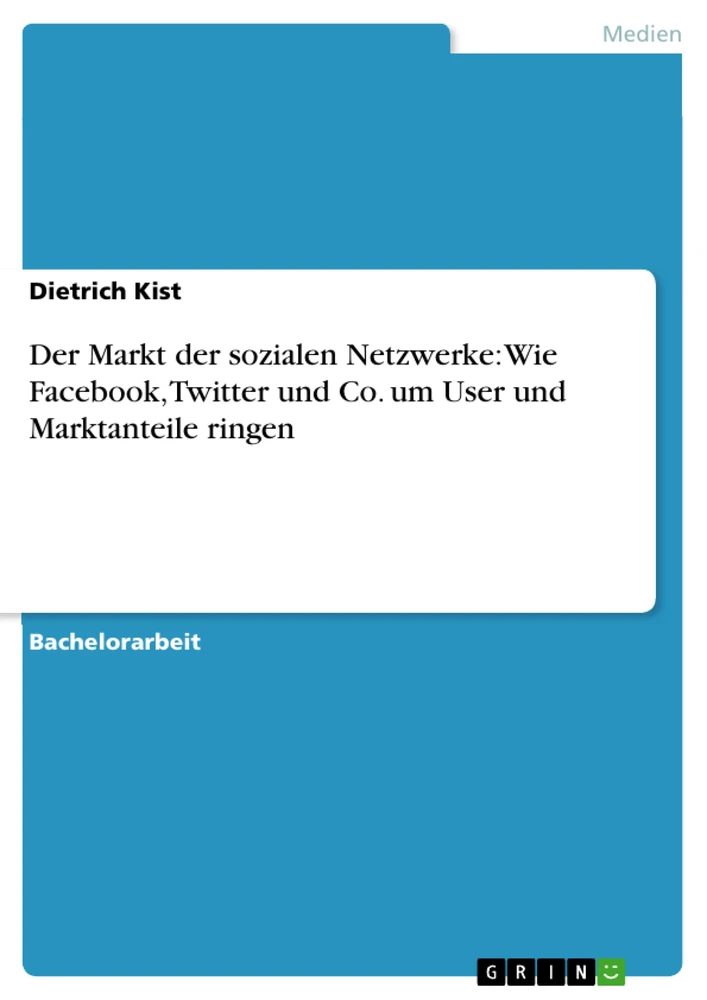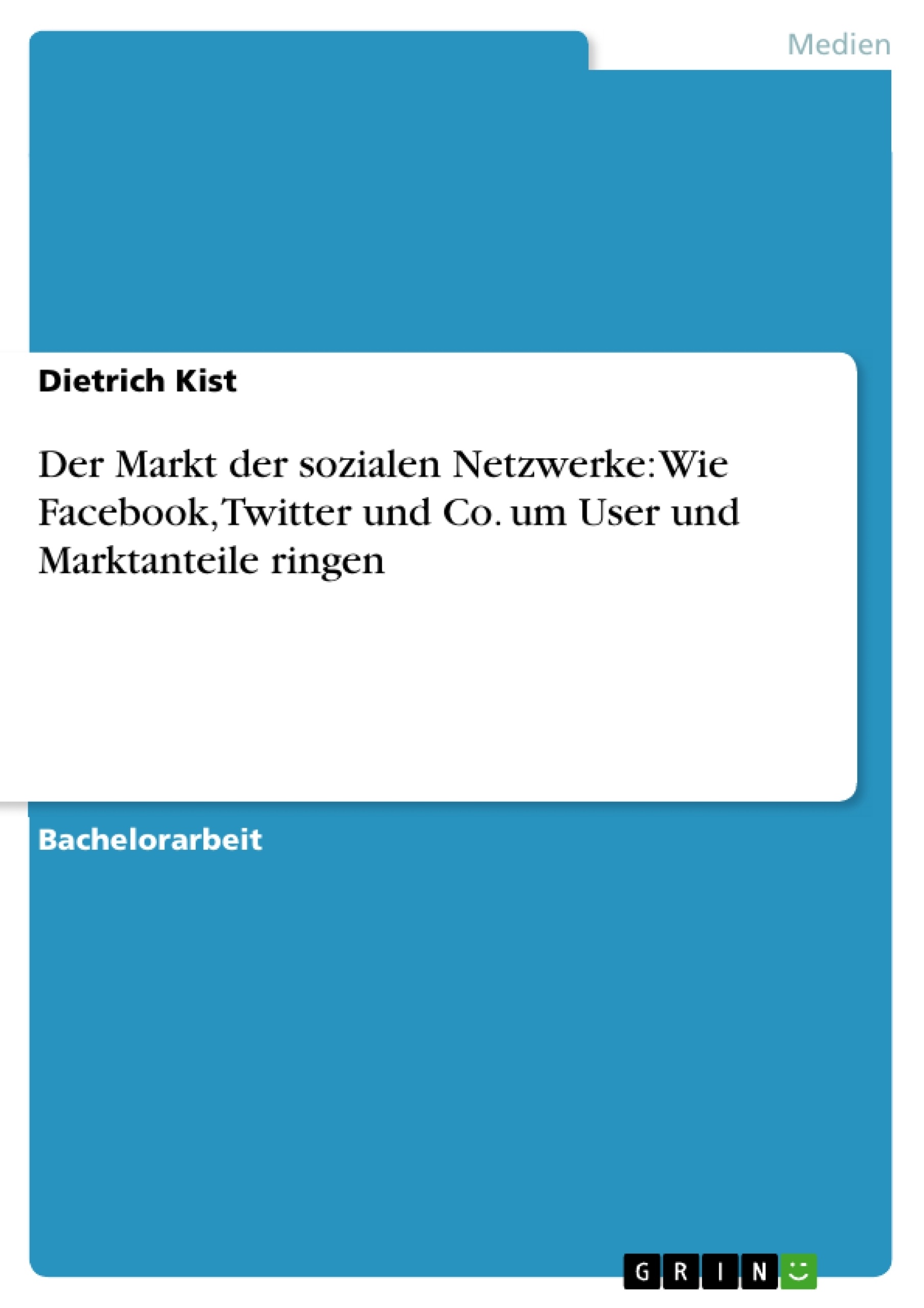Seit ihrem ersten Erscheinen vor gut fünf Jahren haben soziale Netzwerke wie Facebook, Myspace oder Youtube zunehmend das Internet erobert und gänzlich neue Formen der Vernetzung entwickelt. Diese sozialen Plattformen setzen sich aufgrund der niedrigen Eintrittsbarrieren für die Veröffentlichung und Verbreitung von Informationen sowie ihrer Reichweite, Beständigkeit und Geschwindigkeit immer stärker gegen herkömmliche Medien als Informationsquelle durch. Doch hinter „Social Media“ verbirgt sich mehr: Es besteht die Möglichkeit, andere Teilnehmer des Netzwerkes an seinen Erlebnissen und Gefühlen teilnehmen zu lassen, sich in Geschehnisse oder Diskussionen einzubinden und deren Verlauf zu beeinflussen. Nicht zuletzt wurde am Beispiel der US-Präsidentschaftswahlen 2008 - bei denen der US-Präsident Barack Obama seinen Wahlkampf über die Plattform Facebook auf eine elektronische Ebene erfolgreich ausweitete - deutlich, welche Bedeutung die neuen Plattformen eingenommen haben.
In diesem Zusammenhang lautet die ökonomische Frage: Wie konnte es in einer Zeitspanne von nur wenigen Jahren zu einer solchen Nachfrage nach „Social Networks“ kommen? Welche Entwicklungen haben stattgefunden und warum sind Twitter, Facebook und MySpace im Vergleich zu ihren Vorgängern (Foren, Communities) so erfolgreich?
Der Begriff „Social Media“ darf allerdings nicht missverstanden werden, denn die meisten Betreiber der Plattformen sind international agierende Konzerne, die nach Wachstum und Gewinnmaximierung streben. Facebook, das größte soziale Netzwerk der Welt, setzte z.B. 2009 700 Millionen Dollar um und erwartet in den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum über die Milliardengrenze (Eldon 2010). Die 2006 eingeführte Plattform Twitter wuchs - nach Angaben des Marktforschungsinstitutes Nielsen - von Februar 2008 bis Februar 2009 um 1382 Prozent (o.V. 2009).
Eine derartige Entwicklung lässt die Frage aufkommen, wie sich solche Netzwerke – in Anbetracht der Tatsache, dass sie vielfach den Nutzern kostenlos bereitgestellt werden - finanzieren?
Gegenstand dieser Arbeit ist die ökonomische Analyse der Wechselwirkungen einzelner Akteure in sozialen Netzwerken. Der Untersuchung liegen mikroökonomische Modelle der Netzwerkökonomie und Spieltheorie zugrunde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. PROBLEMStellung
- 2. Strategien zur Ausnutzung von direkten Netzwerkeffekten
- 2.1 Direkte Netzwerkeffekte am Beispiel einer „Monopolplattform“
- 2.2 Plattformadoption und Strategien im Wettbewerb um Nutzergruppen
- 2.3 Wohlfahrtsoptimale Plattformwahl
- 2.4 Wohlfahrtsanalyse des Wettbewerbsergebnisses
- 2.5 Strategien im Verdrängungswettbewerb
- 3. Strategien zur Ausnutzung der bilateralen Netzwerkeffekte
- 3.1 „Social Media“ ein Zweiseitiger Markt
- 3.2 Strategie der ausschließlichen Werbefinanzierung
- 3.3 Strategien bei gemischter Finanzierung
- 3.4 Marktkonzentration aufgrund der Interaktion zwischen Nutzer- und Werbemarkt
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ökonomischen Wechselwirkungen einzelner Akteure in sozialen Netzwerken, wie beispielsweise Facebook, Myspace oder Youtube. Sie untersucht die Strategien, die „Social Media“-Plattformen anwenden, um ihre Nutzerzahlen zu maximieren und ihre Marktposition zu stärken. Die Analyse stützt sich auf mikroökonomische Modelle der Netzwerkökonomie und Spieltheorie.
- Ausnutzung von direkten Netzwerkeffekten
- Strategien zur Maximierung der Nutzeranzahl
- Analyse der Plattform- und Werbemarkt-Interaktion
- Wirtschaftliche Modellierung der „Social Media“-Entwicklung
- Finanzierungsmodelle für kostenlose Plattformen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Problemstellung
- Kapitel 2: Strategien zur Ausnutzung von direkten Netzwerkeffekten
- Kapitel 3: Strategien zur Ausnutzung der bilateralen Netzwerkeffekte
Dieses Kapitel führt die Thematik der „Social Media“ ein und beleuchtet deren rasante Entwicklung. Es stellt die ökonomische Frage nach den Ursachen für den Erfolg von „Social Media“-Plattformen wie Facebook und Twitter.
Dieses Kapitel analysiert die Nutzung direkter Netzwerkeffekte im Zusammenhang mit „Social Media“. Es beschreibt das Modell von Rohlfs (1974) und untersucht die Nachfrage nach „Social Media“ anhand der Aversion der Nutzer gegenüber verschiedenen Plattform-Charakteristika.
Dieses Kapitel untersucht die bilateralen Netzwerkeffekte von „Social Media“. Es stellt die Besonderheit des Zweiseitigen Marktes heraus, bei dem sowohl Nutzer als auch Werbetreibende einen Nutzen aus der Plattform ziehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die ökonomischen Aspekte der „Social Media“-Entwicklung. Sie untersucht die strategische Nutzung von direkten und bilateralen Netzwerkeffekten, die Rolle der Nutzergruppen, die Einflussfaktoren auf die Plattformwahl und die Interaktion zwischen Nutzer- und Werbemarkt. Wichtige Themen sind die Preisgestaltung von „Social Media“-Plattformen, die Finanzierungsmodelle und die Bedeutung von Marktkonzentration.
- Citation du texte
- Dietrich Kist (Auteur), 2011, Der Markt der sozialen Netzwerke: Wie Facebook, Twitter und Co. um User und Marktanteile ringen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194287