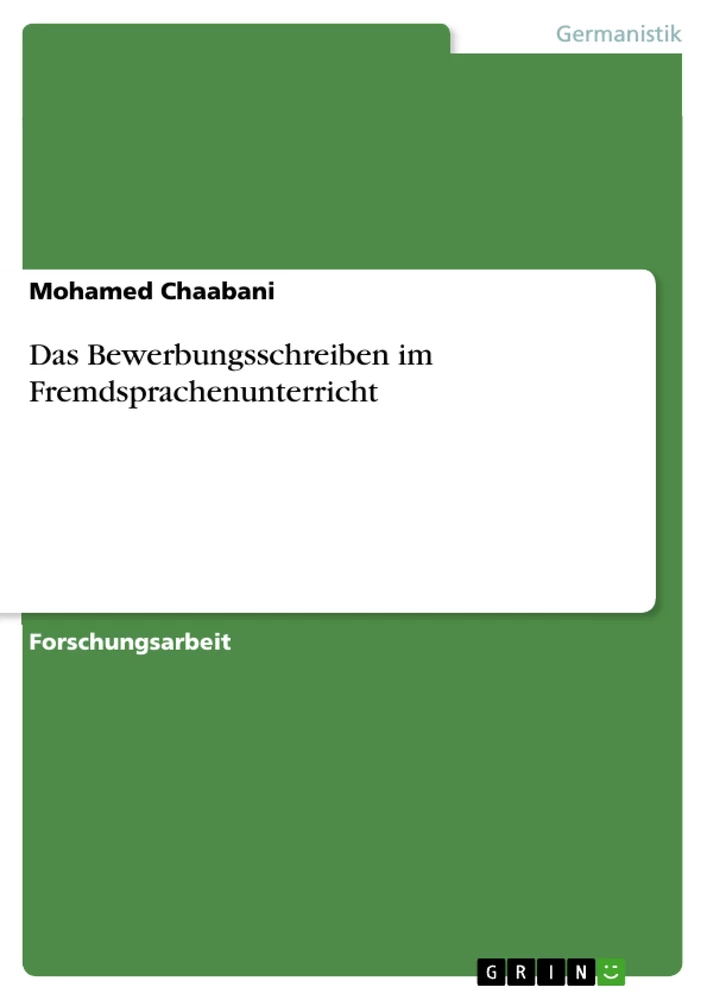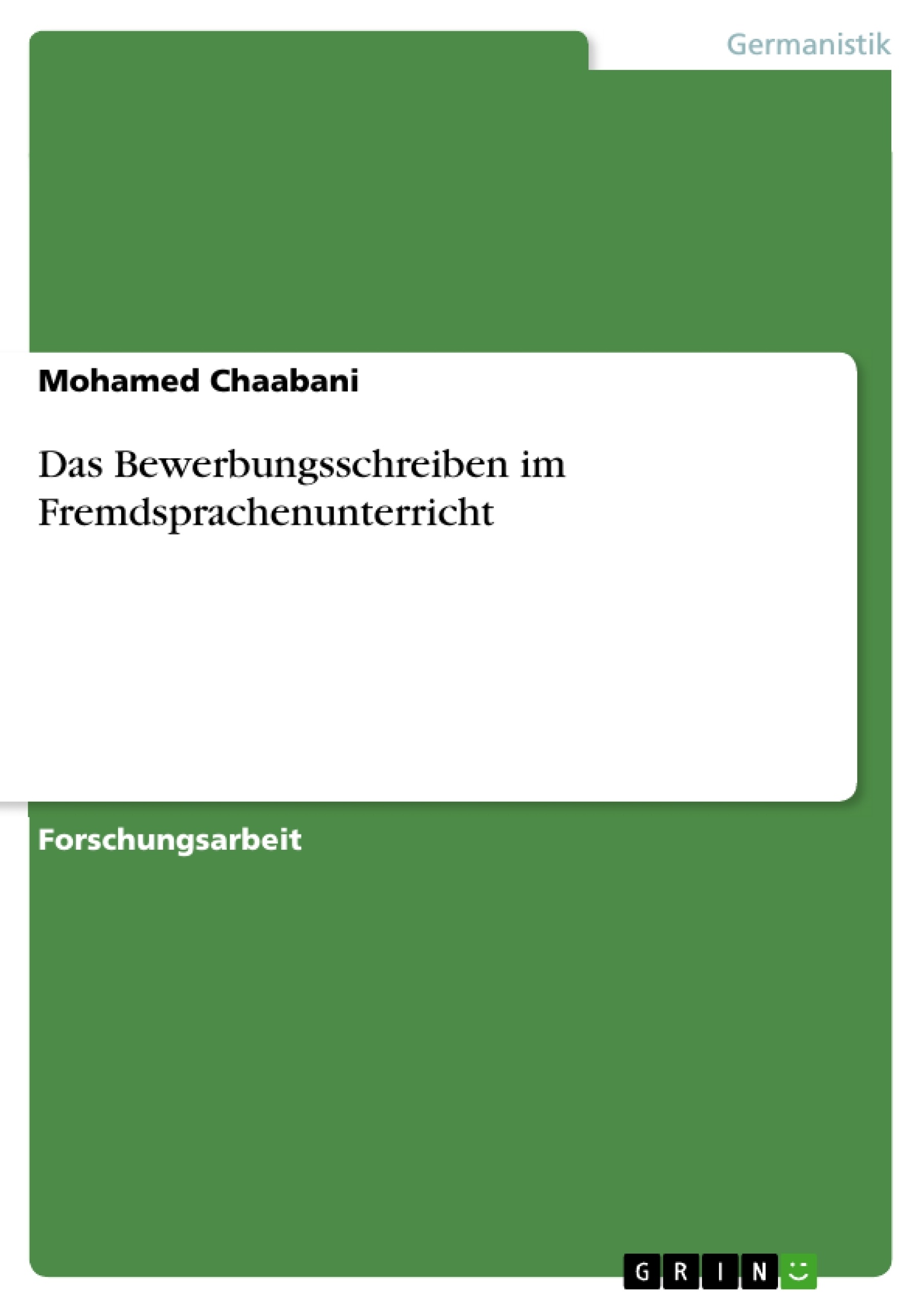Abstract
Das Schreiben von Bewerbungen im Fremdsprachenunterricht spielt eine große Rolle, besonders für eine zukünftige Karriere. Aus diesem Grund möchte die vorliegende Arbeit dieser Textsorte einer Analyse unterziehen. Es werden Studententexte an der Universität Oran durchgeführt und in zwei Messzeitpunkten untersucht.
Chaabani Mohamed
Abstract
Das Schreiben von Bewerbungen im Fremdsprachenunterricht spielt eine Rolle, besonders für eine zukünftige Karriere. Aus diesem Grund möchte die vorliegende Arbeit dieser Textsorte einer Analyse unterziehen. Es werden Studententexte an der Universität Oran durchgenommen und in zwei Messzeitpunkten untersucht.
Bewerbungsschreiben
Ein formeller Brief unterscheidet sich im Wesentlichen durch seine Form. In diesem Gedankengang sei auf die Ausführungen von Franck, N. (2005)[1]. verwiesen, dass die Form eines Bewerbungsschreiben das A und O sei, denn sie könnte einen Einfluss auf das Interesse des Lesers haben. Bei der Gestaltung eines formellen Briefes sollten folgende Konventionen berücksichtigt werden: Als erstes wird die Anschrift geschrieben. Darin stehen im Allgemeinen Name, Vorname, Straße und Nummer, Postleitzahl und Ort. Darauf folgt das Datum. Es stellt eine Zusammenfassung des Inhaltes eines Briefes dar. Es steht eine Zeile nach der Anschrift. Als nächstes kommt der Betreff. Er steht sechs Zeilen nach der Anschrift und zwei Zeilen vor dem Text. Es soll auch darauf geachtet werden, dass nach dem Betreff kein Punkt kommt. Außerdem sollte er mit Fettdruck hervorgehoben werden. Als nächster Schritt wird die Anrede angeführt. Wie bereits darauf andeutend, steht die Anrede zwei Zeilen nach dem Bereff. Die Namen hier sollten mit ihren abgekürzten akademischen Titel verfasst werden, wie z.B. Dr. X . Im Weiteren erfolgt nach dem Text Gruß und Unterschrift. Es steht eine Zeile nach dem Text. Unter dem Gruß steht unmittelbar Vorname und Name, die Abteilung, die Firma und zwar ohne Klammern. Nach zwei Zeilen steht die Anlage, wo beigefügte Unterlagen angeführt werden. Dabei wird das Wort Anlage nicht geschrieben. Schließlich kommt das Postskriptum. Hier wird hinzugefügt, was im Text vergessen wurde. Allerdings könnte das Postskriptum eine Wiederholung enthalten.
In Anlehnung an Kast (1999)[2] wird zwischen Formellem und Informellem differenziert. Beim formellen oder offiziellen Brief sollten bestimmte Gestaltungs- und Formulierungsmuster eingehalten werden. Die formellen Briefe umfassen die Geschäftsbriefe, Bewerbungsschreiben, Kündigungsschreiben. Ein Bewerbungsschreiben könnte laut Lenk, H.E.H.[3] (2000, 167) mit Unterlagen wie der Lebenslauf beigefügt werden.
Analyse der Textsorte „Bewerbungsschreiben“
Im Folgenden geht es um die Analyse von ausgewählten Studententexten. Es handelt sich nämlich um die Textsorte Bewerbungsschreiben. Nachfolgend wird die Ontogenese der Schreibkompetenz zu dieser Textsorte bei den Studenten nachgezeichnet. Nun wird auf den Aufbau der Bewerbung eingegangen. Ein Blick auf die verfassten Texte lässt sich zeigen, dass diese den formalen Normen einer Bewerbung entsprechen. Was ins Auge springt ist, dass der Umfang von einem Text zu anderem unterschiedlich ist. Der Umfang der geschriebenen Texte lässt sich zwischen 6 und 16 Zeilen in ihrer originalen Länge betragen. Nun gilt es, die syntaktische Ebene diese Texte einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
Bei der Betrachtung der Texte fällt auf, dass die aufgeführten Beispiele auf ihre Länge hin unterschiedlich ausfallen. Wenn man die Wortanzahl pro Satz berechnet, so hat Beispiel 3 durchschnittlich die längste Anzahl von Wörtern pro Satz (14,33 Wörter pro Satz) und im Gegensatz dazu hat Beispiel 1 durchschnittlich die kürzeste Anzahl von Wörtern pro Satz (9,25 Wörter pro Satz).
Wenn man jeweils den ersten Satz der sechs Beispiele miteinander vergleicht, so geht hervor, dass die Länge der Sätze unterschiedlich ist. Während der erste Satz vom Probanden 1 und 2 lediglich 4 Wörter beinhaltet, ist der erste Satz des dritten Beispiels mit 12 Wörtern formuliert.
In der zweiten Phase haben sich folgende Werte ergeben.
Wenn man die Wortanzahl pro Satz berechnet, so hat Beispiel 2 durchschnittlich die längste Anzahl von Wörtern pro Satz (18,33Wörter pro Satz) und im Gegensatz dazu hat Beispiel 1 durchschnittlich die kürzeste Anzahl von Wörtern pro Satz (7,6 Wörter pro Satz). Wenn man jeweils den ersten Satz der sechs Beispiele miteinander vergleicht, so geht hervor, dass die Länge der Sätze ungleich ist. Während der erste Satz der Probanden 1 und 5 etwa 4 Wörter beinhalten, ist der zweite Satz des sechsten Beispiels mit 19 Wörtern formuliert.
Beim ersten Probanden in den beiden Texten und beim vierten Probanden im zweiten Text lässt sich ein abweichende Ordnung der Absenderadresse im Briefkopf feststellen. Allerdings bildet der erste Satz eine angemessene Eröffnung des Briefes.
Des Weiteren ist die Abschlussformel ist beim sechsten Probanden dagegen unüblich.
Bei den anderen Probanden ist sowohl die Eröffnungs- als auch die Abschlussfloskeln sind für die Textsorte angemessen.
Im Folgenden wird auf die Verwendung und Differenzierung von Hypotaxen bei den untersuchten schriftlichen Arbeiten eingegangen.
Es geht hervor, dass alle Probanden in ihre Texte weitestgehend auf hypotaktische Strukturen verzichtet haben. Man findet mehrheitlich einfache Sätze, die aneinandergereiht sind.
Nachfolgend wird die inhaltliche Kohärenz in diesen Texten gewidmet. Als erster Aspekt für die Kohärenz und Kohäsion gilt die Wiederaufnahme. Beim ersten Probanden erfolgt die Wiederaufnahme ausschließlich durch das Personalpronomen „ich“, das anaphorische Verweisrichtung in der 1. Person Singular hat. Es wird insgesamt 2 Mal aufgetaucht. Das zentrale Mittel der Wiederaufnahme im zweiten Text ist die Pronominalisierung durch Personalpronomen „ich“, das 2 Mal vorkommt und einmal in Form von „mir“. Zudem taucht ebenfalls einmal das Personalpronomen „Sie “ auf. Daneben treten auch einmal das Possessivpronomen „seine“ auf. Der zweite Proband referiert in seinem ersten Text ausschließlich mit Personalpronomen „ich“, das 2 Mal vorkommt. In zweiten Text greift er auf das Personalpronomen „ich“ in drei Fällen und das Possessivpronomen „Ihre“ in einem einzigen Fall zurück. Zur Herstellung der Wiederaufnahme bedient sich der dritte Proband der Pronominalisierung. In seinem ersten Text gebraucht er das Personalpronomen „ich“ in vier Fällen, die Possessivpronomen „mein“ in zwei Fällen und „ihr“ in zwei Fällen. Im zweiten Text kommen folgende Ponomen zum Einsatz: Drei Mal das Personalpronomen „ich“, das Possessivpronomen „ihre“, das zwei Mal auftaucht und „mein“, das ebenfalls einmal auftritt. Beim vierten Probanden erfolgt die Wiederaufnahme in seinem ersten Text durch das Personalpronomen „ich“ in zwei Fällen und „Ihnen“ in einem Fall. Dazu verwendet er ebenfalls das Possessivpronomen „Ihre“ in zwei Fällen. Im zweiten Text findet eine explizite Wiederaufnahme durch das Personalpronomen „ich“ in drei Fällen und das Possessivpronomen „meine“ in einem Fall und „Ihren“ in einem einzigen Fall statt. Sie haben nämlich eine anaphorische Verweisfunktion. Die Wiederaufnahme beim fünften Probanden im ersten Text erfolgt durch den Einsatz vom Personalpronomen „ich“ in zwei Fällen und das Possessivpronomen „meine“ in einem einzigen Fall. Im zweiten Text wird die Wiederaufnahme durch das Personalpronomen „ich“ geleistet, das insgesamt sechs Mal aufgetaucht hat. Zudem setzt er ein Possessivpronomen „meinen“ ein. Beim sechsten Probanden ist die Wiederaufnahme im ersten Text durch das Personalpronomen „ich“ in sieben Fällen und „Sie“ in drei Fällen sowie das Possessivpronomen „meine“ in zwei Fällen geleistet.
[...]
[1] Franck, Norbert. Schreiben wie ein Profi, Artikel, Berichte, Pressemeldungen, Protokolle, Referate und andere Texte. Bund-Verlag. Frankfurt am Main. 2005
[2] Kast, Bernd. Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt. Berlin.1999
[3] Lenk, H.E.H. Praktische Textsortenlehre. Ein Lehr- und Handbuch der professionellen Textgestaltung. Universitätsverlag. Helsinki. 2000
- Citation du texte
- Mohamed Chaabani (Auteur), 2012, Das Bewerbungsschreiben im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194235