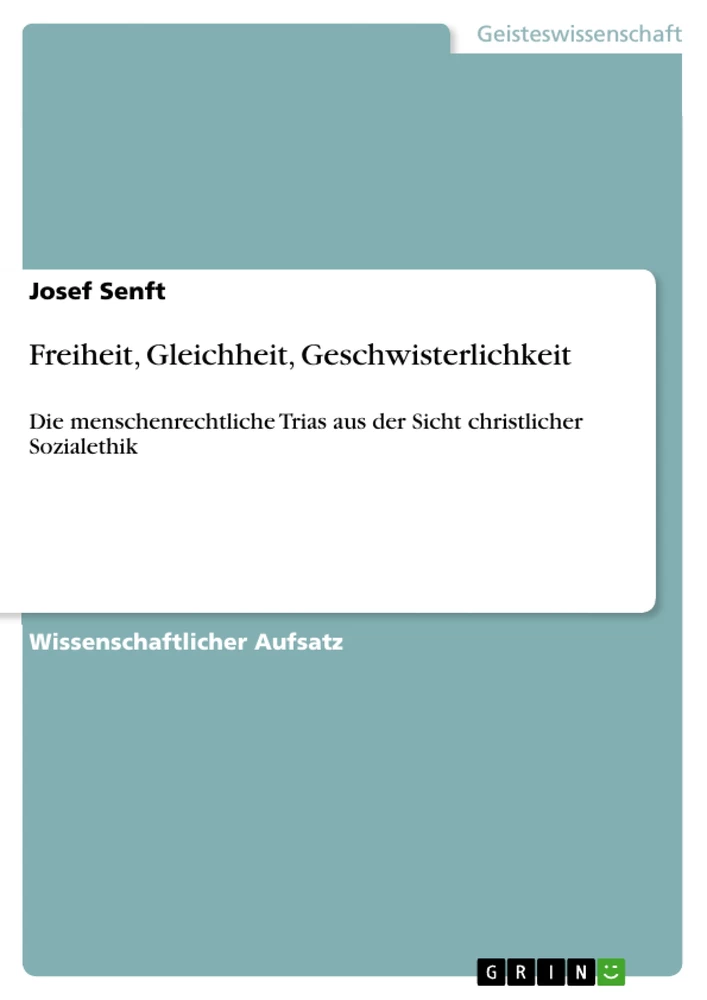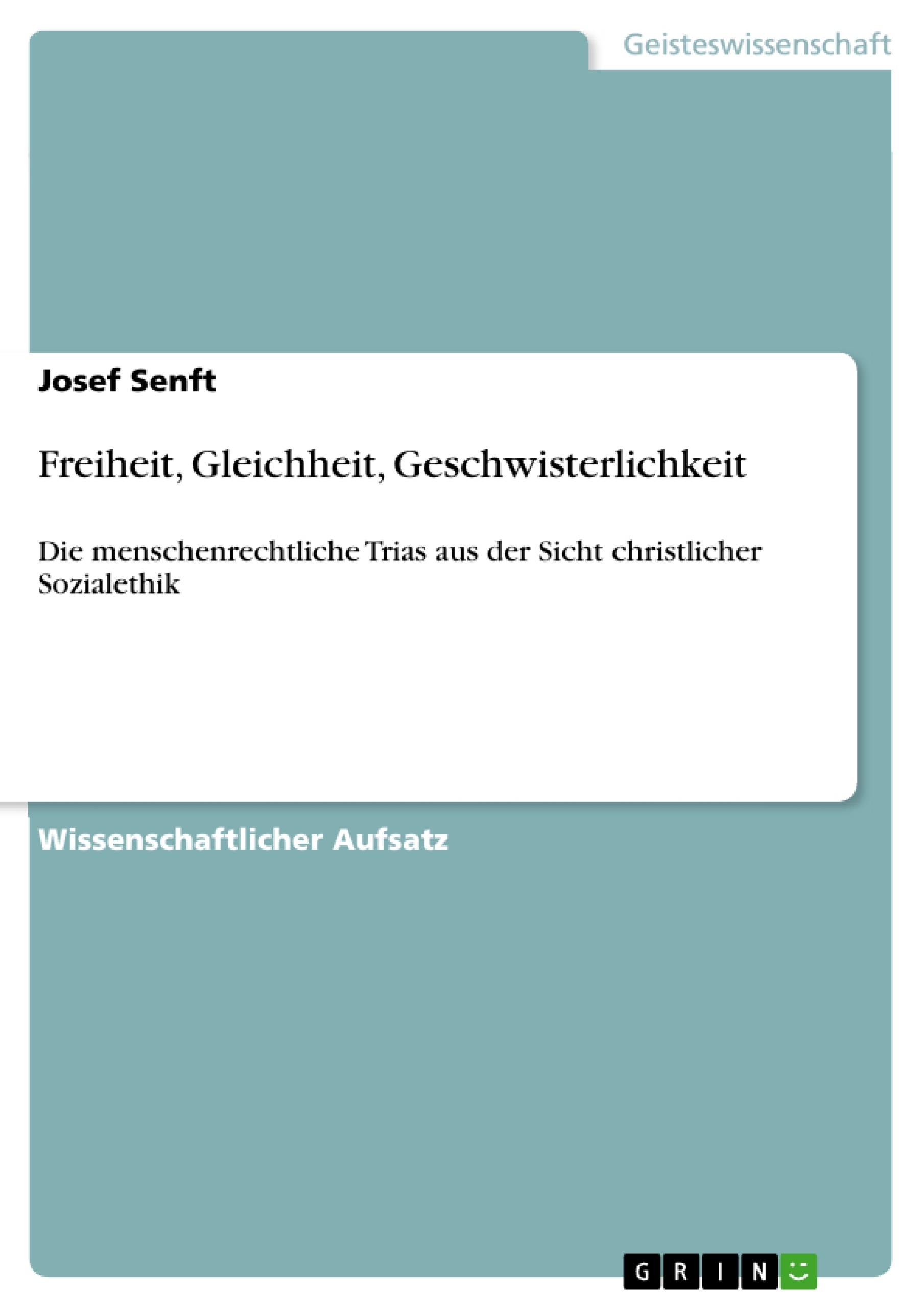Als menschenrechtliche Kurzformel hat die Trias "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" nach wie vor einen hohen Stellenwert. Seit der Gründung des Ökumenischen Rats der Kirchen und dem Zweiten Vatikanischen Konzil gilt das auch für die christlichen Kirchen. Kennzeichnend für die ökumenisch/katholische Rezeption der Menschenrechte ist vor allem, dass sie sich nicht einer einseitig-individualistischen Betrachtung anschloss, sondern auch nach den sozialen, ökonomischen und ökologischen Voraussetzungen fragte.
Josef Senft
Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit -
die menschenrechtliche Trias aus der Sicht christlicher Sozialethik
Die Ereignisse des Jahres 1789 bedeuten das Ende des ancien régime, der absolutistisch-feudalen Macht des Klerus und des Adels, und damit gleichzeitig den politisch-gesellschaftlichen Durchbruch der Ideen der Aufklärung und der Epoche der bürgerlichen Welt. Mit dieser Revolution wurde die politische Herrschaft nicht mehr wie bisher durch die Religion, sondern durch die Volkssouveränität legitimiert. Anders als bei den politischen Ereignissen, die in .England und in Amerika demokratische Reformen im Sinne einer Ausdehnung alter Privilegien auf breitere Bevölkerungsschichten errungen hatten, wurde in Frankreich der ganze Zweck des öffentlichen Handelns auf eine neue Grundlage gestellt, nämlich auf das Recht des freien Handelns eines jeden Menschen und damit auf das Subjekt, das in der bürgerlichen Gesellschaft seine Geschichte nun selber machen sollte.[1] Aus diesem Grunde wurden die Pariser Ereignisse von 1789 von den meisten idealistischen Philosophen jenseits der französischen Grenzen fasziniert betrachtet und z. T. enthusiastisch begrüßt. So war die Französische Revolution für Hegel das welthistorische Ereignis, in dem "der Mensch sich auf den Kopf, d.h. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut"[2]. Und Kant schrieb 1798: "Ein solches Phänomen vergißt sich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Vermögen in der menschlichen Natur zum Besseren aufgedeckt hat, dergleichen kein Politiker auf dem bisherigen Laufe der Dinge ausgeklügelt hätte"[3]. Für viele besteht die dichteste Zusammenfassung des Erbes der Französischen Revolution in der republikanischen Trias von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,[4] die auch als normative Grundlage der "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" gelten kann, welche die Nationalversammlung am 26. August 1789 beschloss. Die dort verbrieften Rechte, die trotz des den Nationalstaat konstituierenden Charakters der Revolution universal gelten sollten, stellen sich im einzelnen wie folgt dar:
Freiheit wird vor allem unter dem Aspekt des selbstbestimmten Zusammenwirkens des politischen Gemeinwesens und der einzelnen Glieder der Gesellschaft gesehen. Dabei dominierte als Reaktion auf den Absolutismus in der Französischen Revolution das negative Freiheitsverständnis, das in emanzipatorischer Absicht das Individuum gegen Übergriffe des Staates sichern sollte; exemplarisch wird dies an der Betonung des Rechts auf Eigentum deutlich. Andererseits gab es aber auch Elemente eines positiven Freiheitsverständnisses, das auf Übernahme von Mitverantwortung in politischen Prozessen zielte. Dieser partizipatorische Freiheitsbegriff, der eher in der angelsächsischen Tradition steht, gewann mit der Ausdehnung der Staatsintervention an Bedeutung, da dies zu einer stärkeren Teilnahme der Bürger am staatlichen Handeln zwang.
Gleichheit baut auf ähnlichen Voraussetzungen wie das Freiheitsprinzip auf, gab aber den demokratischen Bewegungen oft die nachdrücklichste Radikalität. Grundsätzlich geht es bei der Gleichheit im Demokratiezusammenhang, sowohl um gerechte Anteile im Verteilungsprozess, nämlich der Lasten und der Chancen, aber auch um gleiche politische Mitwirkungsrechte. Das Gleichheitsprinzip sollte also die Organe des demokratischen Gemeinwesens einerseits zur Gewährleistung der Gleichheit vor dem Gesetz verpflichten, was den Schutz von Minderheiten und Randgruppen, d. h. den Schutz vor den Nachteilen einer Gleichbehandlung einschließt; mit dem Gleichheitsprinzip wollte man andererseits aber auch dazu beitragen, eine ausgleichende materielle Gerechtigkeit anzustreben, durch welche die realen Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Freiheitsrechten einander angenähert werden.
Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit bzw. Solidarität stellt nach dem Freiburger Historiker Ernst Schulin die geistige Seite der Revolution dar, während das Freiheitsprinzip die politische und das Gleichheitsprinzip die soziale Seite jenes Umbruchs betrifft.[5] Brüderlichkeit bringt als demokratisches Postulat nach gerechter Teilhabe eine neue Qualität ins Spiel, auf die ein demokratisches Gemeinwesen nicht verzichten kann, nämlich eine unbeschadet aller Konflikte wechselseitige Zuwendung der Menschen, welche Verständigung und Eintreten füreinander möglich macht. Damit ist Solidarität gefordert; aber gerade nicht im Sinne jener harmonistischen "Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot"-Formel, sondern als eine gerechte Teilhabe, die durch den Zusammenschluss der Betroffenen "von unten" erkämpft werden muss, weil Solidarität in der Regel nicht "von oben" geschenkt wird.[6]
Ansprüche und Realitäten
Die Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, so z.B. zwischen den universal verkündeten Menschenrechten und dem aufkommenden Nationalismus oder zwischen dem rationalen Geist der Aufklärung und den Irrationalismen der Revolutionstribunale[7], hatten zahlreiche Ursachen, die hier nicht annähernd erörtert werden können. Ein wichtiger Faktor ist dabei aber sicher die Tatsache, dass die Französische Revolution ganz wesentlich eine bürgerliche Revolution war, d.h., dass sie zur Entstehung des Bürgertums mit allen damit verbundenen positiven und negativen Folgen geführt hat.[8] Die Ambivalenz in den realen Auswirkungen der Französischen Revolution und im Besonderen ihres bürgerlichen Charakters soll nun nachfolgend exemplarisch verdeutlicht werden.
[...]
[1] Vgl. A. Soboul: Kurze Geschichte der Französischen Revolution, Berlin 1977, 132 ff.
[2] G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Theorie-Werkausgabe Bd. 12, Frankfurt 1970, 535.
[3] I. Kant: Der Streit der Fakultäten, Werke VI, 361.
[4] Diese Trias wurde allerdings formell erst 1848 in die Verfassung Frankreichs aufgenommen. Vgl. J. Comby: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Grundsätze für eine Nation und für eine Kirche. In: Concilium 25 (1989) 13. Zwischen 1789 und 1799 wurden die Worte zwar immer wieder benutzt, aber nicht als strenge Formel; die Brüderlichkeit fehlte zuweilen. Heute wird Brüderlichkeit häufig durch den geschlechtsneutralen Begriff der Geschwisterlichkeit ersetzt. Oft wird auch in einem umfassenderen Sinne das Wort Solidarität eingesetzt.
[5] Vgl. E. Schulin: Die Französische Revolution, München 1988, 20.
[6] In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, dass der unmittelbare Ursprung der in die Revolutionsverfassung eingehenden „fraternité“ in den versprengten Gemeinschaften der französischen Hugenotten zu suchen ist. Vgl. F.-X. Kaufmann : Über die Brüderlichkeit. Rede eines demokratischen Hofnarren an ein bürgerliches Publikum. In: K. Rahner / B. Welte (Hg.): Mut zur Tugend. Über die Fähigkeit menschlicher zu leben, Freiburg i. Br. 1979, 68, Fußnote 1.
[7] Dazu stellt Roger de Weck fest: „Die Guillotine, der revolutionäre Terror, die gnadenlose Repression in den aufständischen Provinzen, die Greuel der Revolutionskriege, die plötzliche Verwandlung der Befreier in Besatzer, schließlich der napoleonische Despotismus – all dies enttäuschte die Hoffnungen und weckte den Zorn der Europäer, die nicht nur auf die Revolution, sondern auch auf das revolutionäre Frankreich gesetzt hatten.“ In: DIE ZEIT Nr. 8 vom 17.2.1989.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit - die menschenrechtliche Trias aus der Sicht christlicher Sozialethik"?
Der Text analysiert die Ideale der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (oder Geschwisterlichkeit) – aus der Perspektive der christlichen Sozialethik. Er untersucht die historischen Hintergründe, die Bedeutung dieser Prinzipien und die Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Was sind die drei Kernprinzipien, die aus der Französischen Revolution hervorgingen?
Die drei Kernprinzipien sind: Freiheit (Selbstbestimmung und Schutz vor staatlicher Übergriffigkeit), Gleichheit (gerechte Anteile und gleiche politische Mitwirkungsrechte) und Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit bzw. Solidarität (wechselseitige Zuwendung und Eintreten füreinander).
Wie wird Freiheit im Kontext des Textes definiert?
Freiheit wird sowohl negativ (als Schutz vor staatlicher Einmischung, insbesondere im Hinblick auf Eigentum) als auch positiv (als Möglichkeit zur Mitwirkung in politischen Prozessen) verstanden. Die Betonung liegt auf dem selbstbestimmten Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft.
Welche Aspekte der Gleichheit werden im Text hervorgehoben?
Der Text betont sowohl die Gleichheit vor dem Gesetz (einschließlich des Schutzes von Minderheiten) als auch die Notwendigkeit einer ausgleichenden materiellen Gerechtigkeit, um die Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Freiheitsrechten zu verbessern.
Was bedeutet Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit bzw. Solidarität in diesem Zusammenhang?
Brüderlichkeit (oft auch als Geschwisterlichkeit oder Solidarität bezeichnet) wird als die geistige Seite der Revolution betrachtet. Es geht um die wechselseitige Zuwendung der Menschen, die Verständigung und Eintreten füreinander ermöglicht. Solidarität wird als gerechte Teilhabe verstanden, die oft "von unten" erkämpft werden muss.
Welche Kritikpunkte werden an der Umsetzung der revolutionären Ideale geäußert?
Der Text weist auf die Diskrepanzen zwischen den universal verkündeten Menschenrechten und dem aufkommenden Nationalismus hin, sowie zwischen dem rationalen Geist der Aufklärung und den Irrationalismen der Revolutionszeit. Er betont, dass die Französische Revolution maßgeblich eine bürgerliche Revolution war, mit ambivalenten Folgen.
Warum wird die Französische Revolution als bürgerliche Revolution bezeichnet?
Weil sie zur Entstehung des Bürgertums geführt hat, mit all den positiven und negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Dies impliziert eine gewisse Ambivalenz in den tatsächlichen Auswirkungen der Revolution.
Wo liegen die Ursprünge der "fraternité" (Brüderlichkeit) der Revolutionsverfassung?
Der Text verweist auf die Gemeinschaften der französischen Hugenotten als möglichen Ursprung des Konzepts der "fraternité".
- Quote paper
- Josef Senft (Author), 2001, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194129