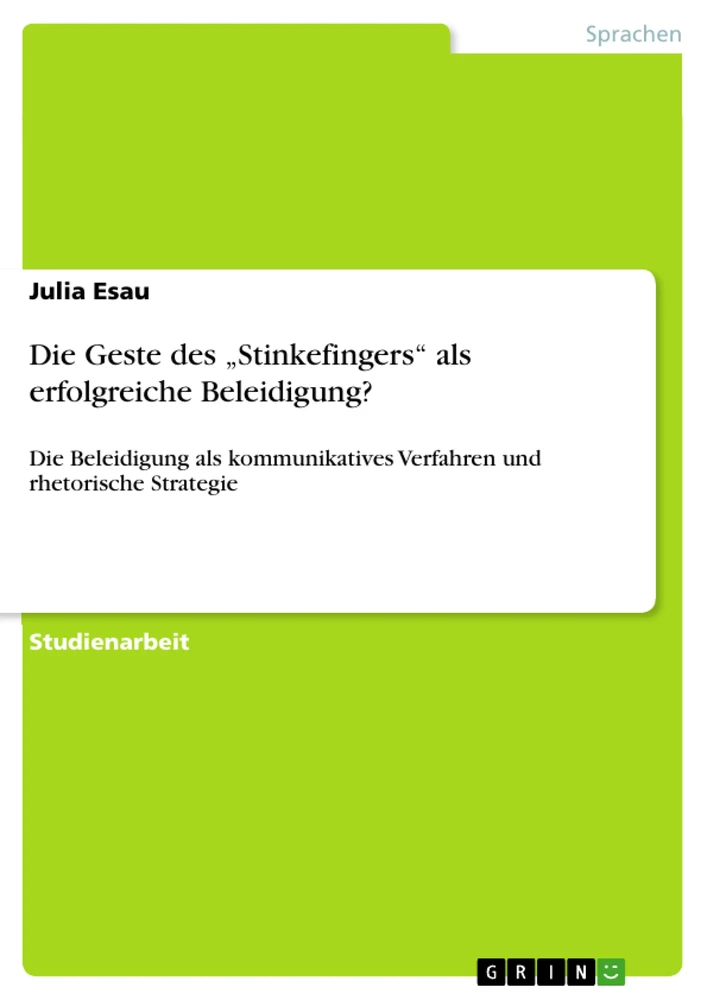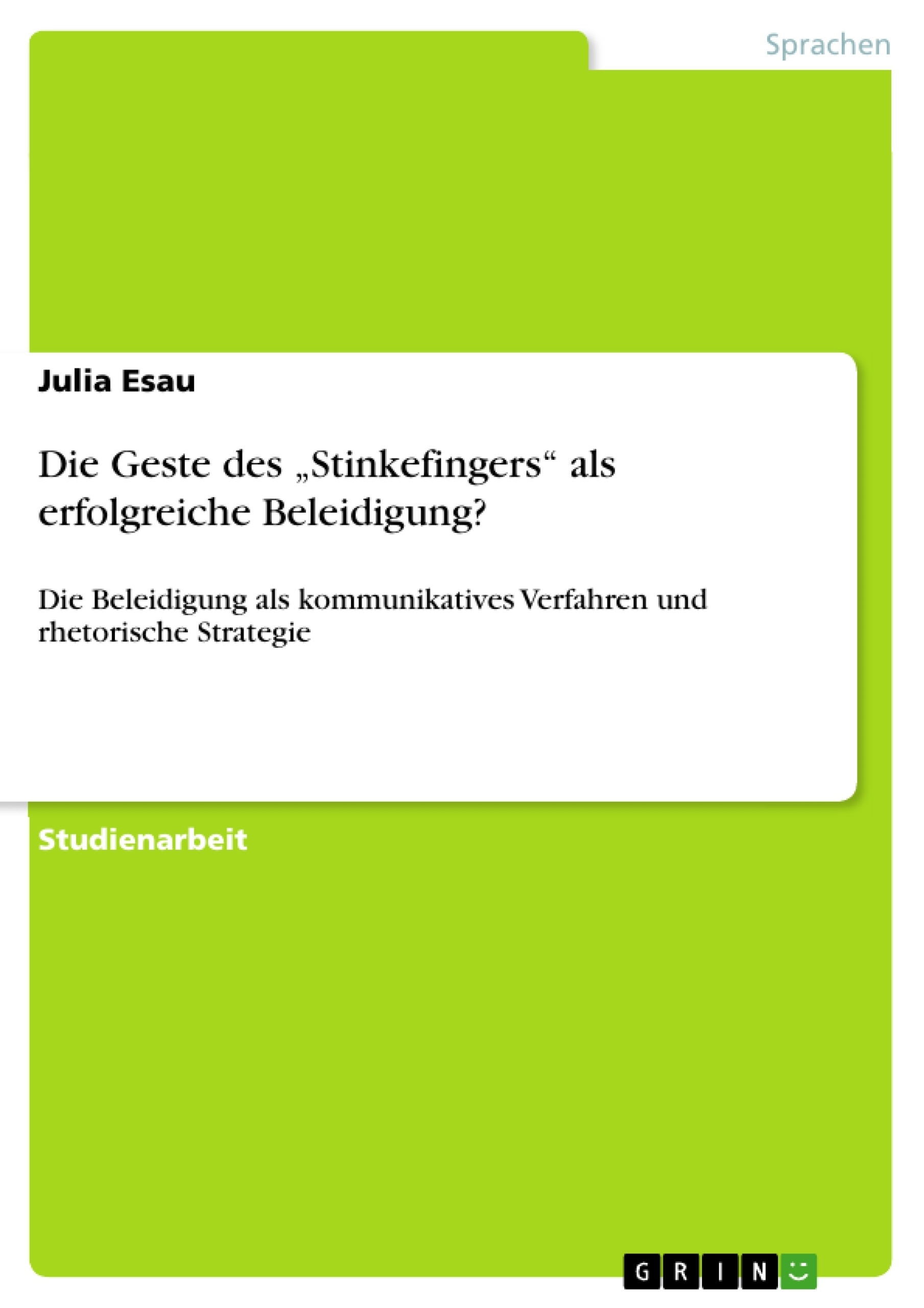I. Einleitung
Beleidigungen sind nicht nur in non-formalen, alltäglichen kommunikativen Verfahren vorzufinden, die emotional und aus dem Affekt erfolgen, sondern auch in der Rhetorik kann eine Beleidigung als strategisch überlegte Handlung eingesetzt werden.
Eine Beleidigung kann lautsprachlich und gebärdensprachlich ausgedrückt werden. Eine sehr präsente, allgemein verständliche Geste der Beleidigung ist das Zeigen des Mittel-fingers, auch umgangssprachlich als „Stinkefinger“ bezeichnet.
Bevor weiter in der Thema des „Stinkefingers“ eingegangen wird, sollte der Begriff der „Geste“ geklärt werden. In dieser Arbeit wird die Definition der „Geste“ aus dem Lexi-kon ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN übernommen:
„`Gebärde, Körperbewegung beim Sprechen` wird im 15. Jh. in der Wendung gesten machen `ausdrucksvolle Körperbewegungen machen` (von Gauklern und Spaßmachern) aus lat. gestus `Bewegung der Hände, Gebärde der Schauspieler oder Redner`, zu lat. gestere (gestum) `tragen, (aus)führen, (refl.) sich verhalten`, ins Dt. entlehnt. Daneben begegnet vielfach die lat. Form Gestus (auch mit lat. Flexion); erst im 18. Jh. Wird der Plur. Gesten, dann auch der Sing. Geste üblich.“
Somit kann man hier festlegen, dass der „Stinkefinger“ eine Geste ist, die die Eigen-schaft der Zeichenhaftigkeit besitzt. Das heißt, durch eine Geste soll etwas Bestimmtes ausgedrückt werden. Interessant bei der Geste des „Stinkefingers“ ist, dass diese nicht zwingend etwas Gesprochenes unterstreicht, sondern dass der „Stinkefinger“ als allein-stehende, „schweigende“ Geste für sich selbst spricht.
Die Geste des „Stinkefingers“ ist durchaus negativ belegt und wird als Beleidigung, Schmähung und Kränkung gedeutet. Doch nicht alle Beleidigungen, die als solche ge-sehen werden, sind in der Rhetorik erfolgreiche Strategien, die das Ziel der Beleidigung in einem kommunikativen Verfahren erreichen. Wann ist eine Beleidigung für Rhetori-ker erfolgreich und kann man den „Stinkefinger“ in einer Rede einsetzten, um zu belei-digen? Um dies zu beantworten muss die Bedeutung der Gestik für die Rhetorik unter-sucht werden und erläutert werden, wann eine Beleidigung rhetorisch erfolgreich ange-wandt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gestik und die Rolle des Mittelfingers
- II.1. Quintilian
- II.2. Kalverkämper
- III. Warum der Mittelfinger „stinkt“
- IV. Die Beleidigung als erfolgreiche rhetorische Strategie
- V. Erfolg oder Misserfolg durch die Verwendung des „Stinkefingers“
- VI. Beispiel: Frank Bsirske
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Geste des Mittelfingers, auch „Stinkefinger“ genannt, als kommunikatives Verfahren und rhetorische Strategie. Sie befasst sich mit der Frage, ob und wie diese Geste als erfolgreiche Beleidigung im Rahmen rhetorischer Strategien eingesetzt werden kann.
- Die Rolle des Mittelfingers in der Geschichte der Rhetorik
- Die Bedeutung von Gestik in der Kommunikation
- Die Funktion der Beleidigung als rhetorisches Mittel
- Die Auswirkungen der Verwendung des „Stinkefingers“ auf die kommunikative Situation
- Beispiele für den Einsatz des „Stinkefingers“ in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Beleidigung als kommunikatives Verfahren und rhetorische Strategie vor, wobei der Fokus auf die Geste des „Stinkefingers“ gelegt wird. Der Begriff „Geste“ wird definiert und der „Stinkefinger“ als eine Geste mit Zeichenhaftigkeit eingeführt.
- II. Gestik und die Rolle des Mittelfingers: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Mittelfingers in rhetorischen Vorträgen. Es werden die Ansichten von Quintilian und Kalverkämper zur Rolle von Gestik in der Kommunikation vorgestellt. Quintilian betont die Bedeutung von Gesten zur Unterstreichung des Gesprochenen, während Kalverkämper die kommunikative Absicht jeder Körpersprache hervorhebt.
- III. Warum der Mittelfinger „stinkt“: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der negativen Konnotation des „Stinkefingers“ als Beleidigung und Schmähung. Es wird diskutiert, ob und wie die Geste in der Rhetorik als erfolgreiche Strategie eingesetzt werden kann.
- IV. Die Beleidigung als erfolgreiche rhetorische Strategie: Der Abschnitt beleuchtet die Funktion der Beleidigung als rhetorisches Mittel und analysiert deren potentiellen Erfolg in der Kommunikation. Es werden Bedingungen und Faktoren betrachtet, die eine erfolgreiche Beleidigung ausmachen.
- V. Erfolg oder Misserfolg durch die Verwendung des „Stinkefingers“: Dieser Abschnitt analysiert die Effektivität des „Stinkefingers“ als Beleidigung und untersucht die verschiedenen Reaktionen, die diese Geste auslösen kann. Es werden Faktoren beleuchtet, die den Erfolg oder Misserfolg der Geste in unterschiedlichen Situationen beeinflussen.
- VI. Beispiel: Frank Bsirske: Der Abschnitt präsentiert ein praktisches Beispiel für den Einsatz des „Stinkefingers“ in der Kommunikation. Es wird untersucht, wie die Geste in diesem konkreten Fall verwendet wurde und welche Auswirkungen sie hatte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Beleidigung, Gestik, Rhetorik, Kommunikationsstrategie, Mittelfinger, „Stinkefinger“, Zeichenhaftigkeit, nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Erfolg, Misserfolg, kommunikative Situation.
- Quote paper
- Julia Esau (Author), 2011, Die Geste des „Stinkefingers“ als erfolgreiche Beleidigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194057