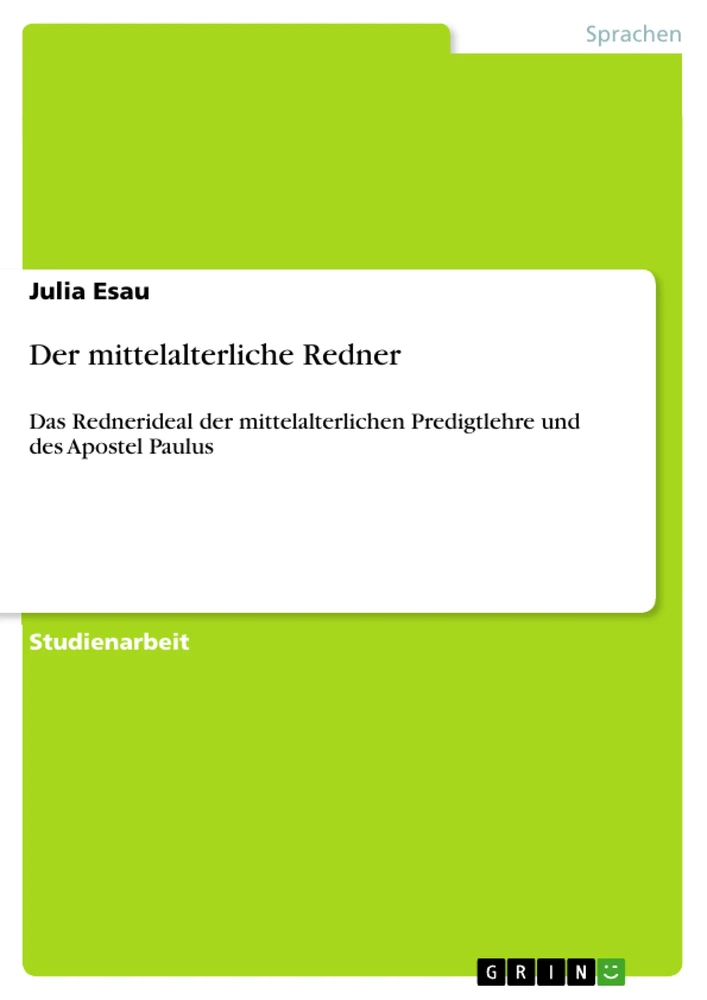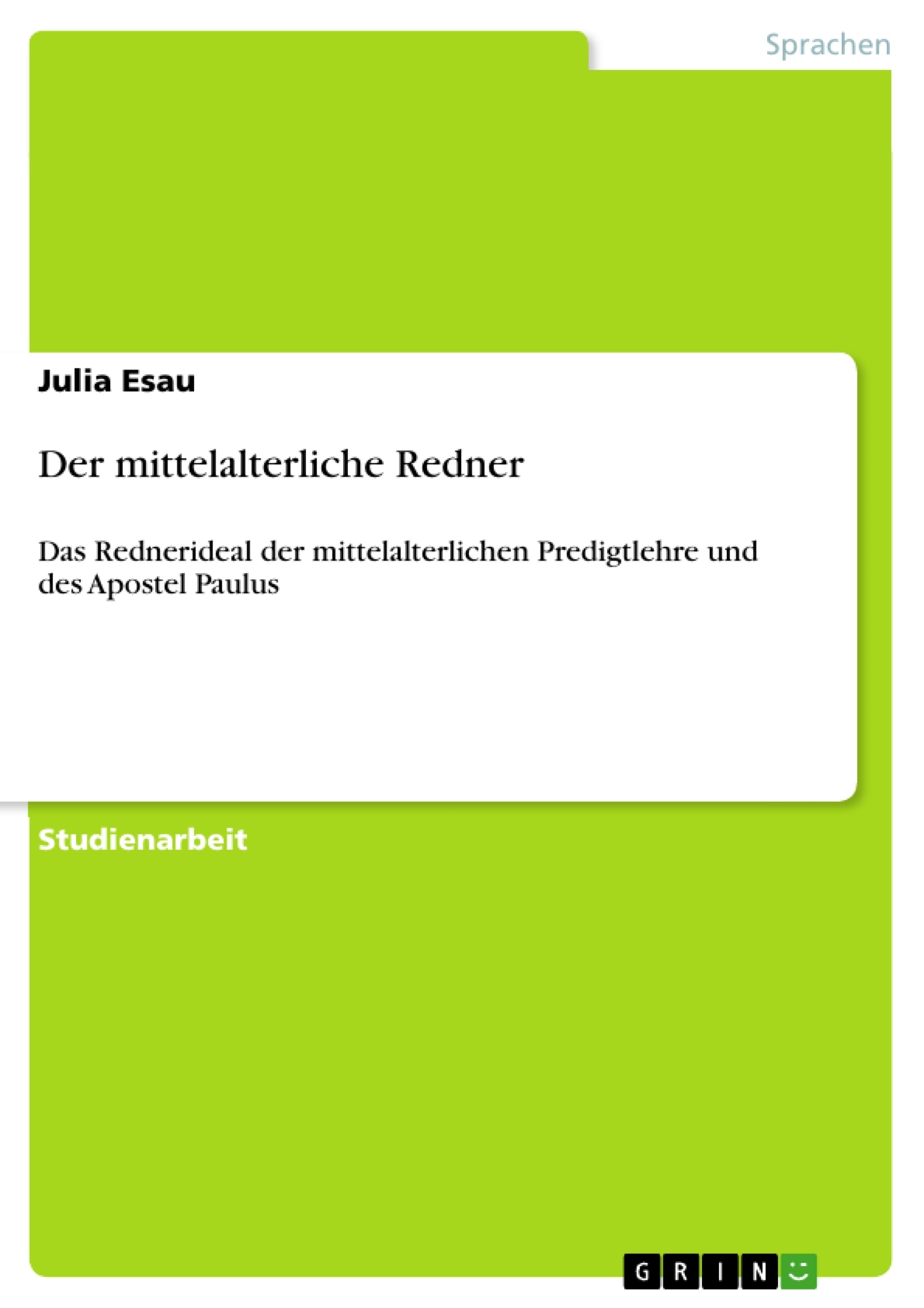I. Einleitung
Bevor der Redner im Mittelalter analysiert wird, muss der Begriff des Mit-telalters geklärt werden: „Als europäisches M. bezeichnet man seit dem Renaissance-Humanismus die mehr als tausend Jahre umfassende Epoche zwischen Antike und Früher Neuzeit.“
Der mittelalterliche Redner tritt vor allem in der Rolle des Predigers auf, deshalb wird er im Folgenden im Zusammenhang der „Kunst des Predigens“ – der ars praedicandi – betrachtet. Mittelalterliche Predigten „repräsentieren, was ihre Bedeutung, Überlieferungsdichte und Qualität angeht, den wichtigsten Redenbreich im Mittelalter“. In der Zeit nach Jesu Christi Wirken auf der Erde bis zum Mittelalter, waren für die Gemeinden und Kirchen viele andere Themen relevant, jedoch nicht die (Predigt-) Rhetorik. James J. Murphy schreibt hierzu: „[…] the Church did indeed debate its most pressing issues, it can only be concluded that preaching theory was not regarded as a key issue.“ Erst im 4. und 5. Jahrhundert wurden, durch das Lehren und Lernen der Heiden („pagan learning”), Kirchenmitglieder („churchmen“) in ernsthafte Erkundigungen über das Predigen involviert und mussten sich mit diesem Thema beschäftigen.
Wie die Rhetorik, so hat auch das Rednerideal, sich von der Antike bis zum Mittelalter weiter entwickelt. So muss bei Aristoteles der perfekte Redner ein „>guter< Techniker“ sein, Cicero verlang ein „unerreichbares Vorbild“, den „orator perfectus“, der „Technikbeherr-schung und Bildungserwerb“ anstrebt und Quintilian „ist wesentlich von Cicero beeinflusst worden“. Es soll im Folgenden herausgearbeitet werden, welche Idealvorstellungen des Redners es in der mittelalterlichen Predigtlehre gab, und ob (und in welchen Punkten) dieses Rednerideal mit dem Ideal übereinstimmt, das der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus an Gemeindeleiter und Diakone stellt.
Ein wichtiger Vertreter der christlichen Beredsamkeit in der christlichen Spätantike ist Aurelius Augustinus (*354, †430) mit seinem Werk >De doctrina Christiana< – >Die christliche Bildung<. Er stellt hier die Bered-samkeit (Rhetorik) und den Nutzen für die Christen gegenüber. Ein Brief, verfasst von Robert von Basevorn (*unbekannt, †14. Jhd.), ist sozusagen das Paradebeispiel für das Rednerideal des Hochmittelalters. Anhand des ersten Briefes an Timotheus von Apostel Paulus kann das Ideal eines Predigers der frühchristlichen Antike, aber auch ein bis jetzt anhaltendes Ideal in vielen Kirchen, herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die ars praedicandi
- III. Rednerideal bei Aurelius Augustinus
- IV. Rednerideal bei Robert von Basevorn
- V. Rednerideal bei Apostel Paulus
- VI. Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Rednerideal im Mittelalter, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Predigers und die Entwicklung der „ars praedicandi“. Die Arbeit analysiert das Rednerideal in der mittelalterlichen Predigtlehre und vergleicht es mit dem Ideal, das der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus formuliert.
- Die Entwicklung des Rednerideals von der Antike bis zum Mittelalter
- Die Rolle der Predigt im Mittelalter
- Die „ars praedicandi“ und ihre Entwicklung
- Das Rednerideal in der Predigtlehre Aurelius Augustinus
- Das Rednerideal im ersten Brief an Timotheus des Apostel Paulus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des mittelalterlichen Redners dar und erläutert die Bedeutung der Predigt als zentrale Form des rhetorischen Handelns im Mittelalter. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der „ars praedicandi“ und ihre Verbindung zur antiken Rhetorik. Im weiteren Verlauf werden die Rednerideale von Aurelius Augustinus und Robert von Basevorn untersucht, die Einblicke in die verschiedenen Strömungen der mittelalterlichen Predigtlehre geben.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Rhetorik, ars praedicandi, Predigtlehre, Rednerideal, Aurelius Augustinus, Robert von Basevorn, Apostel Paulus, erster Brief an Timotheus, christliche Beredsamkeit.
- Quote paper
- Julia Esau (Author), 2012, Der mittelalterliche Redner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194047