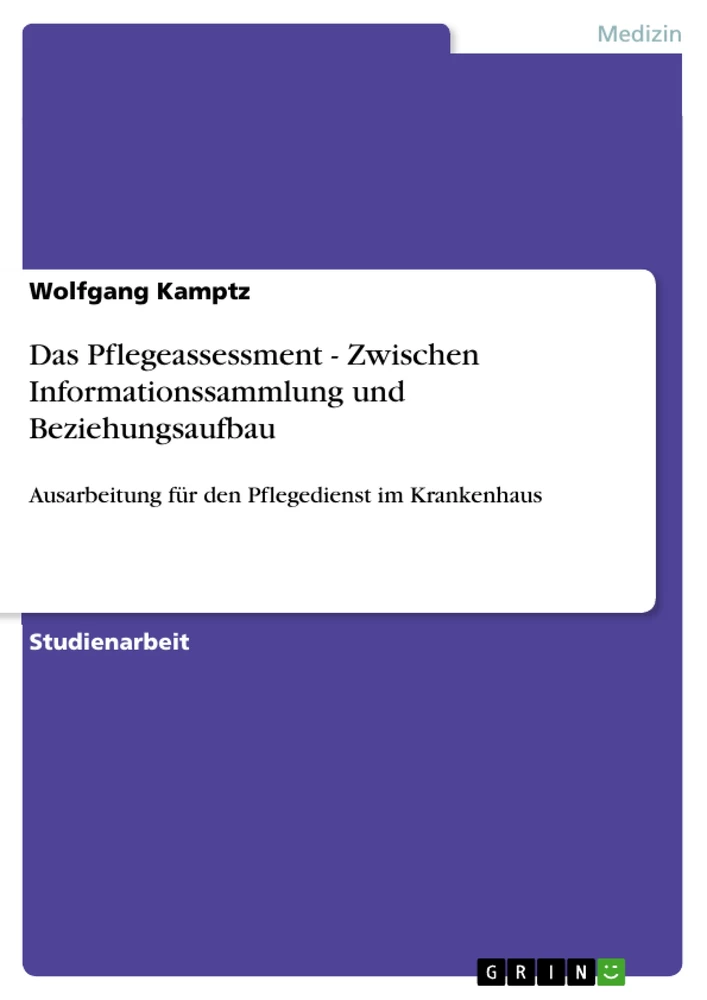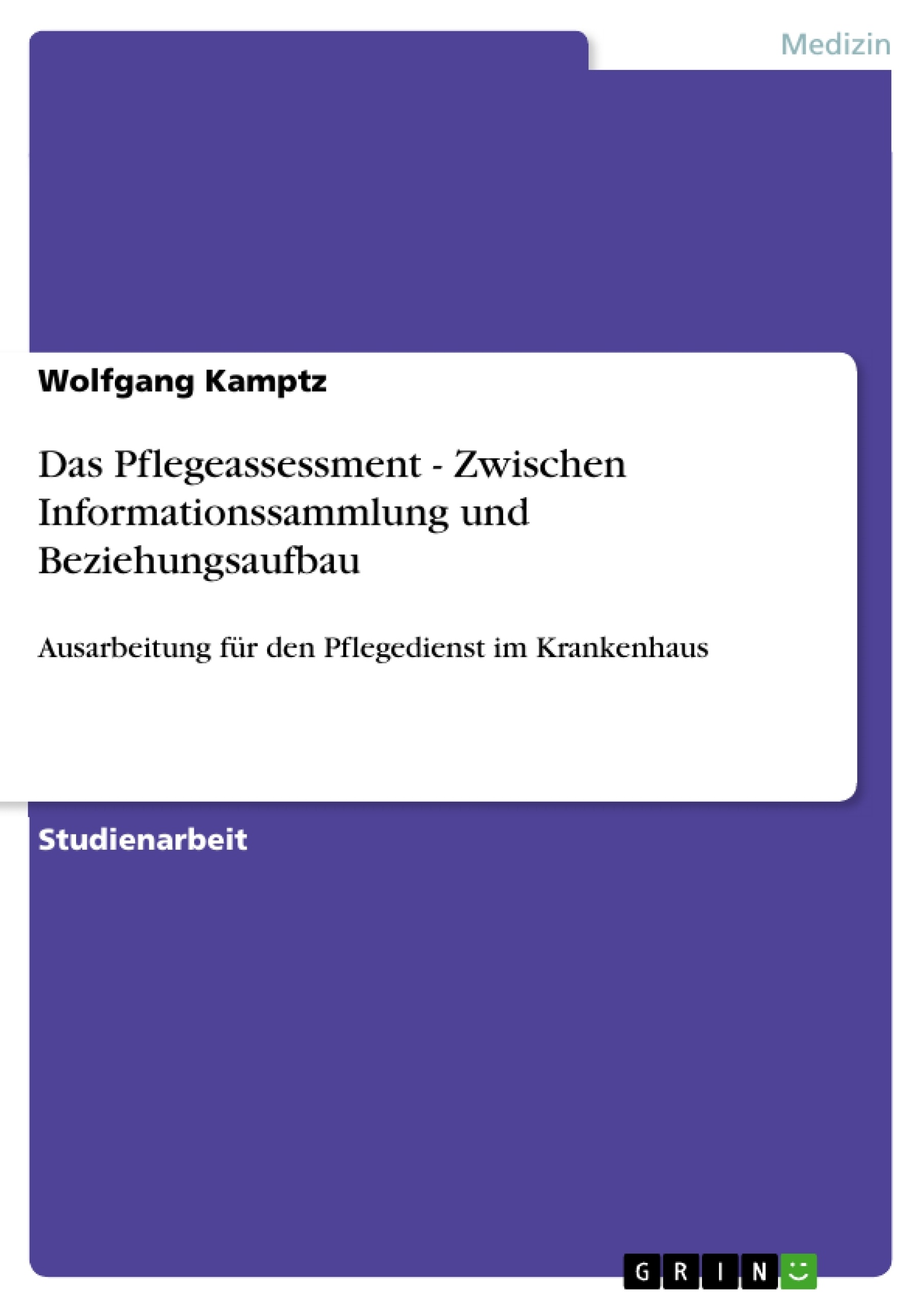Im Alltag ist Kommunikation ein selbstverständliches Geschehen und ist meistens vom Verlauf her unproblematisch. Die Entwicklung von kommunikativen Vorgängen wird schon in der ersten menschlichen Entwicklungsphase erlernt, ohne dass diese jedoch bewusst wird. Kommunikation ist für den Menschen lebensnotwendig.
Ein dramatisches Experiment, welches Friedrich II. von Hohenstaufen veranlasste, lieferte Informationen darüber, dass Säuglinge zum Überleben nicht nur Nahrung und Sauberkeit brauchen, sondern auch die menschliche Zuwendung. Die alle im Experiment beteiligten Kinder sind innerhalb eines Jahres verstorben, obwohl sie körperlich gesund waren. (Vgl. Menche et al. 2001, S. 75)
Ein Mensch, der sich „unverstanden“ fühlt oder dem nicht richtig „zugehört“ wird, kann Enttäuschungsgefühle entwickeln, oder auch negative körperliche Reaktionen, wie Zorn und Wut. Für einen Menschen, der für die Erfüllung seiner Bedürfnisse auf andere Personen angewiesen ist, für den ist es wichtig sich verstanden und erhört zu fühlen. So resultiert sich der Bedarf an Kommunikation um die sinnvolle Pflege zu ermöglichen. Aber andererseits, kann die pflegerische Handlung misslingen, wenn mit dem Patienten nicht situationsgerecht kommuniziert wird.
Wie jede andere Tätigkeit, so auch die Kommunikation, benötigt diese Kompetenz „... als Schlüsselelement der Pflege ..., die gelernt und eingeübt werden muss.“ (Juchli 1994, S. 436)
Um dies zu bewältigen werden nicht nur gute organisatorische Fähigkeiten benötigt, sondern auch theoretische Kenntnisse. Schon während der Ausbildung sollte ein relatives Gleichgewicht zwischen funktioneller Kompetenz, z. B. Körperpflege und medizinische Kenntnisse, und der kommunikativen Kompetenz, z. B. theoretisches Wissen über das kommunikative Verhalten, verschiedene Gesprächsstrategien und deren Anwendungsmöglichkeiten, hergestellt werden.
Kommunikative Kompetenz braucht auch Praxis. Evaluation von pflegetheoretischem Ansatz im Pflegeprozess ist ein sehr wichtiger Schritt. Dieser ist sehr komplex, weil hier auch der Pflegende mit sich selbst arbeiten muss, das heißt, seine Schwächen und seine Stärken im kommunikativen Handeln reflektieren kann. Werden hier Fragen nach der eigenen beruflichen Identität gestellt, wird hierbei auch der Sinn nach der aktiv ethischen Pflege gesucht.
Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich einen schmalen Pfad finden, der mich in sinnvolle Pflege führen kann, wo das menschliche Leben im Fokus der Pflege steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Sprache in der Pflege
- 2.1 Sprache und Kommunikation in der Krankenpflegeausbildung
- 2.2 Sprache und Kommunikation der Pflegenden als wissenschaftliches Forschungsobjekt
- 3.0 Das pflegerische Erstgespräch als Bestandteil des Pflegeprozesses
- 4.0 Begriffsdefinition und Differenzierung
- 5.0 Signifikante Ziele und Inhalte der Pflegeanamnese
- 5.1 Pflegerelevante Ziele/Inhalte in der Pflegeanamnese
- 5.2 Anamneserelevanz für Patient
- 6.0 Charakter der Pflegeanamnese
- 7.0 Gesprächsstruktur
- 7.1 Vorbereitung
- 7.2 Durchführung
- 7.2.1 Einführung
- 7.2.2 Hauptteil
- 7.2.3 Schluss/Verabschiedung
- 8.0 Kommunikationsform zur Erhebung der Pflegeanamnese
- 8.1 Verbale Kommunikation
- 8.1.1 Fragetechniken
- 8.1.2 Dialog oder Interview?
- 8.2 Nonverbale Kommunikation
- 8.1 Verbale Kommunikation
- 9.0 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Kommunikation im Pflegeprozess, insbesondere im Kontext des Aufnahmegesprächs. Sie beleuchtet den Spagat zwischen effizienter Informationsgewinnung und dem Aufbau einer patientenorientierten Beziehung. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung kommunikativer Kompetenz in der Pflege.
- Kommunikation als pflegerisches Instrument
- Der Patient als kommunikatives Subjekt
- Die Bedeutung der Pflegeanamnese
- Verbale und nonverbale Kommunikation in der Pflege
- Die Rolle der Kommunikation in der Ausbildung von Pflegekräften
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der patientenorientierten Kommunikation im Pflegeprozess ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Wie kann ein Gleichgewicht zwischen effizienter Informationsgewinnung und dem Aufbau einer patientenorientierten Beziehung gefunden werden? Sie verweist auf die Notwendigkeit von kommunikativer Kompetenz in der Pflege und illustriert deren Bedeutung anhand eines historischen Beispiels, welches die Wichtigkeit menschlicher Zuwendung neben der medizinischen Versorgung aufzeigt.
2.0 Sprache in der Pflege: Dieses Kapitel betont die Relevanz von Sprache als pflegerisches Handlungsinstrument. Es beleuchtet die Bedeutung der Pflegedokumentation, die zunehmende Technisierung im Gesundheitswesen und die Entwicklung des Pflegeberufs als eigenständigen Beruf in Deutschland. Die Notwendigkeit einer verbesserten sprachlichen Ausbildung von Pflegekräften wird hervorgehoben.
3.0 Das pflegerische Erstgespräch als Bestandteil des Pflegeprozesses: Dieses Kapitel beschreibt die Wichtigkeit des pflegerischen Erstgesprächs als ersten Schritt im Pflegeprozess. Es unterstreicht, dass der Fokus sowohl auf der professionellen Erhebung von notwendigen Informationen als auch auf dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Patienten liegen sollte. Die Herausforderung, beides gleichzeitig zu erreichen, wird im Kontext dieser Kapitel detailliert ausgeführt.
4.0 Begriffsdefinition und Differenzierung: Das Kapitel klärt zentrale Begriffe und Konzepte, um eine fundierte Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Es differenziert zwischen verschiedenen Aspekten der Kommunikation und des Pflegeprozesses, um Missverständnisse zu vermeiden und die Argumentation zu schärfen. Diese Klärung der zentralen Fachbegriffe ermöglicht es, die weiteren Ausführungen präzise zu gestalten.
5.0 Signifikante Ziele und Inhalte der Pflegeanamnese: In diesem Kapitel werden die wichtigen Ziele und Inhalte einer Pflegeanamnese detailliert erläutert. Der Fokus liegt darauf, wie die Anamnese dazu beiträgt, die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Patienten zu erkennen und die Pflegeplanung entsprechend anzupassen. Die Bedeutung einer ganzheitlichen Sichtweise auf den Patienten wird in diesem Kapitel hervorgehoben.
6.0 Charakter der Pflegeanamnese: Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften und den Charakter einer guten Pflegeanamnese, indem es wesentliche Bestandteile, Methoden und Vorgehensweisen im Detail behandelt. Hierbei wird erläutert, wie die Anamnese die Grundlage für eine individuelle und patientenorientierte Pflegeplanung bildet.
7.0 Gesprächsstruktur: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur eines effektiven Gesprächs zur Erhebung der Pflegeanamnese. Es gliedert den Prozess in Vorbereitung, Durchführung (mit Unterteilung in Einführung, Hauptteil und Schluss) und gibt konkrete Tipps und Hinweise für die praktische Umsetzung in der Pflegepraxis. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer strukturierten Vorgehensweise, um eine effiziente und zielgerichtete Informationsgewinnung zu gewährleisten.
8.0 Kommunikationsform zur Erhebung der Pflegeanamnese: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Kommunikationsformen, die bei der Erhebung der Pflegeanamnese zum Einsatz kommen. Es wird zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation unterschieden und die Bedeutung beider Aspekte für ein erfolgreiches Gespräch verdeutlicht. Konkrete Beispiele, wie Fragetechniken und die Wahl der richtigen Gesprächsstrategie, werden präsentiert.
Schlüsselwörter
Pflegeanamnese, Kommunikation, Patientenorientierung, Pflegeprozess, Gesprächsführung, Verbale Kommunikation, Nonverbale Kommunikation, Kommunikative Kompetenz, Pflegedokumentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Sprache in der Pflege: Die Pflegeanamnese als kommunikativer Prozess"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Kommunikation im Pflegeprozess, insbesondere im Aufnahmegespräch. Sie beleuchtet den Umgang mit der effizienten Informationsgewinnung und dem gleichzeitigen Aufbau einer patientenorientierten Beziehung. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung kommunikativer Kompetenz in der Pflege.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen: Kommunikation als pflegerisches Instrument, den Patienten als kommunikatives Subjekt, die Bedeutung der Pflegeanamnese, verbale und nonverbale Kommunikation in der Pflege, und die Rolle der Kommunikation in der Ausbildung von Pflegekräften. Sie umfasst die Strukturierung eines Erstgesprächs, die Erläuterung wichtiger Begriffe und die Analyse verschiedener Kommunikationsformen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Resümee. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der Sprache in der Pflege, dem pflegerischen Erstgespräch, Begriffsdefinitionen, den Zielen und Inhalten der Pflegeanamnese, dem Charakter der Pflegeanamnese, der Gesprächsstruktur (Vorbereitung, Durchführung, Schluss), und den Kommunikationsformen (verbal und nonverbal) zur Erhebung der Pflegeanamnese.
Was ist das Ziel der Pflegeanamnese?
Die Pflegeanamnese dient dazu, die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Patienten zu erkennen und die Pflegeplanung entsprechend anzupassen. Sie soll eine ganzheitliche Sichtweise auf den Patienten ermöglichen und bildet die Grundlage für eine individuelle und patientenorientierte Pflegeplanung.
Welche Kommunikationsformen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl verbale als auch nonverbale Kommunikationsformen. Bei der verbalen Kommunikation werden Fragetechniken und die Wahl zwischen Dialog und Interview beleuchtet. Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation wird ebenfalls hervorgehoben.
Wie wird die Gesprächsführung im Rahmen der Pflegeanamnese beschrieben?
Die Gesprächsführung wird strukturiert in Vorbereitung, Durchführung (mit Unterteilung in Einführung, Hauptteil und Schluss) und Verabschiedung beschrieben. Es werden konkrete Tipps und Hinweise für die praktische Umsetzung in der Pflegepraxis gegeben. Eine strukturierte Vorgehensweise zur effizienten und zielgerichteten Informationsgewinnung wird betont.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für diese Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Pflegeanamnese, Kommunikation, Patientenorientierung, Pflegeprozess, Gesprächsführung, Verbale Kommunikation, Nonverbale Kommunikation, Kommunikative Kompetenz, und Pflegedokumentation.
Wie wird die Bedeutung der Sprache im Pflegeberuf hervorgehoben?
Die Arbeit betont die Relevanz von Sprache als pflegerisches Handlungsinstrument und die Bedeutung der Pflegedokumentation. Sie beleuchtet die zunehmende Technisierung im Gesundheitswesen und die Entwicklung des Pflegeberufs als eigenständigen Beruf. Die Notwendigkeit einer verbesserten sprachlichen Ausbildung von Pflegekräften wird hervorgehoben.
Welche Herausforderungen werden im Kontext des pflegerischen Erstgesprächs besprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderung, im pflegerischen Erstgespräch ein Gleichgewicht zwischen professioneller Informationsgewinnung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Patienten zu finden. Beide Aspekte sind gleichermaßen wichtig.
- Quote paper
- Dipl.-Pflegewirt Wolfgang Kamptz (Author), 2010, Das Pflegeassessment - Zwischen Informationssammlung und Beziehungsaufbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193762