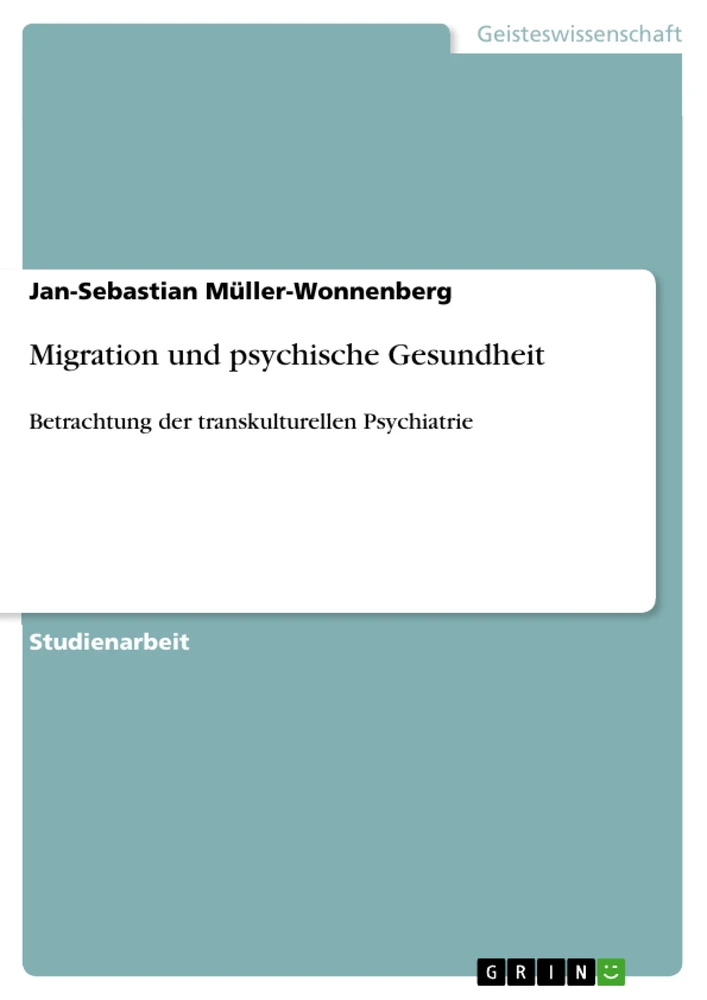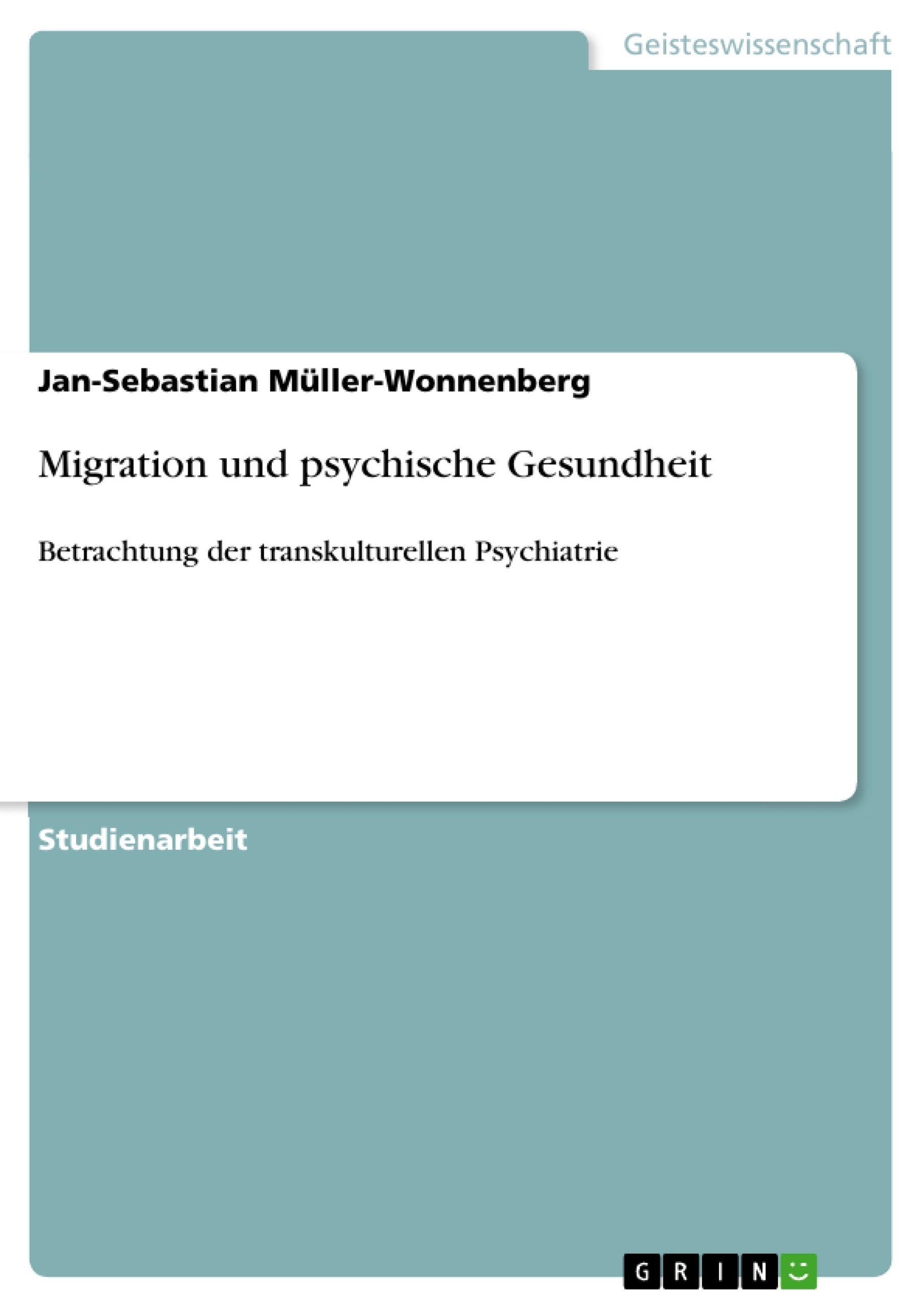Migration stellt Menschen vor schwerwiegende Probleme. Sie verlassen ihre angestammte Umgebung, lassen damit meist die Menschen zurück die ebengleiche Sprache sprechen wie sie und die die Kultur teilen mit denen sie aufgewachsen sind. Familien werden auseinander gerissen und es fällt allen beteiligten schwer damit zu leben. Dennoch wagen viele Menschen diesen entschiedenen Schritt oder sind aufgrund ökonomischer Gegebenheiten dazu gezwungen, meist in der Hoffnung ein besseres Leben führen zu können. Oder es sind Gründe ethnischer oder religiöser Natur die man hier als Exempel anführen könnte. Auch wenn die Gründe mannigfaltig, oft unergründbar oder offensichtlich sind, hat der Mensch schon immer dieses Wagnis eingegangen – auch unter dem Akzeptieren der Konsequenzen. Ohne in der Einleitung wissenschaftliche Studien anführen zu wollen, scheint es vielen Gelehrten als gesichert, dass der unterschiedliche Phänotyp der Menschen dadurch begründet liegt. Der Körper passte sich genetisch an die neue Umgebung an, über Jahrmillionen der Evolution. Doch der Mensch hat nicht so viel Zeit und muss sich veränderten Bedingungen – wie hier eine fremde Kultur – schneller anpassen zw. Sich möglichst sozialkonform adaptieren, ohne sich komplett zu assimilieren. Diese Arbeit will dem Phänomen der Migration unter Betrachtung der mit ihr auftretenden psychischen Erkrankungen eingehen. In den seltensten Fällen verläuft dies nämlich reibungslos in der ersten Generation der Migrierten. Zu Beginn ist es die Intention des Autors wichtige Begrifflichkeiten zu definieren – sich berufend auf einschlägige Fachliteratur. Es folgt daraufhin ein Beispiel von Migranten aus der ‚Gemeinschaft unabhängiger Staaten‘ – im weiteren Verlauf dieser Abhandlung GUS genannt – die hauptsächlich zur ehemaligen ‚Sowjetunion‘ (UdSSR) gehörten. Dieses Beispiel soll gegebenenfalls der expliziteren Erklärung dienen und Anschaulichkeit üben. Dann soll der Zusammenhang zwischen Migration und psychischer Erkrankung hergestellt werden. Besonderen Augenmerk soll dann – und im Zusammenhang – auf die transkulturelle Psychiatrie gerichtet werden. Ihre Relevanz soll deutlich werden. Ausgehend hiervon wird in dieser Arbeit besonderen Wert auf ‚Kulturelle Aspekte‘ der Diagnostik gelegt. Der Autor möchte nicht zwingend Missstände aufdecken, doch scheint eine Betrachtung der Komplikationen wichtig. Auch ist dem Autor – als letztem Punkt – die Rolle der Sozialen Arbeit ein wichtiges Anliegen dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Migration
- 2.2 Kultur
- 2.3 Seelische Krankheit & Gesundheit
- 2.4 Psychische Erkrankungen (Auswahl)
- 2.4.1 Psychogene Störungen
- 2.4.2 Oligophrenien
- 2.4.3 Alkoholpsychose
- 2.4.4 Substanzabusus
- 3. Beispiel an Migranten aus den GUS
- 3.1 Psychische Verfassung
- 3.2 Beweggründe für die Migration nach Deutschland
- 4. Transkulturelle Psychiatrie
- 4.1 Interkulturelle Kernkompetenzen
- 4.2 Fallbeispiel
- 5. Rolle der Sozialarbeit
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Migration und psychischer Gesundheit, insbesondere mit der Betrachtung der transkulturellen Psychiatrie. Sie analysiert die Herausforderungen, denen Migranten im Zuge ihres Umzugs in eine neue Kultur und Lebensumgebung gegenüberstehen, und untersucht den Einfluss dieser Herausforderungen auf ihre psychische Verfassung.
- Definitionen von Migration, Kultur und psychischer Gesundheit
- Analyse der psychischen Verfassung von Migranten, speziell aus der GUS
- Beweggründe für die Migration nach Deutschland
- Bedeutung der transkulturellen Psychiatrie für die Behandlung von Migranten
- Rolle der Sozialarbeit in der Unterstützung von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Migration und die damit verbundenen Belastungen für die psychische Gesundheit von Migranten. Es stellt die Bedeutung der Anpassung an eine neue Kultur und Lebensumgebung heraus und führt in die Thematik der Studienarbeit ein.
2. Definitionen
Dieses Kapitel liefert wichtige Definitionen zu den zentralen Begriffen der Studienarbeit, wie Migration, Kultur, psychische Krankheit und Gesundheit sowie ausgewählte psychische Erkrankungen.
3. Beispiel an Migranten aus den GUS
Dieses Kapitel beleuchtet die psychische Verfassung und die Beweggründe für die Migration von Menschen aus der GUS nach Deutschland. Es soll ein konkretes Beispiel für die Herausforderungen von Migranten liefern.
4. Transkulturelle Psychiatrie
Das Kapitel stellt die transkulturelle Psychiatrie als ein wichtiges Instrument für die Behandlung psychischer Erkrankungen bei Migranten vor. Es erläutert die Notwendigkeit interkultureller Kernkompetenzen in der Psychiatrie und liefert ein Fallbeispiel.
5. Rolle der Sozialarbeit
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtige Rolle der Sozialarbeit in der Unterstützung und Begleitung von Migranten. Es zeigt auf, wie Sozialarbeit dazu beitragen kann, die Integration von Migranten zu erleichtern und ihre psychische Gesundheit zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen Migration, psychische Gesundheit, transkulturelle Psychiatrie, interkulturelle Kompetenz, Integration und Sozialarbeit. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Untersuchung der psychischen Verfassung von Migranten, insbesondere aus der GUS, und den Herausforderungen, die durch den Kulturwandel entstehen.
- Quote paper
- Jan-Sebastian Müller-Wonnenberg (Author), 2012, Migration und psychische Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193665