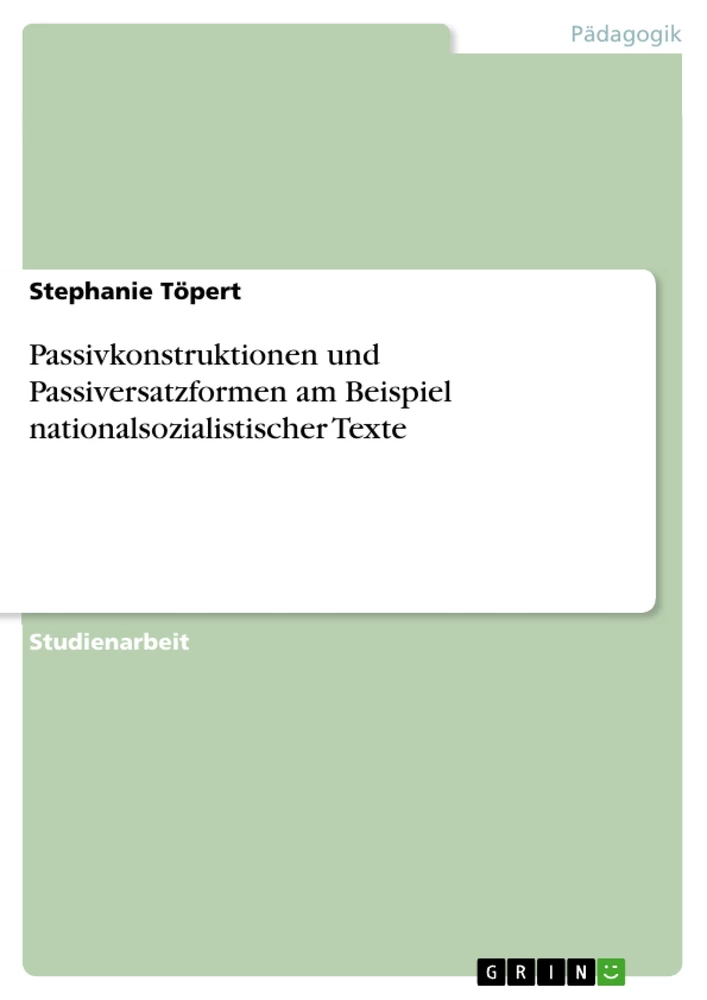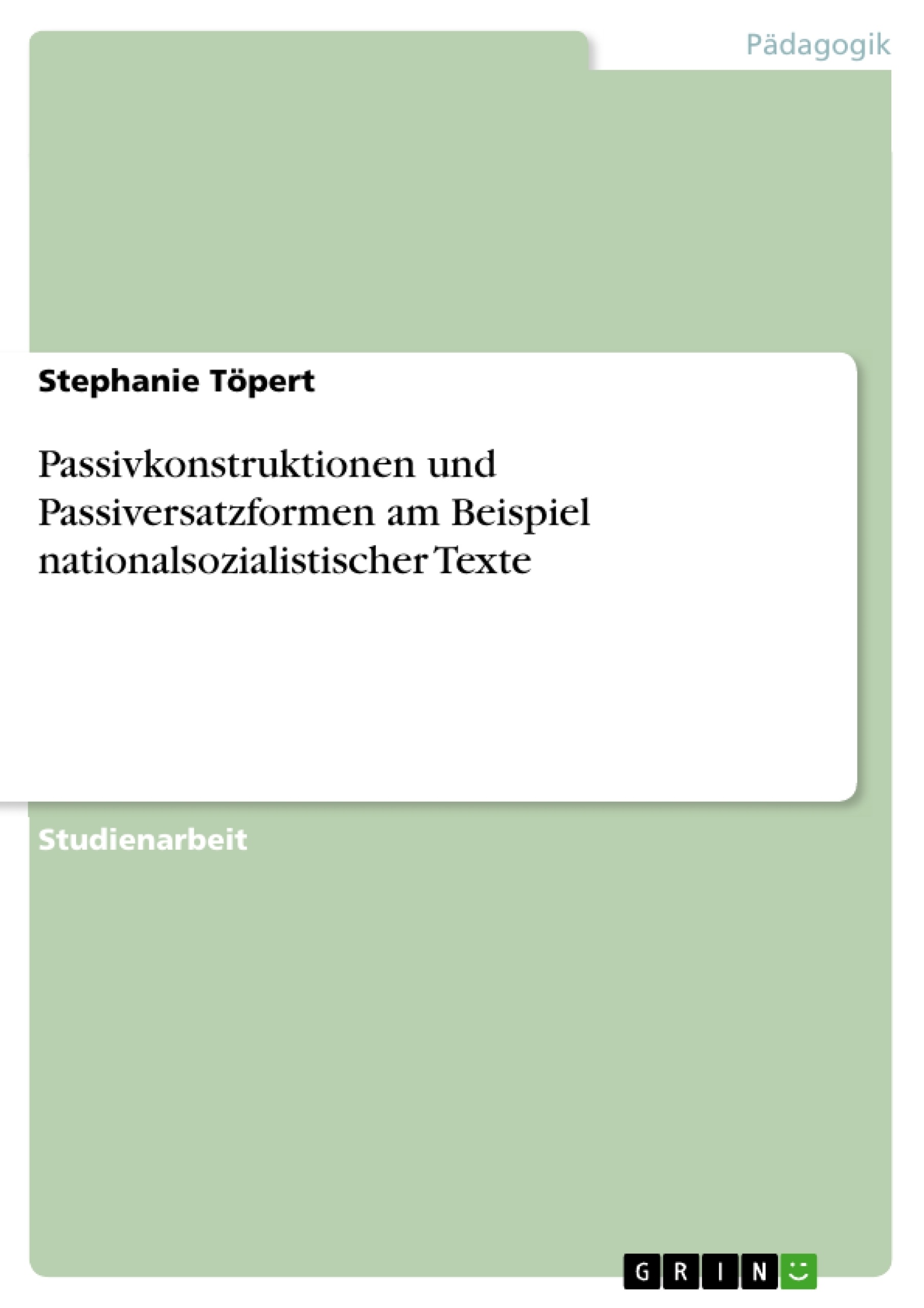1. Passiv als grammatisches Stilmittel
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Funktionen und Wirkungen von Passivkonstruktionen und deren Ersatzformen am Beispiel ihres Gebrauchs durch das deutsche, nationalsozi alistische Regime der Jahre 1933–1945. Der Ausarbeitung liegt die Annahme zugrunde, dass unpersönliche Formulierungen ein typisches Stilmittel der Sprache der Nationalsozialisten war. Daher findet die Betrachtung der grammatischen Form des Passivs anhand von Textbeispielen aus dem Nationalsozialismus statt.
Die Abhandlung soll demonstrieren, dass Formulierungen mit scheinbar gleichem Inhalt unteder Nutzung verschiedener grammatischer Formen veränderte Wirkungen bei Rezipienten entfalten. Eine Kontrastierung von Passiv- und Aktivformen wird zeigen, dass Sprache, hieinsbesondere das grammatische Stilmittel Passiv und seine Ersatzformen, manipulativ eingesetzt werden kann.
Die Ausfertigung wird zunächst einen Überblick von Passivkonstruktionen und ihre Ersatzformen liefern; zentral sind die semantischen Rollen und der Perspektivwechsel. Auf diese Basis werden agenslose Konstruktionen mit agensenthaltenden Formulierungen kontrastiertindem Auszüge aus „Hitlers Weisungen für die Kriegsführung“ in Aktivkonstruktionen umformuliert und den ursprünglichen Textausschnitten gegenübergestellt werden. Daran schließt ein Vergleich der Funktionen und Textwirkungen der jeweiligen grammatischen Formen, bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse endet...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Passiv als grammatisches Stilmittel
- 2. Diathese: Unterscheidung von Aktiv und Passiv
- 2.1. Merkmale von Aktiv und Passiv
- 2.2. Passiversatzformen als Alternative zum Passiv
- 2.3. Kontrastierung unpersönlicher mit persönlichen Konstruktionen
- 2.4. Funktionen und Wirkungen agensloser Formulierungen
- 3. Passivkonstruktionen als Mittel gesellschaftlicher Manipulation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktionen und Wirkungen von Passivkonstruktionen und deren Ersatzformen in nationalsozialistischen Texten. Die zentrale These ist, dass unpersönliche Formulierungen ein typisches Stilmittel der nationalsozialistischen Sprache waren. Die Arbeit analysiert, wie verschiedene grammatische Formen – insbesondere das Passiv und seine Alternativen – unterschiedliche Wirkungen auf den Rezipienten entfalten und manipulativ eingesetzt werden können.
- Das Passiv als grammatisches Stilmittel und seine Funktionen.
- Die Diathese (Aktiv vs. Passiv) und die semantischen Rollen (Agens, Patiens).
- Passiversatzformen und ihre Wirkung.
- Kontrastierung von agenslosen und agensenthaltenden Konstruktionen.
- Der Einsatz des Passivs als Mittel der gesellschaftlichen Manipulation im Nationalsozialismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Passiv als grammatisches Stilmittel: Diese Arbeit untersucht den Gebrauch von Passivkonstruktionen und deren Ersatzformen im nationalsozialistischen Kontext (1933-1945), basierend auf der Annahme, dass unpersönliche Formulierungen ein charakteristisches Stilmittel dieser Sprache darstellen. Die Analyse zielt darauf ab, zu zeigen, wie scheinbar gleichbedeutende Aussagen durch unterschiedliche grammatische Formen (Aktiv vs. Passiv) verschiedene Wirkungen beim Leser erzielen. Es wird eine Kontrastierung von Passiv- und Aktivformen vorgenommen, um den manipulativen Einsatz des Passivs aufzuzeigen. Die Arbeit bietet zunächst einen Überblick über Passivkonstruktionen und ihre Ersatzformen, konzentriert sich auf semantische Rollen und Perspektivwechsel und kontrastiert agenslose mit agensenthaltenden Formulierungen anhand von Beispielen aus "Hitlers Weisungen für die Kriegsführung".
2. Diathese: Unterscheidung von Aktiv und Passiv: Dieses Kapitel definiert die Diathese als sprachwissenschaftliche Unterscheidung von Aktiv und Passiv, auch bekannt als „Genus Verbi“. Es erklärt die Handlungsrichtung des Verbs und die Zuordnung semantischer Rollen (Agens, Patiens) in Aktiv- und Passivkonstruktionen. Der Schwerpunkt liegt auf der Konversion, der Veränderung des syntaktisch-semantischen Valenzrahmens des Verbs beim Übergang vom Aktiv zum Passiv. Anhand von Beispielsätzen wird die unterschiedliche Zuordnung syntaktischer Funktionen (Subjekt, Akkusativobjekt) und die Neuordnung der semantischen Rollen verdeutlicht. Der Perspektivwechsel vom Agens zum Patiens im Passiv wird analysiert, und wie dies die Handlungsverantwortung des Agens in den Hintergrund drängt.
2.2. Passiversatzformen: Dieses Kapitel beschreibt Passiversatzformen als Alternativen zum Passiv, die das Agens verschweigen, obwohl sie im Aktiv stehen. Es werden verschiedene Möglichkeiten wie Funktionsverbfügungen (mit „kommen“, „geraten“ etc.) erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der Funktion dieser Ersatzformen, die Handlungsträger zu verschleiern und so die Verantwortung zu verbergen.
Schlüsselwörter
Passiv, Passiversatzformen, Diathese, Aktiv, Agens, Patiens, semantische Rollen, Konversion, nationalsozialistische Sprache, Manipulation, Textanalyse, grammatisches Stilmittel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Passivkonstruktionen in nationalsozialistischen Texten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Funktionen und Wirkungen von Passivkonstruktionen und ihren Ersatzformen in nationalsozialistischen Texten. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie verschiedene grammatische Formen – insbesondere das Passiv und seine Alternativen – unterschiedliche Wirkungen auf den Rezipienten entfalten und manipulativ eingesetzt werden können. Die zentrale These ist, dass unpersönliche Formulierungen ein typisches Stilmittel der nationalsozialistischen Sprache waren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 befasst sich mit dem Passiv als grammatisches Stilmittel im nationalsozialistischen Kontext. Kapitel 2 unterscheidet zwischen Aktiv und Passiv (Diathese), erklärt semantische Rollen (Agens, Patiens) und analysiert Passiversatzformen. Kapitel 3 konzentriert sich auf den Einsatz des Passivs als Mittel gesellschaftlicher Manipulation im Nationalsozialismus.
Was versteht die Arbeit unter Diathese?
Die Arbeit erklärt die Diathese als sprachwissenschaftliche Unterscheidung von Aktiv und Passiv (Genus Verbi). Sie beschreibt die Handlungsrichtung des Verbs und die Zuordnung semantischer Rollen (Agens, Patiens) in Aktiv- und Passivkonstruktionen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Konversion, der Veränderung des syntaktisch-semantischen Valenzrahmens beim Übergang vom Aktiv zum Passiv.
Welche Rolle spielen Passiversatzformen?
Die Arbeit analysiert Passiversatzformen als Alternativen zum Passiv, die das Agens verschweigen, obwohl sie im Aktiv stehen. Es werden verschiedene Möglichkeiten wie Funktionsverbfügungen (mit „kommen“, „geraten“ etc.) erläutert. Der Fokus liegt auf der Funktion dieser Ersatzformen, Handlungsträger zu verschleiern und so die Verantwortung zu verbergen.
Wie wird die Manipulation durch das Passiv dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, wie scheinbar gleichbedeutende Aussagen durch unterschiedliche grammatische Formen (Aktiv vs. Passiv) verschiedene Wirkungen beim Leser erzielen. Durch die Kontrastierung von Passiv- und Aktivformen wird der manipulative Einsatz des Passivs im nationalsozialistischen Kontext verdeutlicht. Beispiele aus "Hitlers Weisungen für die Kriegsführung" werden herangezogen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Passiv, Passiversatzformen, Diathese, Aktiv, Agens, Patiens, semantische Rollen, Konversion, nationalsozialistische Sprache, Manipulation, Textanalyse, grammatisches Stilmittel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktionen und Wirkungen von Passivkonstruktionen und ihren Ersatzformen in nationalsozialistischen Texten zu untersuchen und aufzuzeigen, wie diese grammatischen Mittel zur Manipulation eingesetzt wurden. Sie analysiert, wie der Perspektivwechsel vom Agens zum Patiens die Handlungsverantwortung des Agens in den Hintergrund drängt.
- Quote paper
- Stephanie Töpert (Author), 2011, Passivkonstruktionen und Passiversatzformen am Beispiel nationalsozialistischer Texte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193636