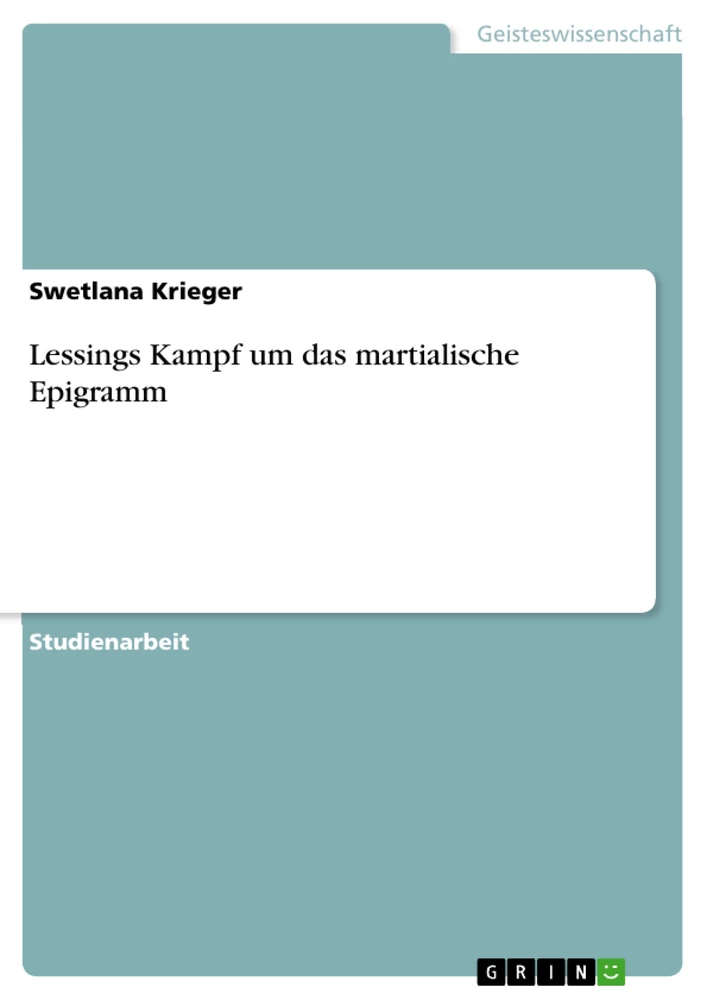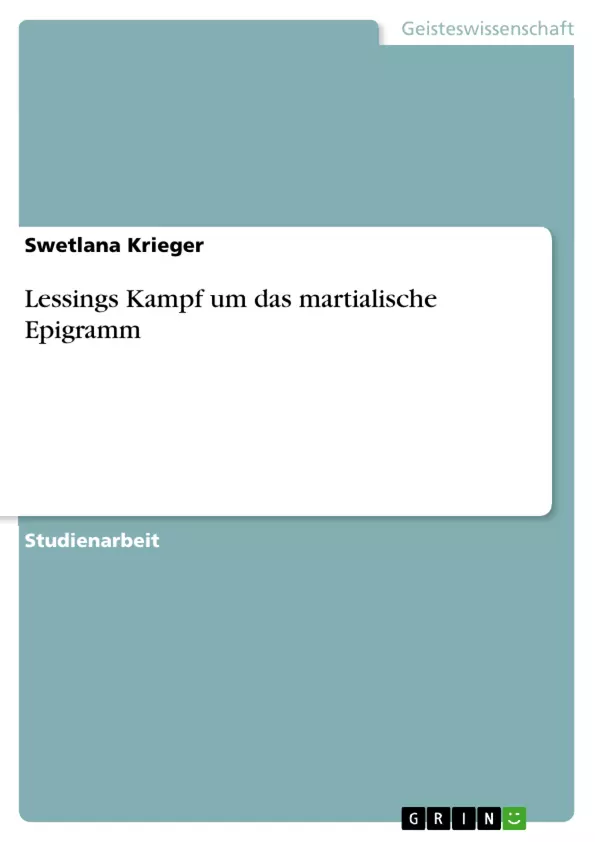Gotthold Ephraim Lessing war der erste Theoretiker, der es gewagt hatte, sich mit der unklaren Bedeutung des Begriffes Epigramm detailliert auseinander zu setzen. Sein typisches Streben zur Genauigkeit und die deutlich gezeigte Strenge in diesem Gebiet führten dazu, dass man nun im Stande ist, eine sehr ordentliche Vorstellung von diesem Begriff zu bekommen. Der Definition des Epigramms durch Lessings verdanken wir die Tatsache, dass diese Literaturgattung bis heute noch an Bedeutung gewinnt. Man denke nur an den Stellenwert dieses Themas an den Universitäten und an das Interesse der zahlreichen Studierenden in diesem Bereich.
Als Ziel dieser Arbeit habe ich mir gesetzt, Lessings Sorge um das Epigramm zu verdeutlichen und zu zeigen, inwieweit die Resultate dieses Bemühens unsere Gegenwart beeinflussen. Aus diesem Grund sah ich die Notwendigkeit, den Ursprung des Epigramms und seine griechischen Wurzeln zu beleuchten, seine Entfaltung zu dem Buch-Epigramm zu veranschaulichen und Lessings Lösung bezüglich der entstandenen Ungleichheiten zu beschreiben. Im weiteren Verlauf der Arbeit habe ich mich auf die Arbeit Lessings über das Epigramm selbst konzentriert und habe seine Begegnungen mit anderen Theoretikern auf diesem Gebiet aufgelistet. Durch seine Auseinandersetzungen mit diesen ehrenwerten Wissenschaftlern habe ich an dieser Stelle versucht, seinen Kampf um diese Literaturgattung hervorzuheben. Schließlich widme ich mich dem Nachwirken, wobei ich den bekanntesten Schriftsteller, Dichter und Epigrammatikers des 20. Jahrhundert wählte: Bertolt Brecht. Interessant fand ich an dieser Stelle die Tatsache, dass das Epigramm in seinem Wesen als Schriftsteller Spuren hinterlassen hatte und diese Spuren führten dann zu seien Werk «die Kriegsfibel». Allen drei Themen, die Antike, das Epigramm und die Kriegsfibel erwähne ich in einem meiner Kapitel.
Das Ende meiner Arbeit bilden zwei Epigramme, eines ist von Martial, ein anderes ist von Brecht, an denen ich dann die Theorie Lessings aufzuzeigen versuche.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Von Inschriften bis bücherwürdigen Epigrammen
- 2.1 Επίγραμμα: Der Ursprung
- 2.2 Martial und das Buch-Epigramm: Die Entfernung
- 2.3 Zwei Teile eines Ganzen: Lessings Lösung
- 3. Lessings Wege zu den «Zerstreuten Anmerkungen»
- 3.1 Theoretische Begegnungen: Scaliger, Vavassor, Boileau und andere
- 3.2 «Zerstreute Anmerkungen»>: Die Entstehung
- 4. Nachwirken des martialischen Epigramms
- 4.1 Einfluss des Martial auf Lessing selbst
- 4.2 Bertolt Brecht und das martialische Epigramm
- 4.2.1 Bertolt Brecht und die Antike
- 4.2.2 Das Epigramm bei Brecht
- 4.2.3 Die Kriegsfibel
- 5. Martial, Lessing und Brecht: Buch-Epigramm, Theorie und Fotoepigramm
- 5.1 Lessings Anhaltspunkte
- 5.2 Martial und das Epigramm Nr. 27 des zweiten Buches
- 5.2.1 Lateinischer Text und Übersetzung
- 5.2.2 Die Interpretation
- 5.2.3 Lessings Merkmale am Epigramm 27 des zweiten Buches
- 5.3 Fotoepigramm Nr. 27 von Brechts Kriegsfibel
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gotthold Ephraim Lessings Bemühungen um eine präzise Definition des Epigramms, ausgehend von seinen „Zerstreuten Anmerkungen“. Ziel ist es, Lessings Einfluss auf das Verständnis des Epigramms aufzuzeigen und dessen Bedeutung für die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, insbesondere im Werk Bertolt Brechts, zu beleuchten.
- Lessings Definition des Epigramms und seine theoretischen Auseinandersetzungen.
- Die Entwicklung des Epigramms von der Inschrift zum Buch-Epigramm.
- Der Einfluss des Epigramms von Martial auf Lessing.
- Die Verwendung des Epigramms in Bertolt Brechts Werk, besonders in der „Kriegsfibel“.
- Ein Vergleich von Martials, Lessings und Brechts Umgang mit dem Epigramm.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Gotthold Ephraim Lessing als den ersten detaillierten Theoretiker des Epigramms vor und betont seine präzise Definition, die bis heute von Bedeutung ist. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Lessings Engagement für das Epigramm zu verdeutlichen und dessen Einfluss auf die Gegenwart zu belegen. Sie kündigt die Untersuchung des Ursprungs des Epigramms, seine Entwicklung zum Buch-Epigramm, Lessings Lösungsansätze und den Einfluss auf Bertolt Brecht an.
2. Von Inschriften bis bücherwürdigen Epigrammen: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Epigramms. Es beginnt mit seinem Ursprung als einfache Inschrift auf Gegenständen und verfolgt seine Entwicklung zur literarischen Gattung, beeinflusst von der griechischen Poesie und der Elegie. Der Übergang vom epigrammatischen Gebrauch auf Grabsteinen und Denkmälern hin zum Buch-Epigramm im Hellenismus wird detailliert beschrieben. Die entscheidende Wendung durch den römischen Dichter Lukillios, der das Epigramm zur Parodie und Verspottung nutzte, wird hervorgehoben. Schliesslich wird die Entwicklung bis zu Martial, der das Buch-Epigramm repräsentiert, nachgezeichnet.
3. Lessings Wege zu den «Zerstreuten Anmerkungen»: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Lessings Auseinandersetzung mit dem Epigramm. Es beleuchtet seine theoretischen Begegnungen mit anderen Gelehrten wie Scaliger, Vavassor und Boileau, um seinen Kampf um eine präzise Definition des Epigramms zu verdeutlichen. Die Entstehung seiner „Zerstreuten Anmerkungen“ wird im Detail erläutert, wobei der Kontext seiner Begegnungen mit anderen Theoretikern hervorgehoben wird.
4. Nachwirken des martialischen Epigramms: Dieses Kapitel behandelt den Einfluss des martialischen Epigramms auf spätere Autoren, insbesondere auf Bertolt Brecht. Es untersucht Brechts Bezug zur Antike, seine Verwendung des Epigramms in seinem Werk, und insbesondere in der „Kriegsfibel“. Es wird der Zusammenhang zwischen Brechts Werk, dem Epigramm und der Antike hergestellt.
Schlüsselwörter
Epigramm, Martial, Lessing, Brecht, „Zerstreute Anmerkungen“, Buch-Epigramm, Kriegsfibel, Antike, Literaturtheorie, Literaturgattung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lessings Einfluss auf das Verständnis des Epigramms und dessen Bedeutung für Bertolt Brecht
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Gotthold Ephraim Lessings Bemühungen um eine präzise Definition des Epigramms, ausgehend von seinen „Zerstreuten Anmerkungen“. Sie beleuchtet Lessings Einfluss auf das Verständnis des Epigramms und dessen Bedeutung für die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, insbesondere im Werk Bertolt Brechts.
Welche Aspekte des Epigramms werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Epigramms von der Inschrift bis zum Buch-Epigramm, Lessings theoretische Auseinandersetzungen mit dem Epigramm und seinen Einfluss auf die Definition der Gattung, sowie die Verwendung des Epigramms in Bertolt Brechts Werk, insbesondere in der „Kriegsfibel“. Ein Vergleich zwischen Martials, Lessings und Brechts Umgang mit dem Epigramm wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Rolle spielt Lessing in dieser Arbeit?
Gotthold Ephraim Lessing wird als der erste detaillierte Theoretiker des Epigramms präsentiert. Die Arbeit analysiert seine Definition des Epigramms und seine theoretischen Auseinandersetzungen mit anderen Gelehrten wie Scaliger, Vavassor und Boileau. Sein Einfluss auf das Verständnis und die Entwicklung des Epigramms steht im Mittelpunkt der Untersuchung.
Welche Bedeutung hat Bertolt Brecht in diesem Kontext?
Bertolt Brecht wird als Beispiel für das Nachwirken des martialischen Epigramms in der modernen Literatur untersucht. Die Arbeit analysiert Brechts Bezug zur Antike, seine Verwendung des Epigramms in seinem Werk und insbesondere in der „Kriegsfibel“. Der Einfluss Lessings auf Brechts Verständnis des Epigramms wird ebenfalls thematisiert.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Lessings „Zerstreute Anmerkungen“ und untersucht den Einfluss von Martial auf Lessing und Brecht. Sie analysiert Brechts „Kriegsfibel“ im Kontext der Epigrammtradition. Die Arbeit stützt sich auf literaturtheoretische Analysen und historische Kontextualisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, die historische Entwicklung des Epigramms, Lessings Weg zu den „Zerstreuten Anmerkungen“, das Nachwirken des martialischen Epigramms bei Brecht, ein Vergleich zwischen Martial, Lessing und Brecht sowie ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit dem Ursprung des Epigramms und endend mit einer umfassenden Analyse des Einflusses von Lessing und Martial auf Brechts Werk.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Epigramm, Martial, Lessing, Brecht, „Zerstreute Anmerkungen“, Buch-Epigramm, Kriegsfibel, Antike, Literaturtheorie, Literaturgattung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema?
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in einschlägiger Literatur zur Literaturtheorie, der Antike, Lessing-Forschung und Brecht-Forschung. Spezifische Werke von Martial, Lessing und Brecht sowie Sekundärliteratur zu diesen Autoren können zusätzliche Einblicke bieten.
- Quote paper
- Swetlana Krieger (Author), 2012, Lessings Kampf um das martialische Epigramm , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193610