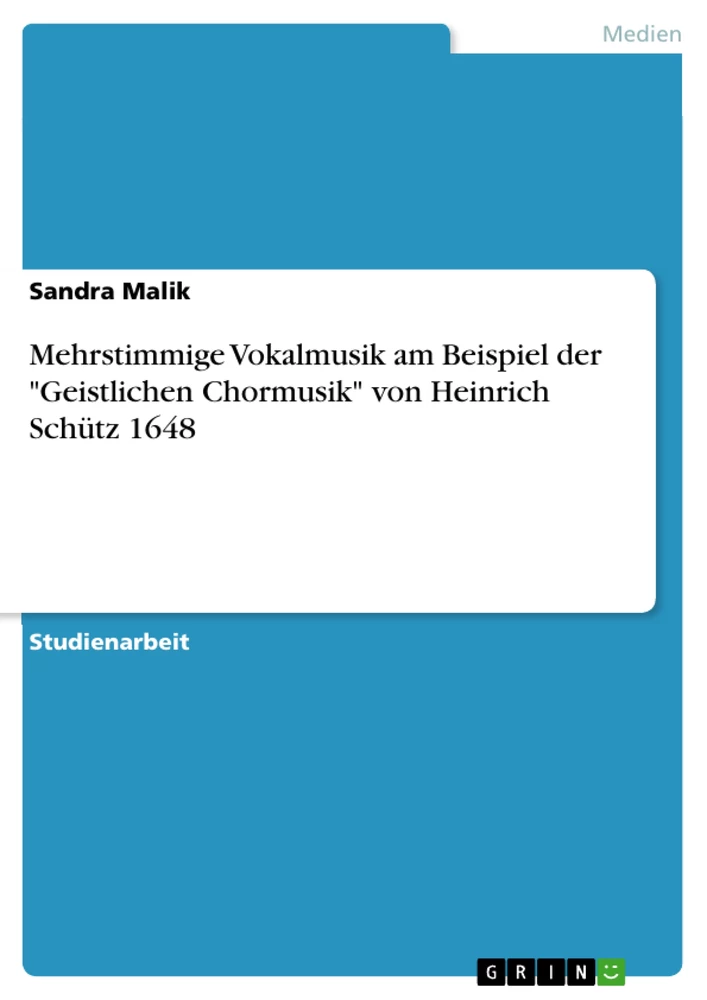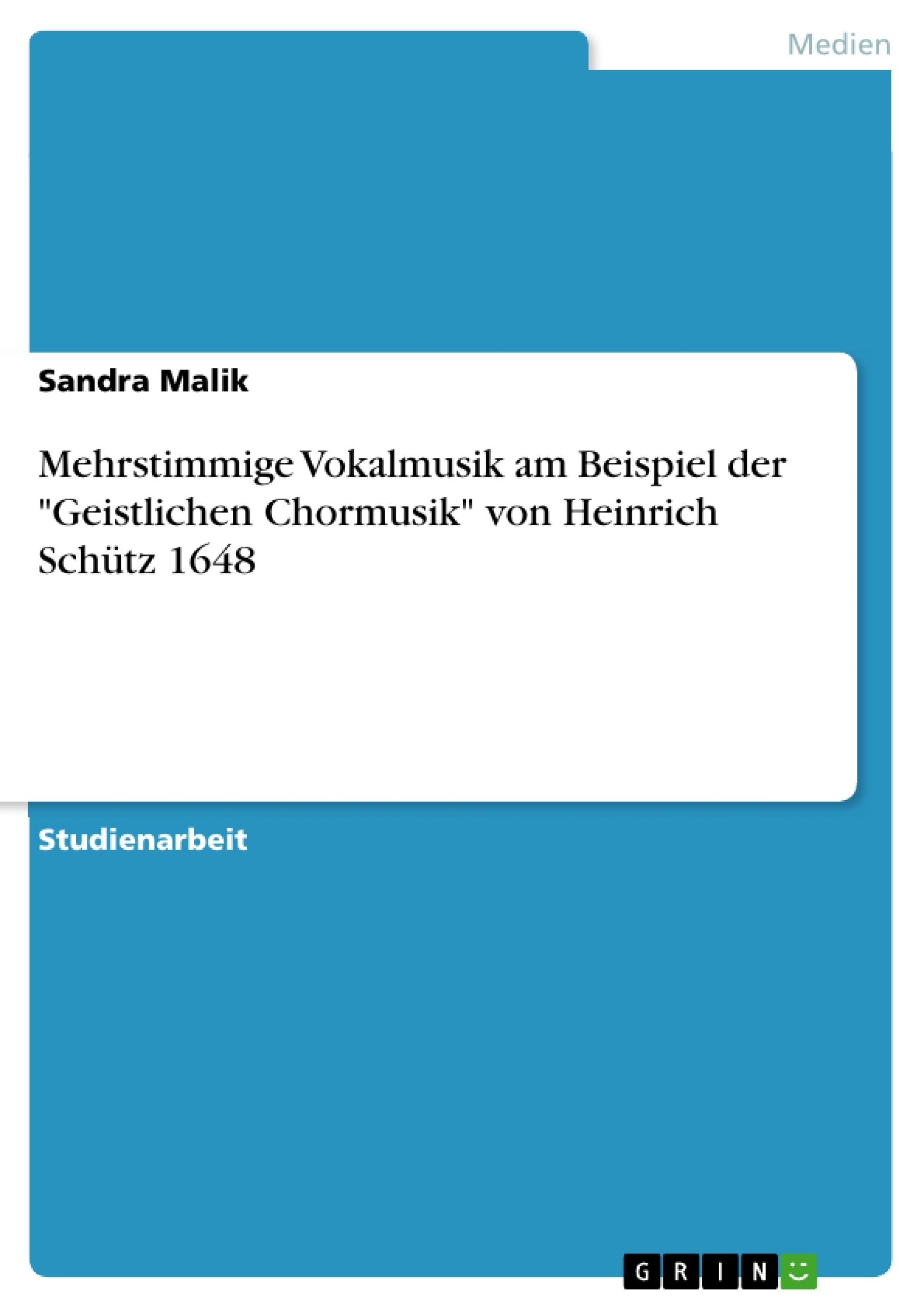Heinrich Schütz, auch als Vater der deutschen Musik bekannt, hat mit seinem Werk der Geistlichen Chormusik 1648 mehr als nur eine Sammlung von Stücken in motettetischem Stil erschaffen. Dieses Werk kann rückblickend als Vereinigung der musikalischen Traditionen der Renaissance und des Barocks gesehen werden und dient nicht nur der Bestätigung für die Meisterhaftigkeit Schützens. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht nur die Geistliche Chormusik von Schütz vorzustellen, sondern sie ebenso in den zeitlichen Kontext einzubetten. Dabei soll vorab die Beschreibung der Mehrstimmigkeit und ihre Entstehungs- sowie Entwicklungsgeschichte dazu dienen einen Gesamteindruck von dem Themenbereich zu bekommen und um natürlich wichtige Ereignisse, die im späteren Verlauf der Arbeit Relevanz finden, aufzuarbeiten. Hierbei wird die Motette eine wichtige Rolle spielen. Nachdem ich dann die Zentralsten Ereignisse aus dem Leben von Schütz knapp dargestellt habe, soll explizit auf die Geistliche Chormusik eingegangen werden. Hier wird der Schwerpunkt auf den in der Entwicklungsgeschichte vorangestellten zentralen Merkmalen liegen. Nach einer kurzen Erläuterung des Rezeptionsgeschehens rund um die Geistliche Chormusik, möchte ich anhand einer beispielhaften Analyse des Stückes "O lieber Herre Gott, wecke uns auf" Erarbeitetes verdeutlichen. Insgesamt soll die vorliegende Arbeit einen überblick verschaffenden Charakter zum Ziel haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Mehrstimmigen Vokalmusik
- Über das Werk und seinen Kontext: die Geistliche Chormusik
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund und Schütz
- Geistliche Chormusik von 1648
- Rezeptionsgeschichte
- Ein analytischer Einblick
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geistlichen Chormusik von Heinrich Schütz aus dem Jahr 1648 und untersucht sie in ihrem zeitlichen Kontext. Das Ziel ist es, das Werk vorzustellen und seine Bedeutung innerhalb der musikalischen Traditionen der Renaissance und des Barocks aufzuzeigen.
- Entstehung und Entwicklung der Mehrstimmigen Vokalmusik
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund und Einfluss auf Schützens Werk
- Analyse der Geistlichen Chormusik von 1648
- Rezeption und Einfluss des Werkes auf die Musikgeschichte
- Bedeutung der Motette in Schützens Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Heinrich Schütz als den "Vater der deutschen Musik" vor und erklärt die Bedeutung seiner Geistlichen Chormusik von 1648. Sie unterstreicht die Verbindung zwischen Renaissance und Barock in diesem Werk und erläutert das Ziel der Arbeit: die Musik Schützens in den zeitlichen Kontext einzubetten.
- Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Mehrstimmigen Vokalmusik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen der Mehrstimmigen Vokalmusik, insbesondere im Abendländischen Raum. Es zeichnet die Entwicklung von der einstimmigen Monodie hin zur komplexen Polyphonie nach und beleuchtet die Rolle der Notation und der Suche nach festlicher Musik im Gottesdienst.
- Über das Werk und seinen Kontext: die Geistliche Chormusik: Dieses Kapitel widmet sich der Zeitgeschichte und Schützens Leben, um das Werk in seinen Kontext einzubetten. Weiterhin werden die zentralen Merkmale der Geistlichen Chormusik von 1648 beleuchtet und die Rezeption des Werkes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Heinrich Schütz, Geistliche Chormusik, Mehrstimmige Vokalmusik, Motette, Renaissance, Barock, Zeitgeschichte, Rezeption, Analyse, "O lieber Herre Gott, wecke uns auf".
- Quote paper
- Sandra Malik (Author), 2011, Mehrstimmige Vokalmusik am Beispiel der "Geistlichen Chormusik" von Heinrich Schütz 1648, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193318