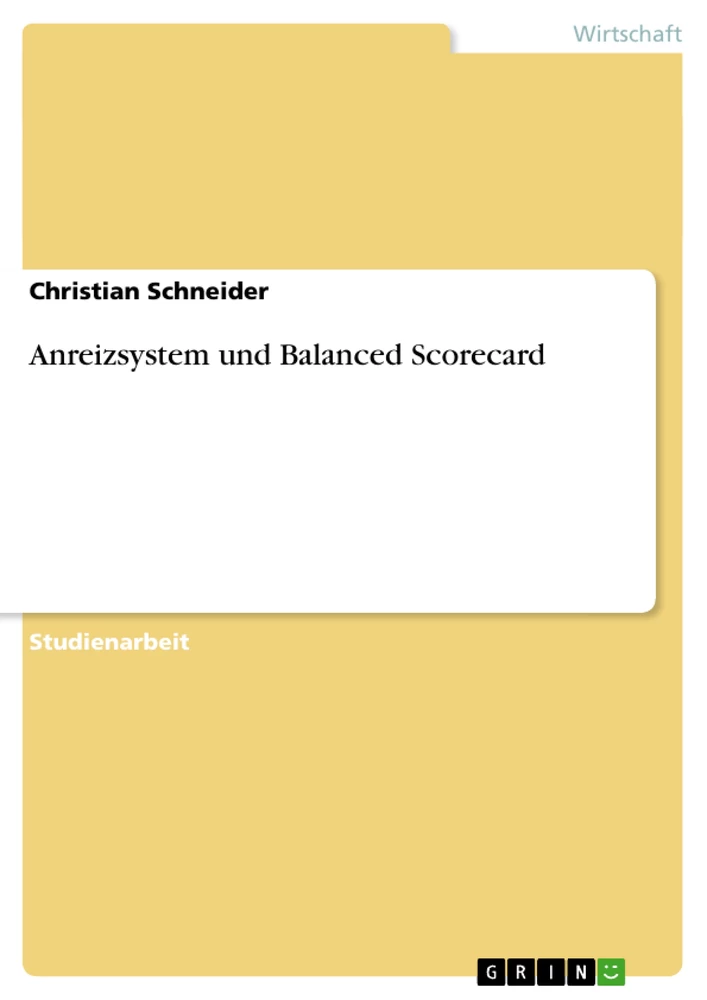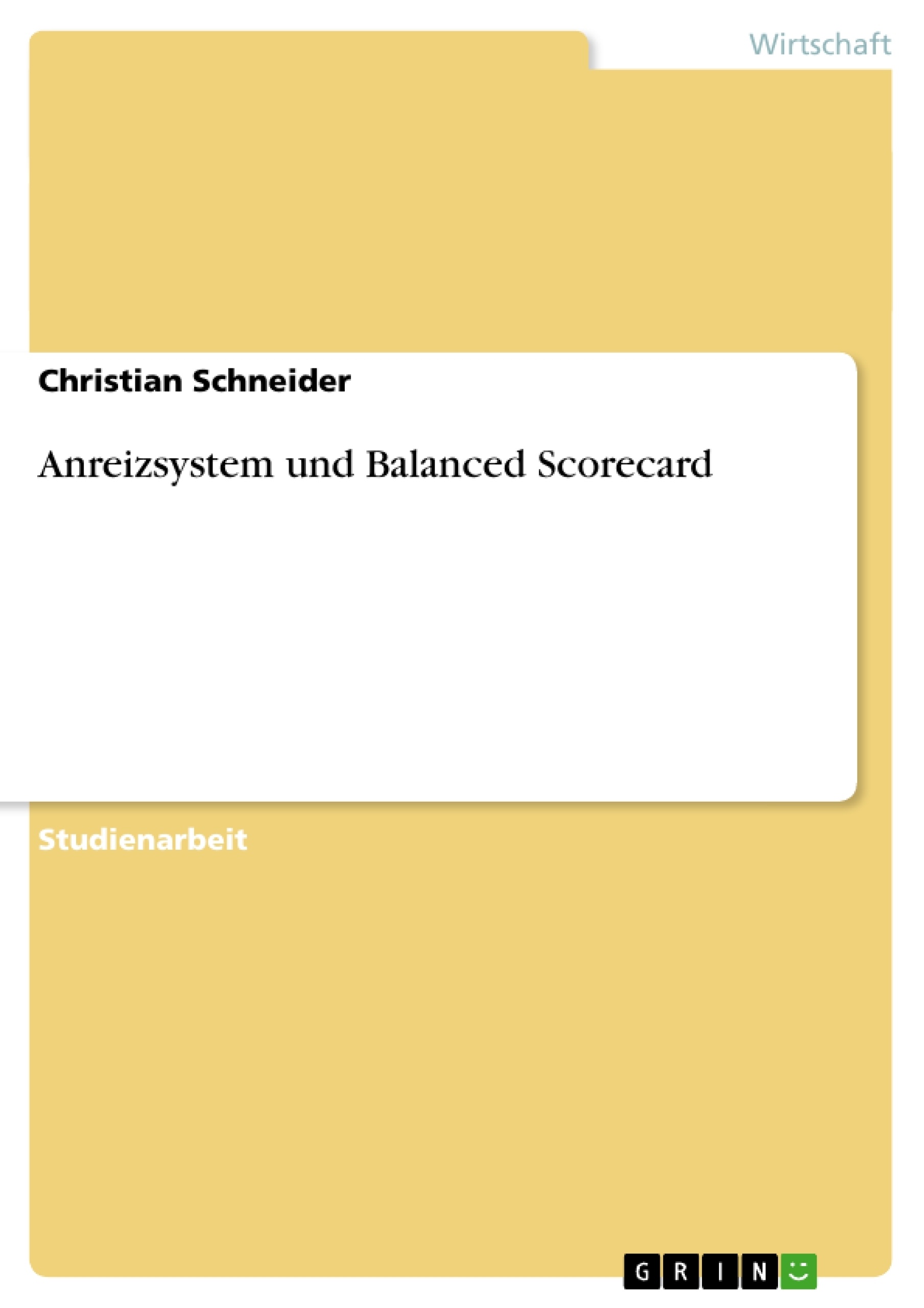Soziale und materielle Anreizsysteme sollen Mitarbeiter dazu motivieren, eigenes Wissen
zur Verfügung zu stellen und vorhandenes Wissen zu nutzen. Dieses System stellt
i.d.R. ein Belohnungssystem auf der Basis von Prämien, Aufstiegschancen oder Unternehmensanteilen
dar. Zu Beginn der 90er Jahre entwickelten Kaplan und Norton die
Idee eines „ganzheitlichen“ Controlling-Instruments, das sie später als „Balanced Scorecard“
(im Folgenden BSC) bezeichneten und welches auch nicht-finanzielle Kennzahlen
einbezieht. Kerngedanke dabei ist, das Unternehmensziel durch Verknüpfung mit
individuellen Zielsetzungen auf jede Unternehmensebene herunterzubrechen. Die jeweiligen
Performance-Maße sollen zueinander in einem ausgewogenen Verhältnis stehen,
d.h. man sucht die Balance zwischen finanziellen und nicht-finanziellen sowie Frühund
Spätindikatoren.1
In Wissenschaft und Praxis wird es als unstrittig angesehen, dass für die Anpassung der
Unternehmenskultur an die Unternehmensstrategie in letzter Konsequenz auch das Anreizsystem
dieser Organisation an die Scorecard – Ziele geknüpft werden kann und
muss. Hinsichtlich dieses Aspekts stellt sich die Frage nach der Anreizkompatibilität
und der Effektivität eines BSC – basierten Entlohnungsschemas.
Diese Arbeit befasst sich mit einigen bislang ungeklärten Aspekten die im Rahmen der
BSC und den Konsequenzen für die Anreizsteuerung entstanden sind. Der Fokus liegt
hierbei auf: dem Einfluss der Unternehmensstrategie auf die Wahl der Performancemaße,
dem Einfluss von Vorständen auf die Zusammensetzung von Entlohnungsfunktionen,
den Möglichkeiten des Strategietransfers über eine BSC und schließlich den Effekten
kognitiver Informationsstrukturen im Rechnungswesen.
Zunächst soll in Abschnitt 2.1. das Kernkonzept der BSC kurz dargestellt werden, ohne
dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Abschnitt 2.2. erläutert das Verhältnis
zwischen Anreizentlohnung und der Scorecard. In 2.3. und den dazugehörigen Unterabschnitten
findet dann die Entwicklung der Thesen statt. Anschließend wird in 2.4. überprüft,
inwiefern die Thesen vor dem Hintergrund empirischer Überprüfung haltbar erscheinen.
Abschließend werden in Kapitel 3 die Ergebnisse thesenförmig zusammengefasst.
1 vgl. Kaplan/Norton, (BSC), S.23
Inhaltsverzeichnis
- 1. PROBLEMSTELLUNG
- 2. ANREIZSYSTEM UND BALANCED SCORECARD
- 2.1. Das Kernkonzept der Balanced Scorecard
- 2.2. Balanced Scorecard und Anreizentlohnung
- 2.3. Die Entwicklung der Thesen
- 2.3.1. These 2: Abhängigkeit der Performancemaße von der gewählten Unternehmensstrategie
- 2.3.2. These 3: Gefahr der Manipulation nicht – finanzieller Maße
- 2.3.3. These 4: Verbesserte Kommunikationsfähigkeit der Unternehmensstrategie mittels Balanced Scorecard
- 2.3.4. These 5: Gefahr der Vorstrukturierung der gelieferten Balanced Scorecard - Informationen
- 2.4. Die empirische Evidenz der Thesen
- 2.4.1. These 2: Abhängigkeit der Performancemaße von der gewählten Unternehmensstrategie
- 2.4.2. These 3: Gefahr der Manipulation nicht – finanzieller Maße
- 2.4.3. These 4: Verbesserte Kommunikationsfähigkeit der Unternehmensstrategie mittels Balanced Scorecard
- 2.4.4. These 5: Gefahr der Vorstrukturierung der gelieferten Balanced Scorecard - Informationen
- 3. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Anreizsystemen und der Balanced Scorecard (BSC) und beleuchtet dabei wichtige Aspekte, die bislang ungeklärt sind. Das Ziel ist es, die Effektivität eines BSC-basierten Entlohnungsschemas im Kontext der Unternehmensstrategie zu analysieren.
- Der Einfluss der Unternehmensstrategie auf die Wahl der Performancemaße
- Der Einfluss von Vorständen auf die Gestaltung von Entlohnungsfunktionen
- Die Möglichkeiten des Strategietransfers über eine BSC
- Die Auswirkungen kognitiver Informationsstrukturen im Rechnungswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problemstellung dar und beleuchtet die Bedeutung von Anreizsystemen in Bezug auf die Motivation von Mitarbeitern sowie die Rolle der Balanced Scorecard als "ganzheitliches" Controlling-Instrument. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der BSC und Anreizsteuerung und deren Auswirkungen auf die Unternehmenskultur.
Kapitel 2.1 erläutert das Kernkonzept der Balanced Scorecard, während Kapitel 2.2 das Verhältnis zwischen Anreizentlohnung und der Scorecard beleuchtet. In Kapitel 2.3 werden verschiedene Thesen entwickelt, die den Einfluss der Unternehmensstrategie auf die Performancemaße, die Gefahr der Manipulation nicht-finanzieller Maße, die Kommunikationsfähigkeit der BSC sowie die Gefahr der Vorstrukturierung von Informationen behandeln. Kapitel 2.4 befasst sich mit der empirischen Überprüfung dieser Thesen, um deren Haltbarkeit zu bewerten.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard, Anreizsystem, Performancemaße, Unternehmensstrategie, Entlohnungsschema, Strategietransfer, Informationsstrukturen, Rechnungswesen.
- Quote paper
- Christian Schneider (Author), 2003, Anreizsystem und Balanced Scorecard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19324