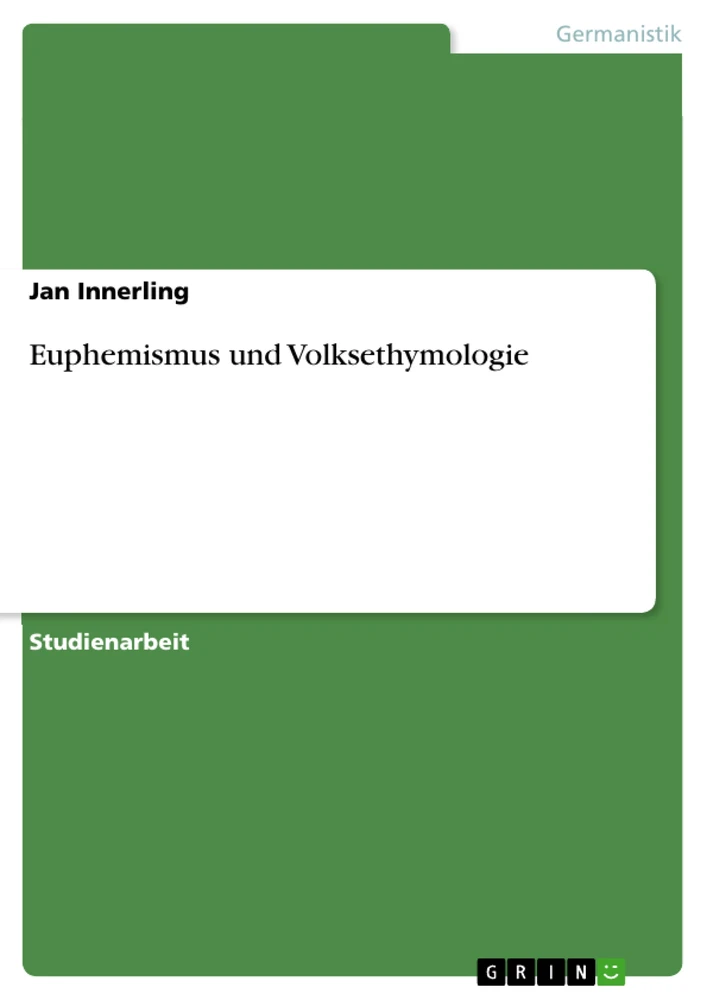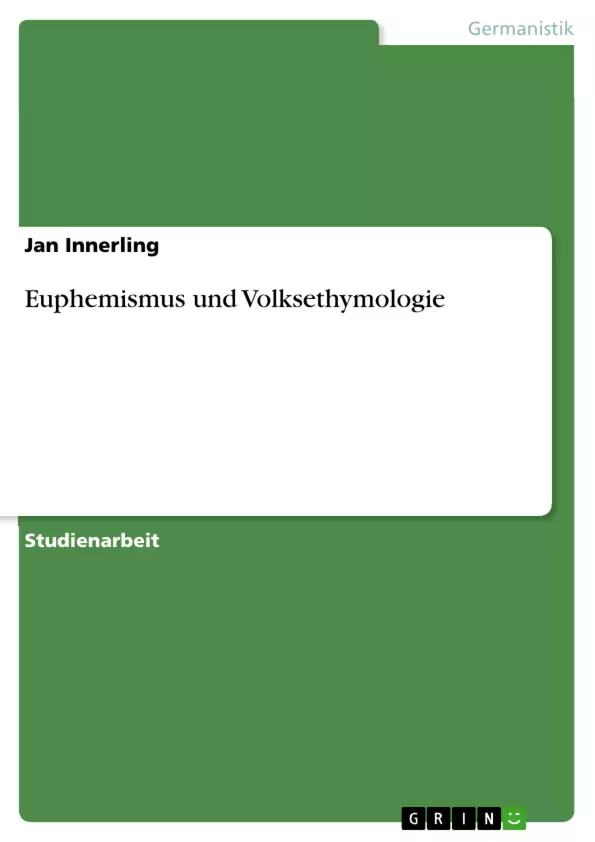Der Gebrauch eines „Euphemismus“ ist aus der Alltagssprache nicht mehr wegzudenken. Jeder verwendet ihn, doch kaum einer ist sich dessen bewusst. Gerne umschreibt man den Tod, also das Sterben eines Menschen mit Ausdrücken wie „über den Jordan gehen“ oder auch „die ewige Ruhe finden“, kaum einer weiß jedoch, dass er dadurch schon einen Euphemismus in seinen Sprachgebrauch aufgenommen hat.
Ähnlich verhält es sich mit Volksetymologien. Viele Begriffe, die man im täglichen Leben verwendet, können wir vermeintlich herleiten, meist jedoch – zumindest aus sprachwissenschaftlicher Sicht - ohne Erfolg. Wer zum Beispiel meint, der Maulwurf verdanke seinen Namen der Tatsache, dass er „Erde mit seinem Maul wirft“, liegt gänzlich falsch.
Diese Arbeit hat das Ziel zu klären, was man unter den Begriffen „Euphemismus“ und „Volksetymologie“ zu verstehen hat und welche Präsenz und Bedeutung diese im alltäglichen Leben haben.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Hauptteil
- I. Der „Euphemismus“
- 1. Wortherkunft
- 2. Definition „Euphemismus“
- a) Funktion des „Euphemismus“
- b) Wirkung des „Euphemismus“
- 3. „Euphemismen“ im Sprachgebrauch
- a) „Euphemismen“ im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten
- b) „Euphemismen“ in der Alltagssprache
- II. Die „Volksetymologie“
- 1. Wortherkunft
- 2. Definition „Volksetymologie“
- 3. Die Typologie von „Volksetymologien“
- 4. Fazit
- C Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begriffe „Euphemismus“ und „Volksetymologie“, beleuchtet ihre sprachwissenschaftliche Bedeutung und analysiert ihre Präsenz und Relevanz im alltäglichen Sprachgebrauch. Das Ziel ist ein umfassendes Verständnis der beiden Konzepte und ihrer Funktion in verschiedenen Kontexten.
- Wortherkunft und Definition von Euphemismus und Volksetymologie
- Analyse der Funktion und Wirkung von Euphemismen
- Untersuchung des Gebrauchs von Euphemismen im Kontext des Nationalsozialismus
- Beobachtung des Vorkommens von Euphemismen in der Alltagssprache
- Typologie der Volksetymologie
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Euphemismen und Volksetymologien ein und verdeutlicht deren allgegenwärtigen, aber oft unbewussten Gebrauch in der Alltagssprache. Am Beispiel des Wortes „Maulwurf“ wird die scheinbar einfache, aber oft irrtümliche Herleitung von Wörtern illustriert, was die Notwendigkeit einer sprachwissenschaftlichen Betrachtung unterstreicht. Die Arbeit hat zum Ziel, die Begriffe zu definieren und ihre Bedeutung im alltäglichen Leben zu ergründen.
I. Der „Euphemismus“: Dieses Kapitel widmet sich umfassend dem Begriff „Euphemismus“. Zunächst wird die griechische Wortherkunft erläutert, wonach „Euphemismus“ wörtlich „gut sagen“ bedeutet. Es folgt eine Definition, die den Euphemismus als eine Umschreibung von etwas Unangenehmen, Unhöflichem oder Schrecklichem beschreibt. Die Funktion des Euphemismus wird als Periphrase erklärt, motiviert durch Rücksichtnahme, Aberglaube, Beschönigung oder Ehrfurcht. Die Wirkung hängt von der Motivation ab: Milderung, Verschleierung, Beschönigung von negativ konnotierten Begriffen und das Sprechen über Tabuthemen. Der praktische Gebrauch wird anhand von Beispielen aus dem Sprachgebrauch der Nationalsozialisten („Endlösung der Judenfrage“, „Rassenhygiene“, „Brausebad und Desinfektion“) und der Alltagssprache (Umschreibungen für Trunkenheit, Prostitution und Tod) veranschaulicht, wobei die unterschiedlichen Intentionen und Wirkungen herausgestellt werden.
II. Die „Volksetymologie“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Volksetymologie“. Nach der Klärung der Wortherkunft und einer Definition werden verschiedene Typologien von Volksetymologien vorgestellt: mit und ohne lautliche und inhaltliche Veränderung. Das Kapitel untersucht, wie vermeintliche Herleitungen von Wörtern entstehen und oftmals – aus sprachwissenschaftlicher Sicht – falsch sind. Es analysiert die Mechanismen und Prozesse hinter der Volksetymologie und deren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. Die Bedeutung der sprachwissenschaftlichen Korrektheit bei der Erklärung von Wortherkünften wird betont.
Schlüsselwörter
Euphemismus, Volksetymologie, Sprachgebrauch, Nationalsozialismus, Alltagssprache, Wortherkunft, Definition, Funktion, Wirkung, Wortbildung, Sprachwissenschaft, semantische Veränderung, Tabuthemen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Euphemismen und Volksetymologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachwissenschaftlichen Konzepte „Euphemismus“ und „Volksetymologie“. Sie untersucht deren Bedeutung, Funktion und Wirkung im alltäglichen Sprachgebrauch, insbesondere auch im Kontext des Nationalsozialismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wortherkunft und Definition beider Begriffe. Es wird die Funktion und Wirkung von Euphemismen analysiert, deren Verwendung im Nationalsozialismus und in der Alltagssprache untersucht und eine Typologie der Volksetymologie vorgestellt. Die sprachwissenschaftliche Korrektheit bei der Erklärung von Wortherkünften wird betont.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (A), einen Hauptteil (B) mit den Kapiteln I. „Der Euphemismus“ und II. „Die Volksetymologie“, und einen Schluss (C). Der Hauptteil beinhaltet detaillierte Analysen der beiden Konzepte, inklusive Beispielen aus dem Sprachgebrauch des Nationalsozialismus und der Alltagssprache.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse des Euphemismus?
Die Analyse des Euphemismus umfasst dessen Wortherkunft („gut sagen“), Definition als Umschreibung von etwas Unangenehmen, und die Analyse seiner Funktion (Periphrase aus Rücksichtnahme, Aberglaube etc.) und Wirkung (Milderung, Verschleierung, Beschönigung). Es werden Beispiele aus dem Sprachgebrauch der Nationalsozialisten und der Alltagssprache präsentiert und deren Intentionen und Wirkungen verglichen.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der Volksetymologie?
Die Analyse der Volksetymologie umfasst die Klärung der Wortherkunft und Definition des Begriffs. Es werden verschiedene Typologien von Volksetymologien vorgestellt, die mit und ohne lautliche und inhaltliche Veränderungen einhergehen. Die Arbeit analysiert die Mechanismen und Prozesse hinter der Volksetymologie und deren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Euphemismus, Volksetymologie, Sprachgebrauch, Nationalsozialismus, Alltagssprache, Wortherkunft, Definition, Funktion, Wirkung, Wortbildung, Sprachwissenschaft, semantische Veränderung, Tabuthemen.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der Kapitel?
Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Zusammenfassung der Einleitung, des Kapitels zum Euphemismus und des Kapitels zur Volksetymologie. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über die wichtigsten Punkte jedes Abschnitts.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf ein umfassendes Verständnis der Konzepte „Euphemismus“ und „Volksetymologie“ und deren Funktion in verschiedenen Kontexten ab. Sie soll die sprachwissenschaftliche Bedeutung beider Begriffe beleuchten und deren Präsenz und Relevanz im alltäglichen Sprachgebrauch analysieren.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für Sprachwissenschaft, insbesondere für die Analyse von Euphemismen und Volksetymologie interessieren. Der akademische Fokus ist deutlich erkennbar.
- Arbeit zitieren
- Jan Innerling (Autor:in), 2012, Euphemismus und Volksethymologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193226