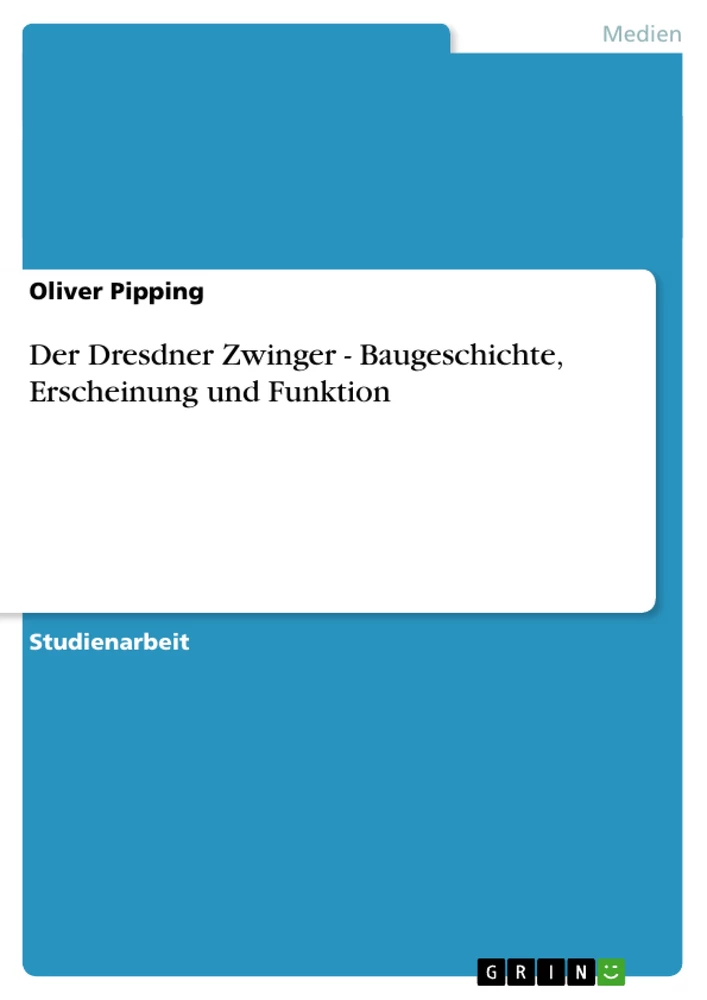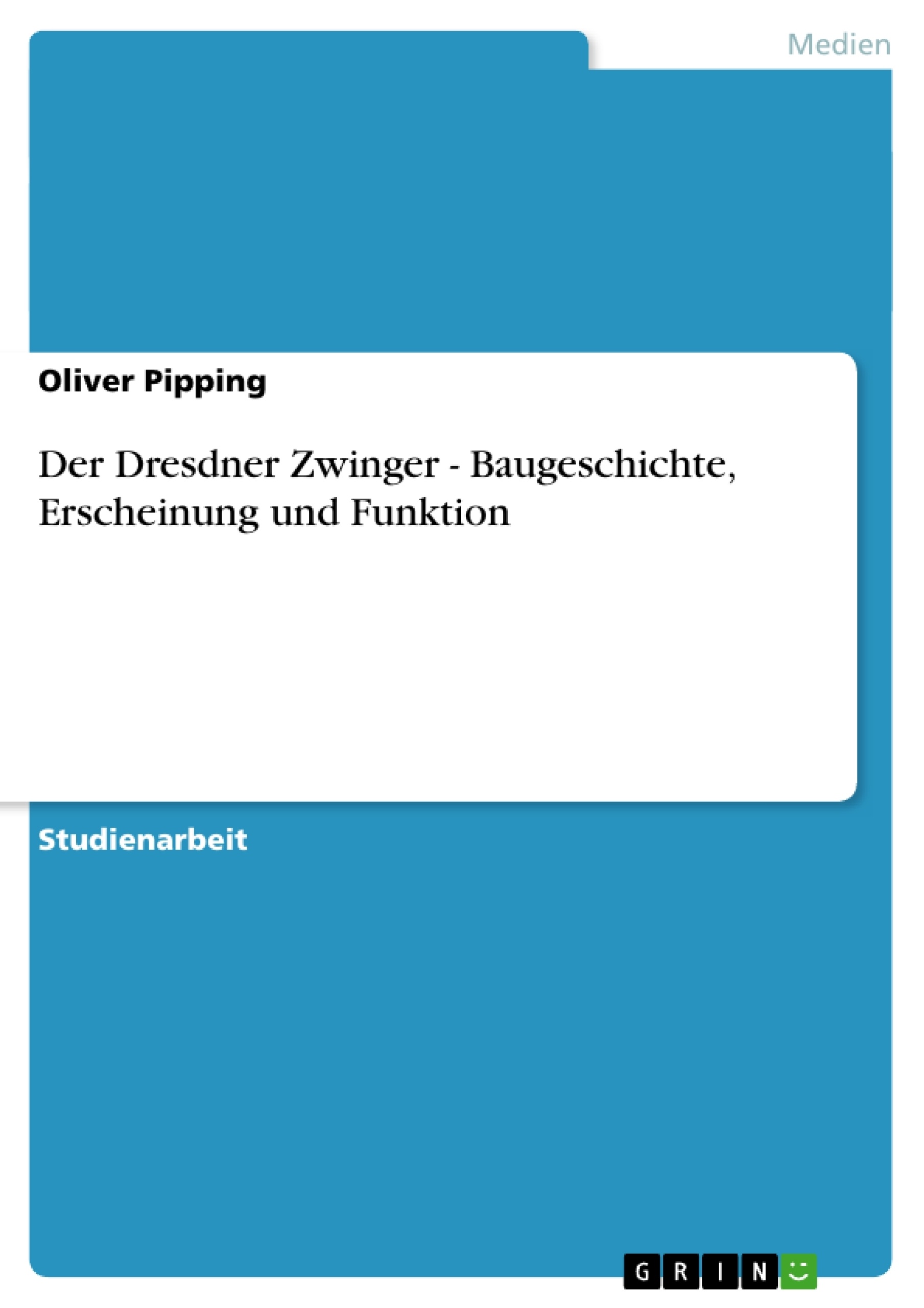Es handelt sich beim „Dresdner Zwinger“ um einen repräsentativen Festplatz der von Galerien und Pavillons umsäumt ist. Zu Zeiten August Friedrichs I diente er als theatralische Kulisse für prunkvolle Staatsempfänge und aufwendig gestaltete Festlichkeiten aller Art. Auch Wagenrennen und Militäraufmärsche wurden hier abgehalten. Der Dresdner Zwinger, der als Orangerie gedacht und angelegt war1, wurde von August Friedrich I in Auftrag gegeben. Als Baumeister ist mehrfach der damalige Hofarchitekt Matthes Daniel Pöppelmann bezeugt.2 Er stellte den Zwinger im Jahre 1719 nach einer Bauzeit von über 10 Jahren und zahlreichen Entwurfsänderungen offiziell fertig.3 Die tatsächliche Bauzeit des Zwingers dauerte allerdings wesentlich länger.4 Das Bauwerk kann wohl mit Recht als Höhepunkt des sächsischen Barocks angesehen werden.
Heute sind verschiedene Museen in den Zwingergebäuden untergebracht. So findet der Besucher hier die Porzellansammlung August Friedrichs I, den sogenannten Mathematisch-Physikalischen Salon und einen Teil des Naturkundemuseums. Im angrenzenden großen Semperbau befindet sich die Gemäldegalerie und die Rüstkammer.5
Inhaltsverzeichnis
- 1. Baubeschreibung
- 1.1. Einleitung
- 1.2. Standort
- 1.3. Was hat es mit dem Namen „Zwinger“ auf sich?
- 1.4. Überblick
- 1.5. Die Langgalerie mit dem Kronentor
- 1.6. Der Wallpavillon
- 1.7. Die Eckpavillons
- 2. Der Bauherr: August der Starke
- 3. Der Hofarchitekt: Matthes Daniel Pöppelmann
- 4. Der Zwinger einst und heute:
- 4.1. Die Baugeschichte des Zwingers
- 4.2. Die einstige Farbigkeit des Zwingers
- 4.3. Die Malerein in den Pavillons
- 4.4. Die Regie beim Zwingerbau
- 5. Versuch eines Schlusskommentars
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Dresdner Zwinger, einen repräsentativen Festplatz aus der Zeit des sächsischen Barock. Die Zielsetzung besteht darin, die Baugeschichte, den architektonischen Entwurf und die Bedeutung des Zwingers im Kontext der Dresdner Stadtentwicklung und der Regierungszeit August des Starken zu beleuchten.
- Architektur und Gestaltung des Dresdner Zwingers
- Die Baugeschichte und die beteiligten Akteure (August der Starke, Pöppelmann)
- Der Zwinger als repräsentativer Festplatz und seine Funktion
- Die Entwicklung des Zwingers von seiner ursprünglichen Funktion bis zur heutigen Nutzung
- Der Name "Zwinger" und seine historische Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Baubeschreibung: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Beschreibung des Dresdner Zwingers als repräsentativen Festplatz, umgeben von Galerien und Pavillons. Er diente August dem Starken als Kulisse für prunkvolle Veranstaltungen. Die Beschreibung umfasst den Standort, die Namensherkunft (bezogen auf die frühere Nutzung als Teil einer Befestigungsanlage), und einen Überblick über die Architektur, inklusive Langgalerie, Kronentor, Wallpavillon und Eckpavillons. Die Arbeit betont die Bedeutung des Zwingers als Höhepunkt sächsischer Barockarchitektur und seine heutige Funktion als Museumskomplex.
2. Der Bauherr: August der Starke: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle August des Starken als Bauherr des Zwingers. Es beleuchtet seine Motivationen für den Bau und seine Beteiligung am Gestaltungsprozess. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen dem monumentalen Bauwerk und dem repräsentativen Anspruch des sächsischen Kurfürsten und Königs von Polen. Der Abschnitt könnte die politische und kulturelle Bedeutung Augusts des Starken im Kontext des Zwingers darstellen.
3. Der Hofarchitekt: Matthes Daniel Pöppelmann: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Person und die Leistungen von Matthes Daniel Pöppelmann, dem Hofarchitekten, der den Zwinger entwarf und errichtete. Es wird auf seine Rolle bei der Gestaltung des Bauwerks eingegangen, möglicherweise unter Berücksichtigung seiner anderen Arbeiten und seines architektonischen Stils. Die Diskussion könnte die kreativen Entscheidungen Pöppelmanns und ihre Auswirkungen auf das Endergebnis des Zwingers untersuchen.
4. Der Zwinger einst und heute: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Zwingers, von seiner Bauphase bis zu seiner heutigen Nutzung als Museum. Es umfasst die Baugeschichte mit ihren Herausforderungen und Veränderungen, die ursprüngliche Farbigkeit des Gebäudes und die Malereien in den Pavillons. Ein weiterer Aspekt könnte die Organisation und Leitung des Bauvorhabens sein. Das Kapitel zeigt die Transformation des Zwingers von einem barocken Festplatz zu einem bedeutenden Kulturdenkmal.
Schlüsselwörter
Dresdner Zwinger, August der Starke, Matthes Daniel Pöppelmann, Barockarchitektur, Festplatz, Orangerie, Baugeschichte, Stadtentwicklung Dresden, repräsentative Architektur, Museumskomplex.
Häufig gestellte Fragen zum Dresdner Zwinger
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Dresdner Zwinger, einen repräsentativen Festplatz aus der Zeit des sächsischen Barock. Sie beleuchtet dessen Baugeschichte, architektonischen Entwurf und Bedeutung im Kontext der Dresdner Stadtentwicklung und der Regierungszeit August des Starken.
Welche Aspekte des Dresdner Zwingers werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Architektur und Gestaltung des Zwingers, seine Baugeschichte und die beteiligten Akteure (August der Starke, Pöppelmann), seine Funktion als repräsentativer Festplatz, seine Entwicklung von der ursprünglichen Funktion bis zur heutigen Nutzung, und die historische Bedeutung des Namens "Zwinger".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Baubeschreibung (inkl. Einleitung, Standort, Namensherkunft, Überblick, Langgalerie, Wallpavillon und Eckpavillons); 2. Der Bauherr: August der Starke; 3. Der Hofarchitekt: Matthes Daniel Pöppelmann; 4. Der Zwinger einst und heute (Baugeschichte, Farbigkeit, Malereien, Regie beim Bau); 5. Versuch eines Schlusskommentars.
Was wird im Kapitel zur Baubeschreibung behandelt?
Das Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des Zwingers als repräsentativer Festplatz mit Galerien und Pavillons. Es umfasst Standort, Namensherkunft, einen Architekturüberblick (Langgalerie, Kronentor, Wallpavillon, Eckpavillons) und betont die Bedeutung des Zwingers als Höhepunkt sächsischer Barockarchitektur und seine heutige Funktion als Museumskomplex.
Welche Rolle spielte August der Starke beim Bau des Zwingers?
Kapitel 2 widmet sich August dem Starken als Bauherr. Es beleuchtet seine Motivationen, seine Beteiligung am Gestaltungsprozess und die Verbindung zwischen dem Bauwerk und seinem repräsentativen Anspruch als sächsischer Kurfürst und König von Polen. Die politische und kulturelle Bedeutung Augusts im Kontext des Zwingers wird dargestellt.
Welche Bedeutung hatte Matthes Daniel Pöppelmann für den Zwinger?
Kapitel 3 konzentriert sich auf Pöppelmann, den Hofarchitekten. Es beschreibt seine Rolle bei der Gestaltung, berücksichtigt möglicherweise seine anderen Arbeiten und seinen architektonischen Stil, und untersucht seine kreativen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf den Zwinger.
Wie hat sich der Zwinger von seiner Erbauung bis heute verändert?
Kapitel 4 beleuchtet die Geschichte des Zwingers von der Bauphase bis zur heutigen Nutzung als Museum. Es umfasst die Baugeschichte, die ursprüngliche Farbigkeit, die Malereien in den Pavillons, und die Organisation des Bauvorhabens. Die Transformation vom barocken Festplatz zum Kulturdenkmal wird gezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dresdner Zwinger, August der Starke, Matthes Daniel Pöppelmann, Barockarchitektur, Festplatz, Orangerie, Baugeschichte, Stadtentwicklung Dresden, repräsentative Architektur, Museumskomplex.
- Quote paper
- Oliver Pipping (Author), 2003, Der Dresdner Zwinger - Baugeschichte, Erscheinung und Funktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19320