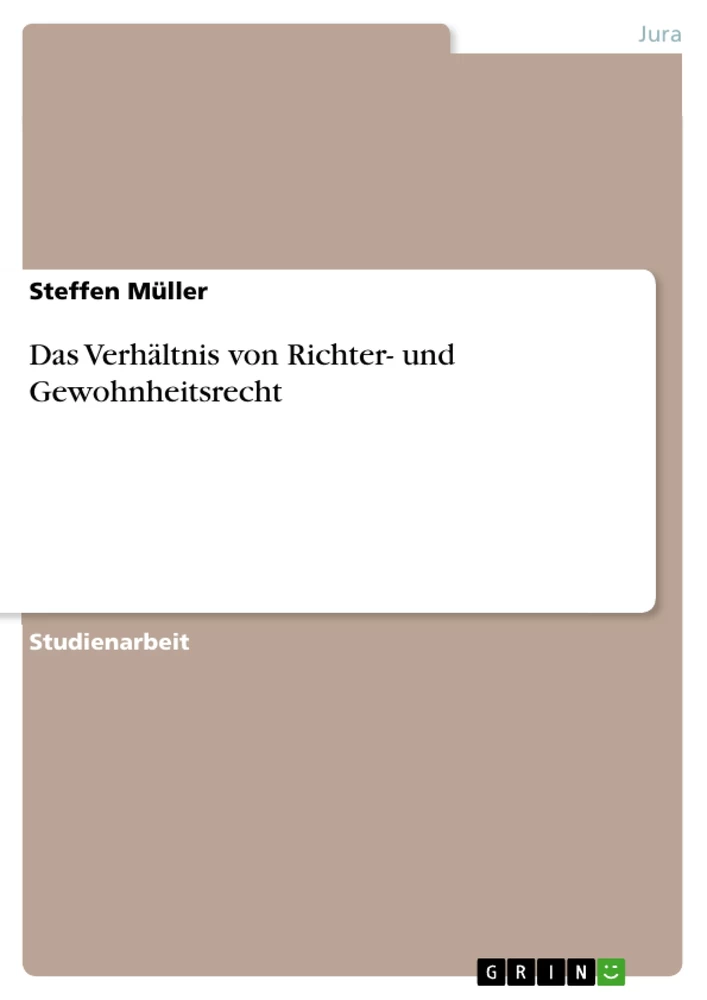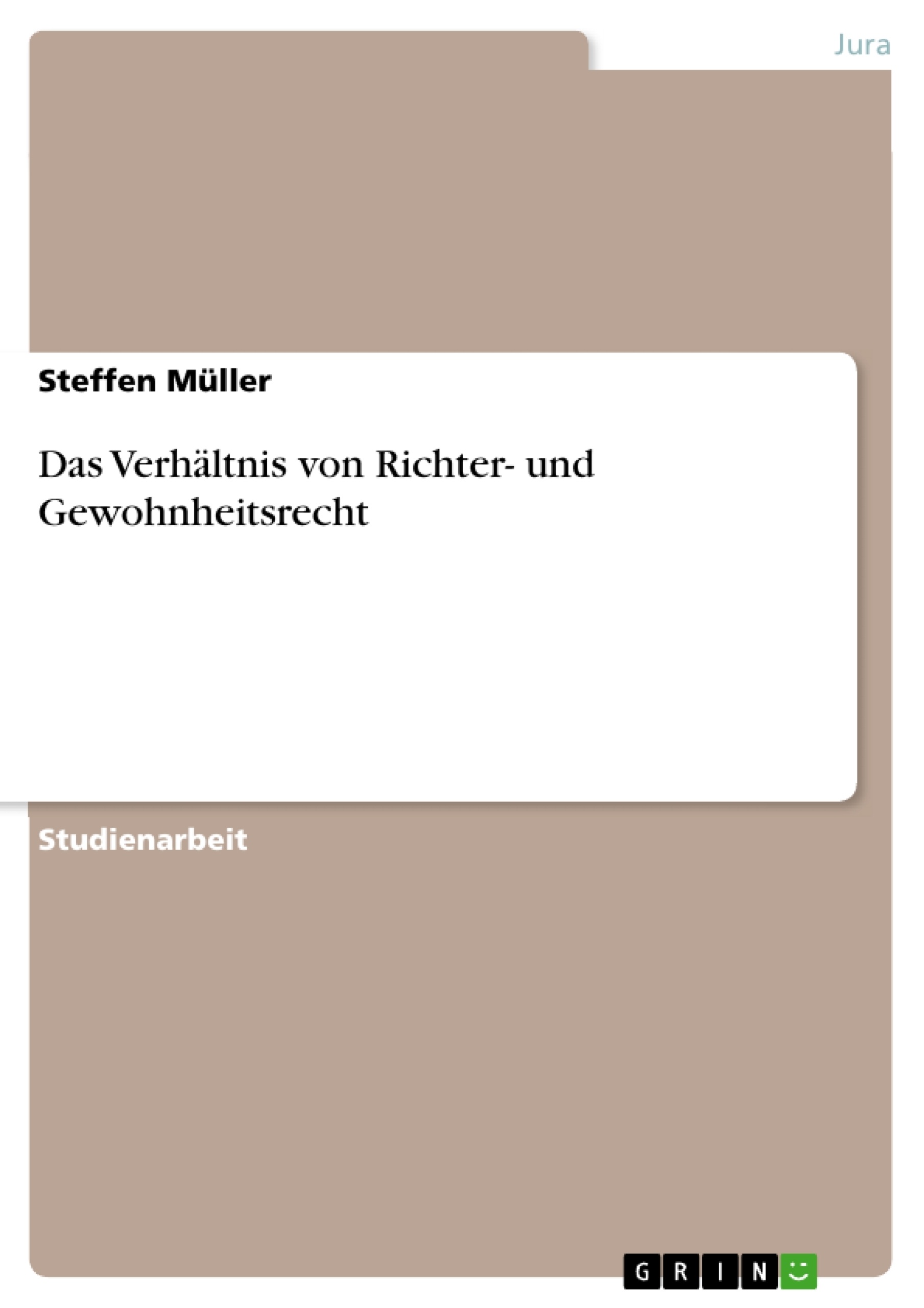Die folgende Arbeit soll sich mit der Untersuchung des Verhältnisses von Richter- und Gewohnheitsrecht befassen. Beiden Begriffen begegnet man in der Literatur immer wieder. Eine einheitliche Definition lässt sich jedoch nur beim Gewohnheitsrecht ausmachen. Ein Versuch das Richterrecht genau zu erfassen gestaltet sich hingegen als schwierig. Dennoch soll auf den nächsten Seiten eine Arbeitsdefinition beider Begriffe geschaffen werden. Auf diese Grundlage aufbauend soll im Anschluss auf das Verhältnis der beiden Termini eingegangen werden. Einleitend lässt sich sagen, dass das Verhältnis von Richter- und Gewohnheitsrecht sehr umstritten ist. So wird dem Richterrecht zum Teil die gleiche Qualität wie dem des Gewohnheitsrechts, also der einer Rechtsquelle zugesprochen. Einer anderen Auffassung nach ist das Richterrecht jedoch eine eigenständige Kategorie ohne Rechtsquellenqualität. Beide Ansichten haben allerdings zum Ausgangspunkt, dass das Richterrecht aus einer Situation heraus handelt, die entweder keine gesetzliche Regelung erfahren hat oder sich unzureichend an bereits bestehenden Normen orientiert, die dem Einzelfall nicht mehr genügen. Gleichwohl ein Vergleich von Richter- und Gewohnheitsrecht sich nicht als einfach gestaltet, soll durch diese Arbeit eine ausdifferenzierte Betrachtung beider Begriffe ermöglicht werden, um anschließend eventuelle Zusammenhänge aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rechtsfortbildung
- 3. Rechtsquelle
- 4. Gewohnheitsrecht
- 5. Richterrecht
- 6. Richterrecht als Rechtsquelle
- 6. a) Herrschende Meinung
- 6. b) Gegenposition
- 7. Richterrecht und Gewohnheitsrecht
- 8. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Richter- und Gewohnheitsrecht und analysiert die umstrittene Frage, ob Richterrecht unter bestimmten Voraussetzungen als Rechtsquelle gelten kann.
- Rechtsfortbildung und die Rolle von Gerichtsurteilen bei der Entwicklung des Rechts
- Definition und Merkmale des Gewohnheitsrechts als anerkannte Rechtsquelle
- Definition und Diskussion der Rechtsquellenqualität des Richterrechts
- Vergleich und Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Richter- und Gewohnheitsrecht
- Bewertung der Argumentation für und gegen die Anerkennung des Richterrechts als Rechtsquelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Rechtsfortbildung
- Kapitel 3: Rechtsquelle
- Kapitel 4: Gewohnheitsrecht
- Kapitel 5: Richterrecht
- Kapitel 6: Richterrecht als Rechtsquelle
- Kapitel 7: Richterrecht und Gewohnheitsrecht
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die unterschiedlichen Ansichten über die Rechtsquellenqualität von Richterrecht. Sie zeigt die Bedeutung des Themas auf und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
Dieses Kapitel behandelt die Befugnis von Richtern, das Recht fortzuentwickeln. Es werden die rechtlichen Grundlagen der Rechtsfortbildung und die Rolle von Gerichtsurteilen bei der Lückenfüllung und der Abänderung des Gesetzes beleuchtet.
Kapitel 3 definiert den Begriff der Rechtsquelle und stellt die verschiedenen Formen und Urheber von Rechtssätzen vor. Der Fokus liegt auf der umstrittenen Frage, ob Richterrecht unter bestimmten Voraussetzungen als Rechtsquelle gelten kann.
Dieses Kapitel erläutert die Definition und die Merkmale des Gewohnheitsrechts als anerkannte Rechtsquelle. Es beschreibt die Entstehung von Gewohnheitsrecht durch langjährige Übung und allgemeine Überzeugung von seiner Rechtsverbindlichkeit.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Begriff des Richterrechts und den Schwierigkeiten, eine präzise Definition zu finden. Es werden unterschiedliche Ansichten zu den Eigenschaften und der Funktion des Richterrechts dargestellt.
Dieses Kapitel analysiert die Argumentation für und gegen die Anerkennung des Richterrechts als Rechtsquelle. Es werden die herrschende Meinung und die Gegenposition dargestellt und kritisch beleuchtet.
In diesem Kapitel werden Richterrecht und Gewohnheitsrecht verglichen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Es werden die Beziehungen und Spannungsfelder zwischen den beiden Rechtsformen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Rechtsfortbildung, Rechtsquelle, Gewohnheitsrecht, Richterrecht, Rechtsquellenqualität, Rechtsprechung und Rechtsentwicklung. Sie beschäftigt sich mit der umstrittenen Frage, ob Richterrecht als Rechtsquelle anerkannt werden kann und welche Auswirkungen dies auf die Rechtsordnung hat.
- Quote paper
- B.A. Steffen Müller (Author), 2012, Das Verhältnis von Richter- und Gewohnheitsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193170