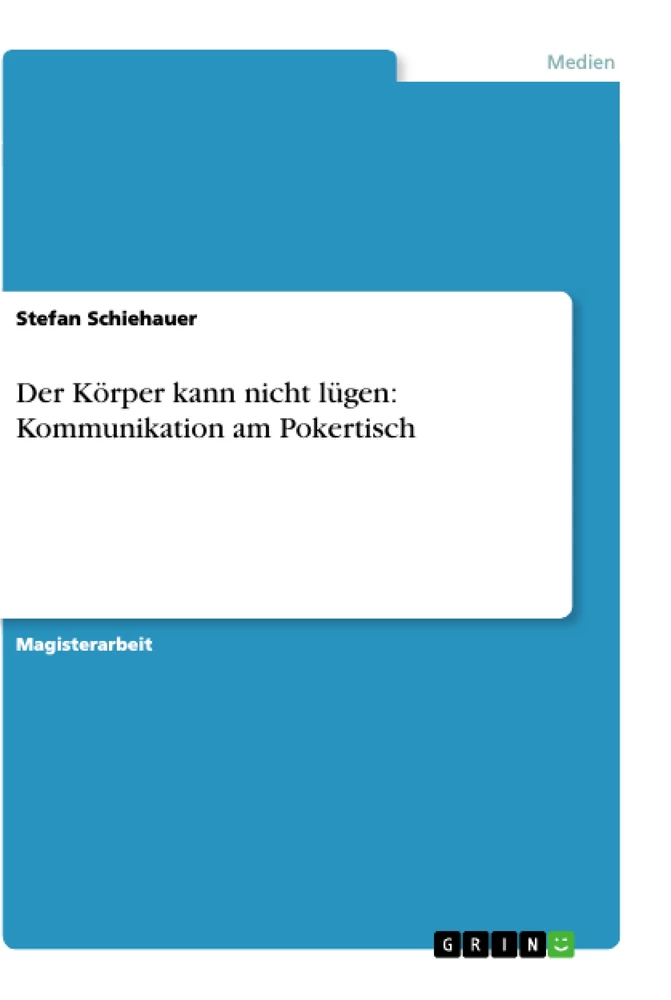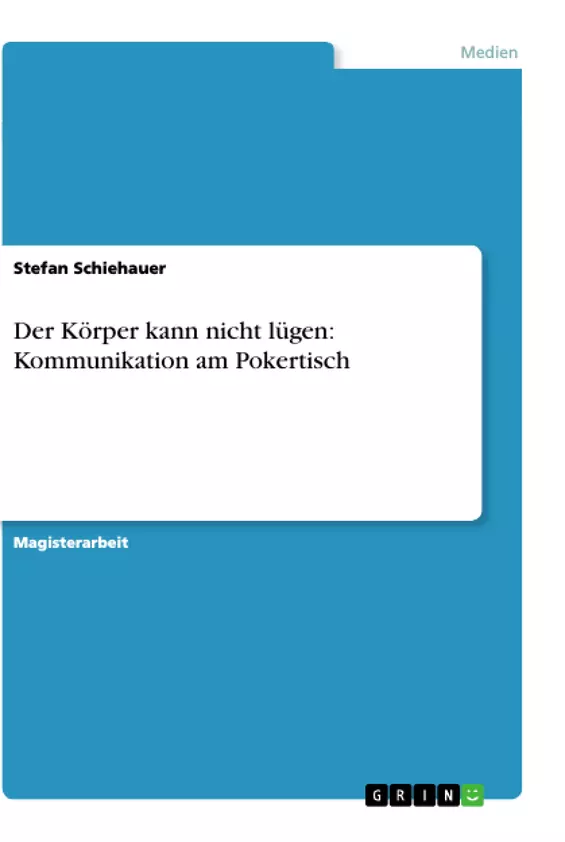In der Arbeit dreht sich alles um die interpersonelle Kommunikation am Pokertisch. Bei kaum einem anderen Spiel ist die nonverbale Kommunikation, in diesem Fall die Beherrschung der eigenen Körpersprache bzw. die Fähigkeit die Körpersprache der Gegenspieler richtig zu "lesen", von größerer Bedeutung als beim Poker. Diese "Kommunikations-Notwendigkeit" bzw. "Kommunikations-Präsenz" wird im ersten Teil der Magisterarbeit (Auseinandersetzung mit nonverbaler Kommunikation, Semiotik, Pokergrundlagen) aufgezeigt und mithilfe der Analyse eines Pokerturniers (anhand eines zuvor angefertigten Kategorienschemas) und Experteninterviews im zweiten Teil empirisch untermauert. Die Ergebnisse können als durchaus überraschend angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Forschungsfragen
- I. KOMMUNIKATION
- 2 Definitionen von Kommunikation
- 3 Nonverbale Kommunikation
- 3.1 Körpersprache
- 3.2 Nonverbal vs. Verbal
- 3.3 Dimensionen der nonverbalen Kommunikation
- 3.4 Systematisierung
- 3.5 Wirkung und Manipulation
- 3.6 Nonverbale Kommunikation in der Tierwelt
- 4 Körpersignale des Menschen
- 4.1 Wahrnehmungen
- 4.2 Gesicht, Emotionen und Mimik
- 4.2.1 Stirnbereich
- 4.2.2 Mittelgesicht
- 4.2.2.1 Die Augen
- 4.2.2.2 Die Nase
- 4.2.3 Mund- und Kinnpartie
- 4.3 Der Hals
- 4.4 Hände und Finger
- 4.5 Körperbewegungen
- 4.6 Nonverbale Vokalisierungen
- 5 Semiotik
- 5.1 Einführung
- 5.2 Historische Entwicklung
- 5.3 Peirce und de Saussure
- 5.4 Semiosphäre
- II. POKER
- 6 Geschichte
- 6.1 Vorläufer und Verbreitung
- 6.2 Europa und der Rest der Welt
- 6.3 Online-Poker
- 7 Basiswissen
- 7.1 Regelkunde
- 7.2 Fachbegriffe
- 7.3 Verschiedene Pokervarianten
- 7.3.1 (No) Limit Texas Hold'em
- 7.3.2 Omaha Hold'em
- 7.3.3 Seven Card Stud
- 7.3.4 Five Card Draw
- 7.4 Kartenkombinationen
- 8 Kommunikation am Pokertisch
- 8.1 Der,,Psychologie\"-Faktor
- 8.2 Bluffs
- 8.3 Tells
- 8.3.1 Top-Tells
- 8.3.2 Allgemeine Tells
- 8.3.3 Noncombat Tells
- 8.3.4 Online-Tells
- 8.4 Betting Patterns
- III. EMPIRISCHER TEIL
- 9 TV Total Pokernacht
- 9.1 Teilnehmer
- 9.2 Künstlerische und technische Faktoren
- 10 Methode
- 10.1 Beobachtung
- 10.1.1 Elemente der Beobachtung
- 10.1.2 Formen der Beobachtung
- Die Analyse von nonverbalen Kommunikationsformen am Pokertisch
- Die Rolle von Körpersprache und Mimik im Kontext von Bluffs und Tells
- Die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation für die Spielerpsychologie
- Der Einfluss von nonverbalen Signalen auf das Spielverhalten und die Gewinnchancen
- Die Untersuchung von Beispielen aus der Praxis, insbesondere aus dem Fernsehformat "TV Total Pokernacht"
- Kapitel 1: Die Einführung führt in die Thematik ein, erläutert die Forschungsfragen und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen von Kommunikation und stellt die unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven dar.
- Kapitel 3: Es werden die wichtigsten Aspekte der nonverbalen Kommunikation beleuchtet, einschließlich Körpersprache, nonverbaler Vokalisierungen und deren Bedeutung in verschiedenen Kontexten.
- Kapitel 4: Das Kapitel widmet sich der Analyse spezifischer Körpersignale beim Menschen und deren Interpretation, wobei der Fokus auf Gesichtsausdrücke, Körpersprache und Gesten liegt.
- Kapitel 5: Die Semiotik als wissenschaftliche Disziplin wird vorgestellt. Es werden historische Entwicklungen, wichtige Vertreter wie Peirce und de Saussure sowie die Bedeutung der Semiosphäre diskutiert.
- Kapitel 6: Die Geschichte des Pokers wird skizziert, wobei verschiedene Entwicklungsphasen und Verbreitungsmuster beleuchtet werden.
- Kapitel 7: Das Basiswissen rund um das Pokerspiel wird vermittelt, einschließlich der Regeln, Fachbegriffe und verschiedener Pokervarianten.
- Kapitel 8: Die spezifische Bedeutung der Kommunikation am Pokertisch wird untersucht. Themen sind Bluffs, Tells und die psychologischen Faktoren, die das Spiel beeinflussen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der nonverbalen Kommunikation im Kontext des Pokerspiels. Das Ziel ist es, die Bedeutung von Körpersprache und nonverbalen Signalen am Pokertisch zu beleuchten und deren Einfluss auf das Spielgeschehen zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Mimik, Poker, Bluffs, Tells, Spielpsychologie, Spielverhalten, Gewinnchancen, Semiotik, TV Total Pokernacht.
- Arbeit zitieren
- Stefan Schiehauer (Autor:in), 2011, Der Körper kann nicht lügen: Kommunikation am Pokertisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192818