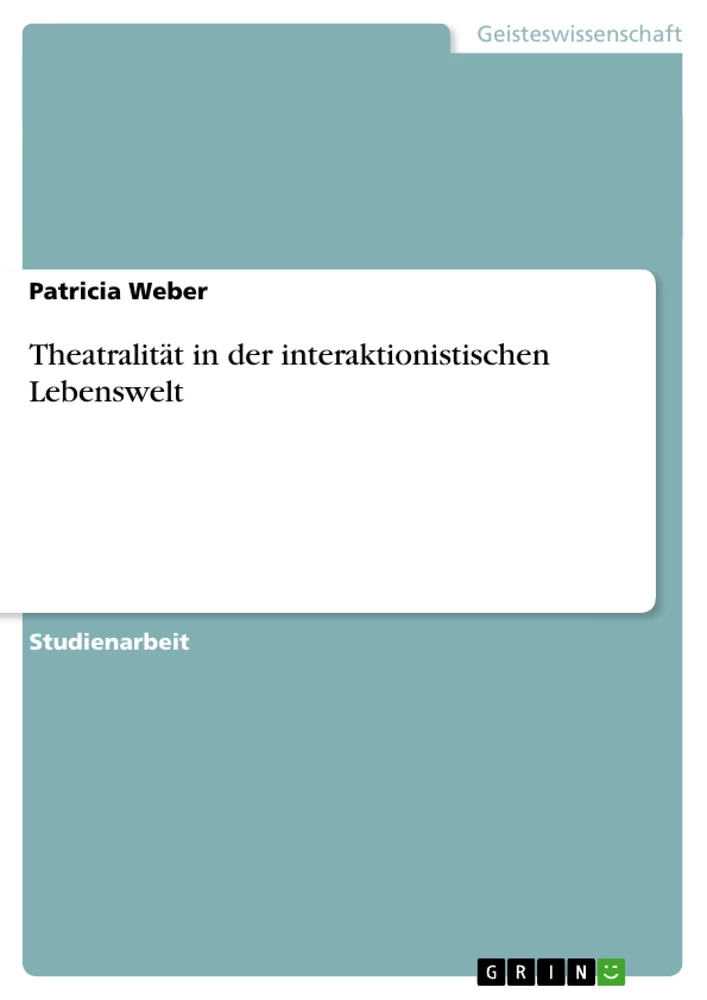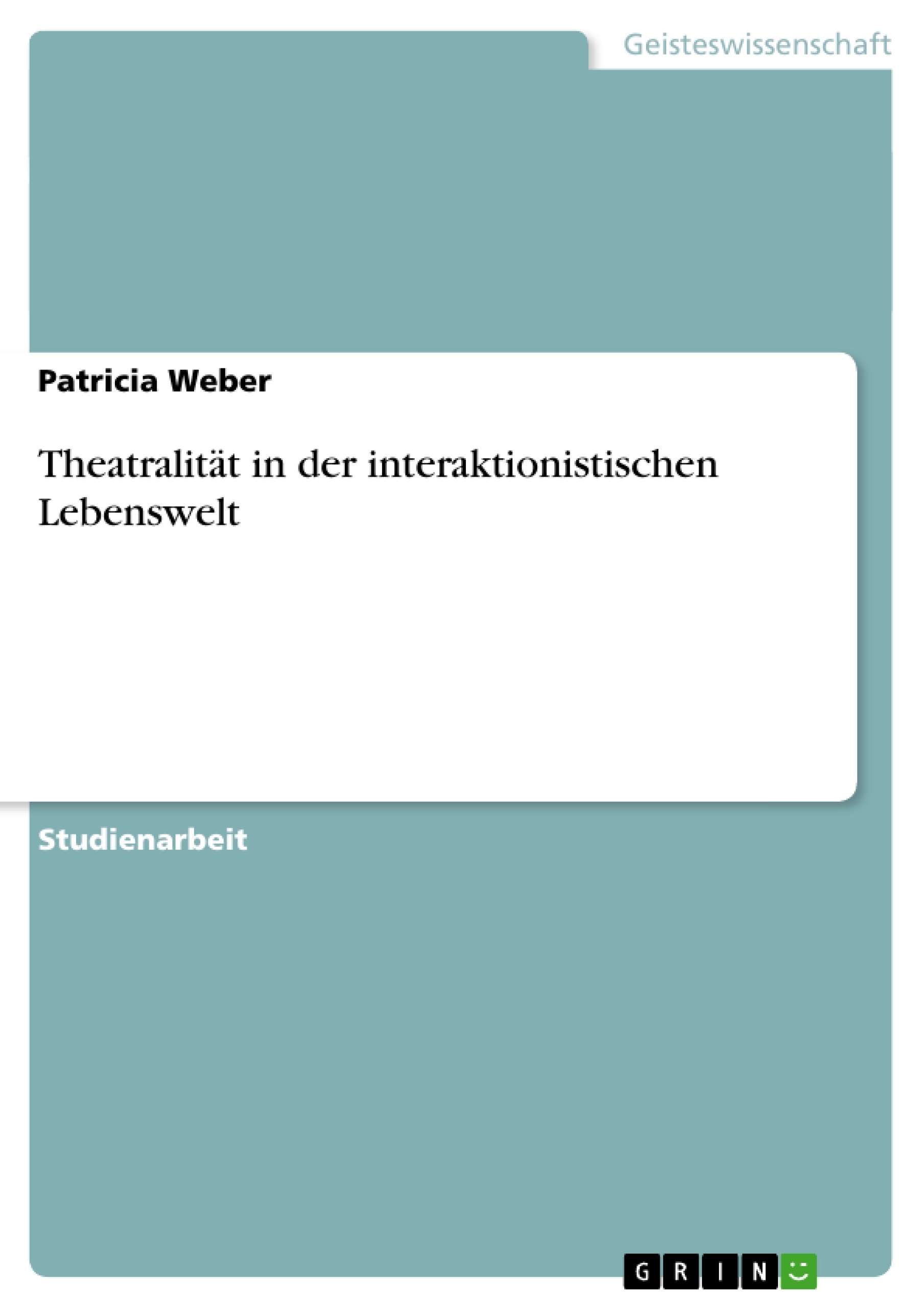„All the world’s a stage, and all the men and women merely player“1. Nach diesem berühmten Zitat aus Shakespears Komödie „As you like it“ ist unser ganzes Leben eine Bühne, auf der wir unsere Rolle spielen. Shakespeare schrieb bereits um 1600, dass sich Vorgänge im Theater auf den Alltag übertragen lassen. Theatralität2 bestimmt unser Leben, wir spielen Rollen, stellen unsere Identität dar und setzen unseren Körper als Ausdrucksinstrument ein, um spezifische Eindrücke zu vermitteln. Die Sprache des Theater ist tief in anthropogische
und soziologische Diskurse eingedrungen. Die Rede ist von der Kultur der Inszenierung,3 der Dramaturgie des Alltags bis hin zur Inszenierungsgesellschaft.4 Die vorliegende Arbeit ergründet, warum wir von theatralen Prozessen im Alltag sprechen,wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede im inszenierenden Verhalten auf der Bühne und in
Interaktionen liegen. Anhand der Theatermetaphorik von dem amerikanischen Soziologen Erving Goffman wird unser Alltag beleuchtet, gezeigt wie unser Verhalten entsprechend unserer eingenommenen Rolle oft unbewusst inszeniert ist. Am Ende sollte die Arbeit die Frage: „Wie und warum stellen wir uns permanent in der interaktionistischen Lebenswelt selbst dar?“ beantwortet haben, und ebenso den körperlichen Aspekt bezüglich der Selbstdarstellung beleuchten.
1 Shakespear, William: As you like it, in: Delius, Nicolaus: Shakspere’s Werke. Sechster Band, Elberfeld, 1860, S. 52.
2 Kursiv geschriebene Wörter stammen nicht aus dem Vokabular des Autors. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich hierbei um
theoretische Begriffe auf dessen direktes Zitieren verzichtet wurde. Alle Quellen befinden sich jedoch in den Fußnoten.
3 Vgl. hierzu Fischer-Lichte, Erika /Horn, Christian/Warstat, Matthias: Verkörperung, a.a.O., 2001.
4 Vgl. hierzu bspw. Willems, Herbert/Jurga, Martin: Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch, Opladen u.a., 1998.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theatrale Körper im Theater und Alltag
- 2.1 Körperkonzepte des semiotischen und phänomenalen Körpers
- 2.2 Die Wirkung von Zeichen und Körper
- 3. Goffmans Welt des Theaters
- 3.1 Einführung in Goffmans dramaturgische, interaktionistische Perspektive
- 3.2 Vorder-und Hinterbühne, Ensemble und Publikum
- 3.3 Rolle und Rollendistanz
- 3.4 Reflexion Goffmans Theater-Metaphorik
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die theatralen Prozesse im Alltag und vergleicht diese mit theatralem Verhalten auf der Bühne. Sie beleuchtet, wie unser Verhalten, entsprechend unserer Rollen, oft unbewusst inszeniert ist, und beantwortet die Frage, wie und warum wir uns permanent in der interaktionistischen Lebenswelt selbst darstellen, insbesondere unter Berücksichtigung des körperlichen Aspekts dieser Selbstdarstellung. Die Arbeit nutzt die Theatermetaphorik Erving Goffmans zur Analyse.
- Theatralität im Alltag und auf der Bühne
- Körperkonzepte im Theater (semiotischer und phänomenaler Körper)
- Goffmans dramaturgische Perspektive und die Inszenierung des Selbst
- Rollenverhalten und Identität
- Der Körper als Ausdrucksinstrument
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Theatralität im Alltag ein und verweist auf Shakespeares Zitat „All the world's a stage“. Sie beschreibt die Bedeutung des Körpers als Ausdrucksinstrument und die Einbettung der Theatermetaphorik in soziologische Diskurse. Die Arbeit stellt ihre Zielsetzung vor: die Ergründung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen inszenierendem Verhalten auf der Bühne und im Alltag anhand von Goffmans Theatermetaphorik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit in zwei Kapitel, wobei das erste Kapitel Körperkonzepte und die Begriffsdefinitionen von Theatralität und Inszenierung beleuchtet, während das zweite Kapitel Goffmans dramaturgisch-interaktionistische Perspektive im Detail analysiert. Die Identitätstheorie Helmuth Plessners wird als theoretischer Rahmen herangezogen.
2. Theatrale Körper im Theater und Alltag: Dieses Kapitel untersucht die Körperkonzepte des semiotischen und phänomenalen Körpers, beginnend mit der historischen Entwicklung des Begriffs "Verkörperung" im Schauspiel. Es erläutert Erika Fischer-Lichtes Unterscheidung zwischen dem semiotischen Körper (Zeichenkörper) und dem phänomenalen Körper (eigener Körper des Schauspielers) und wie diese im Zusammenspiel die Wirkung auf das Publikum erzeugen. Der phänomenale Körper bleibt dabei als Grundlage und Bedeutungsträger erhalten. Der Abschnitt analysiert die Wirkung von Zeichen und Körpern, wie Gesten, Mimik und Proxemik, sowohl im Theater als auch im Alltag und wie diese Empfindungen beim Zuschauer/Interaktionspartner hervorrufen. Es wird betont, dass die Zeichenhaftigkeit des Körpers in jeder Interaktion eine Rolle spielt und Teil der alltäglichen Inszenierung ist.
Schlüsselwörter
Theatralität, Körper, Inszenierung, Identität, Goffman, Interaktion, Rolle, Rollendistanz, semiotischer Körper, phänomenaler Körper, Selbstdarstellung, Alltag, Bühne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theatralität im Alltag und auf der Bühne
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die theatralen Prozesse im Alltag und vergleicht diese mit theatralem Verhalten auf der Bühne. Sie beleuchtet, wie unser Verhalten, entsprechend unserer Rollen, oft unbewusst inszeniert ist, und beantwortet die Frage, wie und warum wir uns permanent in der interaktionistischen Lebenswelt selbst darstellen, insbesondere unter Berücksichtigung des körperlichen Aspekts dieser Selbstdarstellung. Die Arbeit nutzt die Theatermetaphorik Erving Goffmans zur Analyse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Theatralität im Alltag und auf der Bühne; Körperkonzepte im Theater (semiotischer und phänomenaler Körper); Goffmans dramaturgische Perspektive und die Inszenierung des Selbst; Rollenverhalten und Identität; Der Körper als Ausdrucksinstrument.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theatermetaphorik Erving Goffmans und die Identitätstheorie Helmuth Plessners. Sie analysiert die Konzepte des semiotischen und phänomenalen Körpers nach Erika Fischer-Lichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über theatrale Körper im Theater und Alltag, und einem Fazit. Das erste Kapitel behandelt Körperkonzepte und Begriffsdefinitionen von Theatralität und Inszenierung. Das zweite Kapitel analysiert detailliert Goffmans dramaturgisch-interaktionistische Perspektive.
Was wird im Kapitel "Theatrale Körper im Theater und Alltag" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Körperkonzepte des semiotischen und phänomenalen Körpers, beginnend mit der historischen Entwicklung des Begriffs "Verkörperung" im Schauspiel. Es erläutert die Unterscheidung zwischen dem Zeichenkörper und dem eigenen Körper des Schauspielers und wie diese die Wirkung auf das Publikum erzeugen. Der Abschnitt analysiert die Wirkung von Zeichen wie Gesten, Mimik und Proxemik im Theater und Alltag.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theatralität, Körper, Inszenierung, Identität, Goffman, Interaktion, Rolle, Rollendistanz, semiotischer Körper, phänomenaler Körper, Selbstdarstellung, Alltag, Bühne.
Welche Zitate werden verwendet?
Ein zentrales Zitat ist Shakespeares „All the world's a stage“, welches die Thematik der Theatralität im Alltag einführt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in den bereitgestellten Informationen enthalten und müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Quote paper
- Patricia Weber (Author), 2010, Theatralität in der interaktionistischen Lebenswelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192812