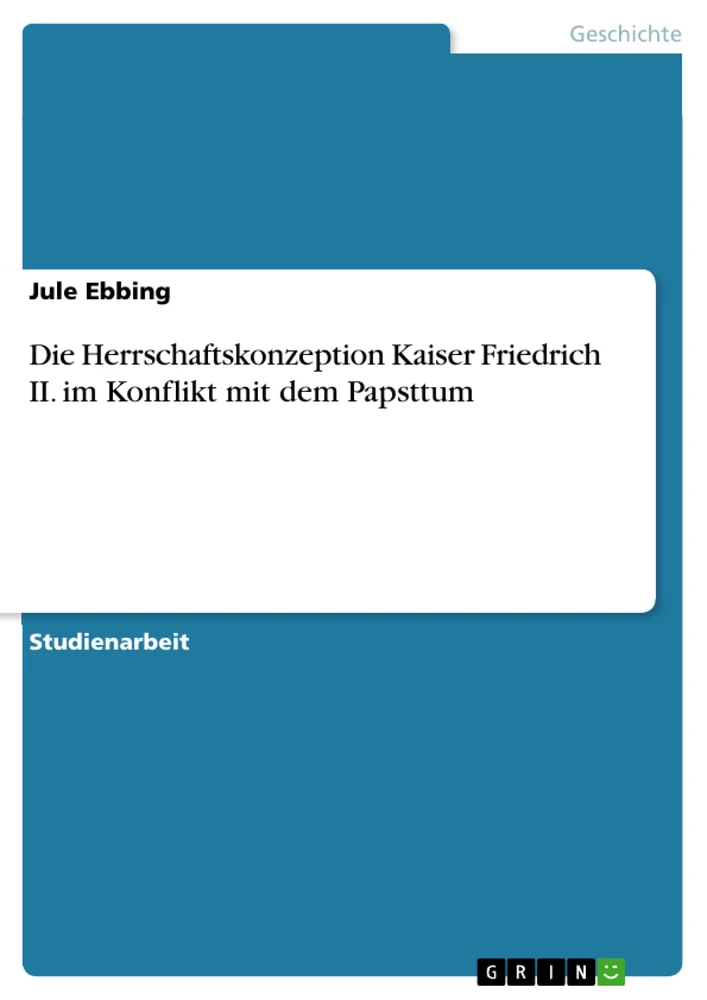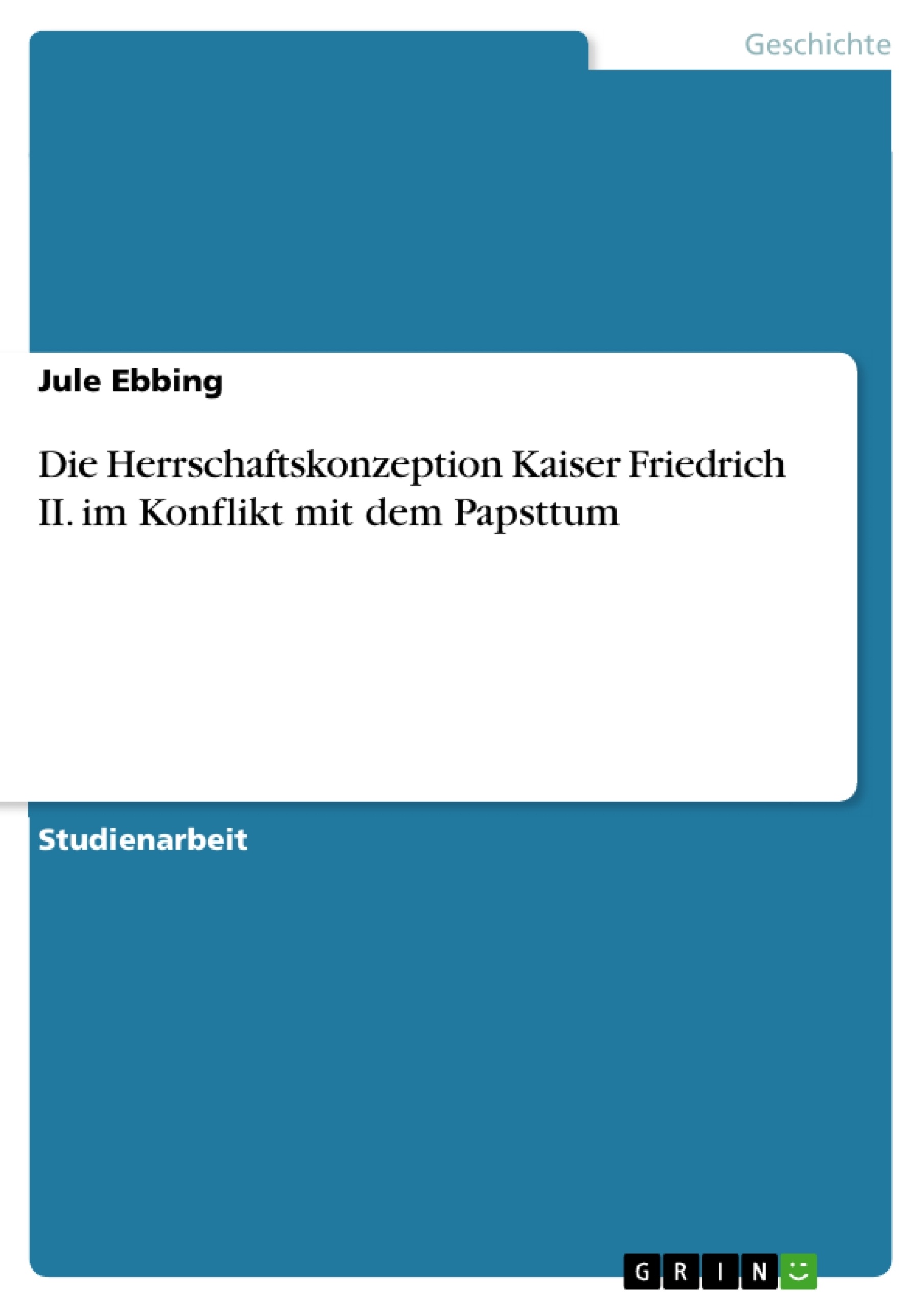Den größten Teil seiner Herrschaft verbrachte Friedrich in der ständigen Auseinandersetzung mit der Kurie. Am Proömium der Liber Augustalis lassen sich die Differenzen zwischen den kaiserlichen Überzeugungen und den vom Papsttum vertretenen Herrschaftstheorien aufzeigen.
Im Verlaufe dieser Arbeit sollen die disparaten Auffassungen von Krone und Kurie dargestellt und die wesentlichen Konfliktlinien nachgezeichnet werden. Zudem soll geklärt werden, aus welcher Tradition sich die jeweiligen Dogmen entwickelt haben.
Grundlage der Untersuchungen bilden die Konstitutionen und weiteren Quellen in Form von Briefen und Berichten aus der Zeit Friedrich II.. Neben der vorrangigen Quellenarbeit helfen die Biographien Friedrich II. von Hubert Houben aus dem Jahr 2008, Wolfgang Stürner, 1992 und Herbert Nette, 1975 die chronologischen Abläufe nachzuvollziehen.
Um eine Überblick über die Entwicklung des päpstlich-kaiserlichen Verhältnisses zu geben und die zeitliche Einordnung zu gewährleisten, wird zunächst die Chronologie der Ereignisse bis zur Veröffentlichung der Konstitutionen dargestellt, um darauffolgend das herrscherliche Selbstverständnis Friedrichs anhand des Proömiums der Konstitutionen nachzuvollziehen. Im Anschluss an die Vorstellung des päpstlichen Verständnisses vom Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft folgt abschließend die Nachzeichnung und Auswertung des Konfliktes im Rahmen der zweiten Exkommunikation des Kaisers.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses seit Friedrichs Kaiserkrönung
- Das Herrschaftsverständnis im Proömium der Konstitutionen von Melfi
- Die Schöpfungsgeschichte als Legitimation kaiserlicher Herrschaft
- Der Kaiser als Gesetzgeber
- Der Kaiser als Schirmherr der römischen Kirche
- Geistliche und weltliche Herrschaft aus päpstlicher Sicht
- Die Zwei-Schwerter-Lehre der Kurie und das Sonne/Mond-Gleichnis
- Die Reaktion Gregor IX. auf die Konstitutionen von Melfi
- Friedrichs herrscherliches Selbstverständnis im Konflikt mit Gregor IX.
- Die zweite Exkommunikation Friedrichs
- Friedrichs Reaktion und der Beginn des „Endkampfes”
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papsttum, indem sie die gegensätzlichen Herrschaftskonzepte beider Seiten analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der disparaten Auffassungen und der Nachzeichnung der zentralen Konfliktlinien. Die Arbeit beleuchtet auch die historischen Wurzeln der jeweiligen Dogmen.
- Kaiser Friedrichs II. Herrschaftsverständnis und seine Legitimation.
- Das päpstliche Verständnis von geistlicher und weltlicher Herrschaft.
- Der Konflikt um die Macht in Süditalien.
- Die Rolle der Konstitutionen von Melfi.
- Die Exkommunikation Friedrichs II. und ihre Folgen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Konstitutionen von Melfi als zentrale Quelle für Friedrichs II. Herrschaftsverständnis vor. Sie beschreibt den Konflikt zwischen Kaiser und Papsttum als den Hauptfokus der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz.
Die Entwicklung des kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses seit Friedrichs Kaiserkrönung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Beziehung zwischen Kaiser und Papst von Friedrichs Kaiserkrönung 1220 bis zu seiner ersten Exkommunikation. Es beleuchtet Friedrichs Bestreben, das Königreich Sizilien mit dem Deutschen Reich zu vereinigen, und die damit verbundenen Zugeständnisse des Papstes Honorius III. Die Verhandlungen um den Kreuzzug und die sich verschärfenden Konflikte werden detailliert dargestellt. Die Kapitel zeigt, wie Friedrichs Handlungen in Sizilien, insbesondere die Untergrabung der Macht des Klerus, zu wachsenden Spannungen führten, die letztendlich zur Exkommunikation führten.
Das Herrschaftsverständnis im Proömium der Konstitutionen von Melfi: Dieses Kapitel analysiert das Proömium der Konstitutionen von Melfi als Ausdruck von Friedrichs Herrschaftsverständnis. Es untersucht, wie Friedrich seine Herrschaft durch die Schöpfungsgeschichte legitimiert, seine Rolle als Gesetzgeber betont und sich selbst als Schirmherr der römischen Kirche darstellt. Die Analyse zeigt, wie Friedrichs Vorstellung von der kaiserlichen Macht im Widerspruch zum päpstlichen Verständnis stand.
Geistliche und weltliche Herrschaft aus päpstlicher Sicht: Dieses Kapitel präsentiert die päpstliche Perspektive auf das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Herrschaft. Es erläutert die Zwei-Schwerter-Lehre und das Sonne/Mond-Gleichnis als zentrale Elemente der päpstlichen Argumentation und analysiert die Reaktion Gregors IX. auf die Konstitutionen von Melfi als direkte Konfrontation mit Friedrichs Herrschaftsanspruch. Das Kapitel verdeutlicht die tiefgreifenden Unterschiede in der Auffassung von Macht und Autorität zwischen Kaiser und Papst.
Friedrichs herrscherliches Selbstverständnis im Konflikt mit Gregor IX.: Das Kapitel konzentriert sich auf den Konflikt zwischen Friedrich II. und Gregor IX., der in der zweiten Exkommunikation des Kaisers gipfelte. Es beleuchtet Friedrichs Reaktion auf die Exkommunikation und den Beginn des "Endkampfes". Die Analyse zeigt, wie die unterschiedlichen Herrschaftsverständnisse zu einer Eskalation des Konflikts führten und wie beide Seiten ihre Machtpositionen zu verteidigen suchten.
Schlüsselwörter
Kaiser Friedrich II., Papsttum, Herrschaftskonzepte, Konstitutionen von Melfi, Zwei-Schwerter-Lehre, Exkommunikation, Süditalien, Kreuzzug, Reichskirche, mittelalterliche Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kaiser Friedrich II. und das Papsttum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papsttum im Mittelalter. Der Fokus liegt auf den gegensätzlichen Herrschaftskonzepten beider Seiten und den zentralen Konfliktlinien. Die Arbeit untersucht auch die historischen Wurzeln der jeweiligen Dogmen und nutzt die Konstitutionen von Melfi als zentrale Quelle.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Friedrichs II. Herrschaftsverständnis und seine Legitimation, das päpstliche Verständnis von geistlicher und weltlicher Herrschaft, den Konflikt um die Macht in Süditalien, die Rolle der Konstitutionen von Melfi, die Exkommunikation Friedrichs II. und ihre Folgen, sowie die Entwicklung des kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses seit Friedrichs Kaiserkrönung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Konstitutionen von Melfi bilden eine zentrale Quelle für das Verständnis von Friedrichs II. Herrschaftsverständnis. Die Arbeit bezieht sich außerdem auf die Entwicklung des kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses seit Friedrichs Kaiserkrönung und analysiert die päpstliche Perspektive auf die Zwei-Schwerter-Lehre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Resümee. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der Entwicklung des kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses, Friedrichs Herrschaftsverständnis im Kontext der Konstitutionen von Melfi, der päpstlichen Sicht auf geistliche und weltliche Herrschaft, dem Konflikt zwischen Friedrich II. und Gregor IX., inklusive der Exkommunikation, und schließlich einem zusammenfassenden Resümee.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papsttum durch die Analyse der gegensätzlichen Herrschaftskonzepte beider Seiten zu untersuchen und die zentralen Konfliktlinien nachzuzeichnen. Die disparaten Auffassungen beider Seiten werden dargestellt und die historischen Wurzeln der jeweiligen Dogmen beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Kaiser Friedrich II., Papsttum, Herrschaftskonzepte, Konstitutionen von Melfi, Zwei-Schwerter-Lehre, Exkommunikation, Süditalien, Kreuzzug, Reichskirche und mittelalterliche Geschichte.
Was wird im Kapitel "Das Herrschaftsverständnis im Proömium der Konstitutionen von Melfi" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Proömium der Konstitutionen von Melfi, um Friedrichs Herrschaftsverständnis zu verstehen. Es untersucht, wie Friedrich seine Herrschaft durch die Schöpfungsgeschichte legitimiert, seine Rolle als Gesetzgeber betont und sich als Schirmherr der römischen Kirche darstellt. Der Widerspruch zwischen Friedrichs Vorstellung von kaiserlicher Macht und dem päpstlichen Verständnis wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Geistliche und weltliche Herrschaft aus päpstlicher Sicht" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert die päpstliche Perspektive auf das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Herrschaft. Es erläutert die Zwei-Schwerter-Lehre und das Sonne/Mond-Gleichnis und analysiert die Reaktion Gregors IX. auf die Konstitutionen von Melfi als direkte Konfrontation mit Friedrichs Herrschaftsanspruch. Die Unterschiede in der Auffassung von Macht und Autorität werden deutlich gemacht.
- Citation du texte
- Jule Ebbing (Auteur), 2009, Die Herrschaftskonzeption Kaiser Friedrich II. im Konflikt mit dem Papsttum , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192793