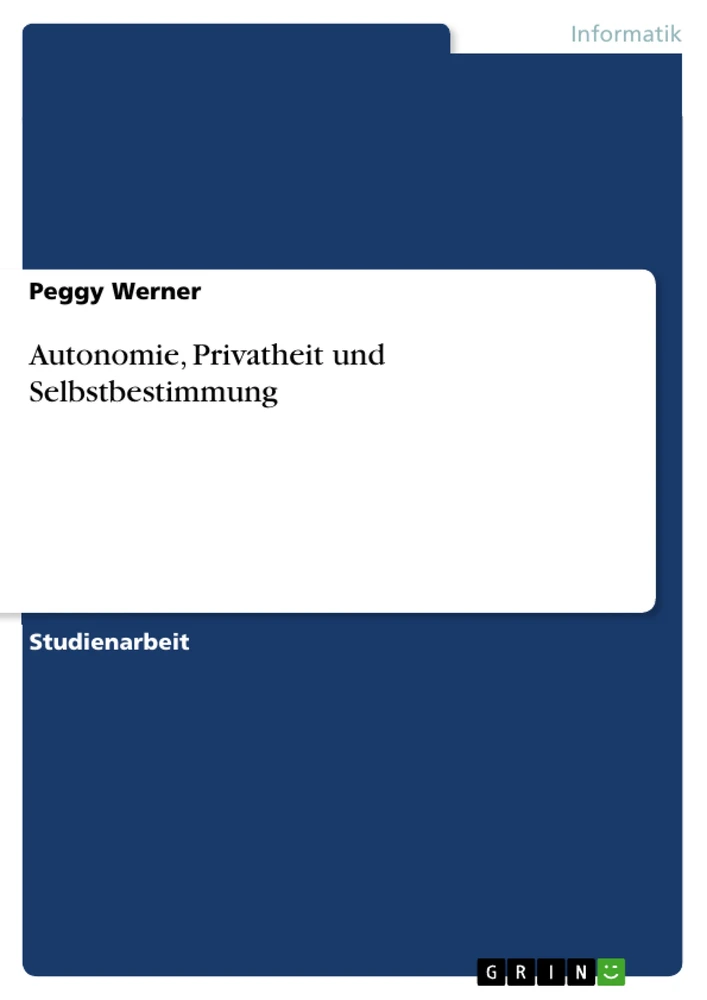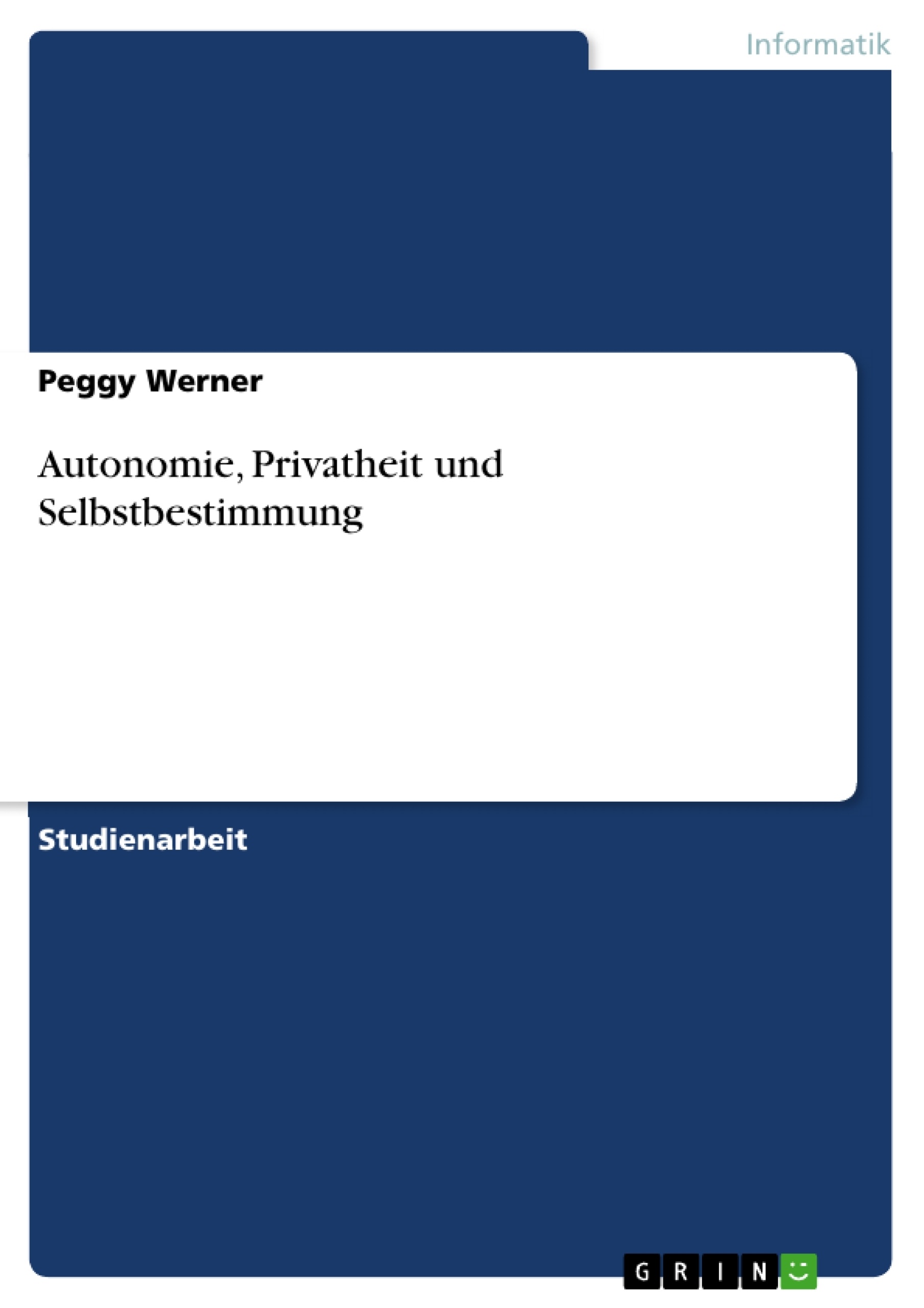In Bezug auf das in dem von mir besuchten Proseminar behandelten Thema der informationellen Selbstbestimmung beschäftige ich mich in meiner Arbeit zunächst mit den im Zentrum stehenden Begriffen Autonomie, Selbstbestimmung und Privatheit. Auf Grundlage ihrer Definitionen werde ich sie im Folgenden in Zusammenhang setzen und ihre Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben aufzeigen. Ziel meiner Arbeit ist es, zentrale Fragestellungen des Themas zu klären: Warum sind Autonomie, Selbstbestimmung und Privatheit unerlässliche Pfeiler einer liberal-demokratischen Grundordnung und Gesellschaft? Was ist privat und was ist öffentlich? Wann handelt man autonom und welche Bedeutung wird dabei der Authentizität einer Person beigemessen? Warum ist „Privatheit oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung […] ein Grundbedürfnis des Menschen“ (Müller, Eymann, Kreutzer: Privatheit, Auszug aus Telematik- und Kommunikationssysteme in der vernetzten Wirtschaft, 2002, S. 1)?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Liberal-demokratisches Betrachtungsfeld
- Verhältnis von privat und öffentlich
- Privatheit
- Autonomie
- Autonomie als real gelebte Freiheit
- Zusammenhang zur Authentizität
- Einschränkungen
- Zusammenhang Privatheit & Autonomie
- Informationelle Privatheit.
- Dezisionale Privatheit.…………
- Lokale Privatheit
- Zusammenfassung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Begriffe Autonomie, Selbstbestimmung und Privatheit im Kontext der informationellen Selbstbestimmung und ihrer Bedeutung für eine liberal-demokratische Gesellschaft. Sie strebt danach, zentrale Fragen zu beantworten: Warum sind diese Konzepte essenziell für eine liberale Demokratie? Was grenzt das Private vom Öffentlichen ab? Welche Faktoren beeinflussen die Autonomie des Individuums und welchen Stellenwert hat Authentizität dabei? Welche Rolle spielt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im menschlichen Grundbedürfnis?
- Die Bedeutung von Autonomie, Selbstbestimmung und Privatheit für eine liberale Demokratie.
- Die Abgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit.
- Die Determinanten von Autonomie und die Rolle der Authentizität.
- Die Relevanz von informationeller Selbstbestimmung für den Menschen.
- Die Verbindung zwischen Privatheit und Autonomie.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt das Thema der informationellen Selbstbestimmung ein und präsentiert die zentralen Begriffe Autonomie, Selbstbestimmung und Privatheit. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und formuliert die wichtigsten Fragen, die im Laufe der Arbeit behandelt werden.
- Liberal-demokratisches Betrachtungsfeld: Dieses Kapitel definiert den Rahmen der Arbeit und fokussiert auf die liberale und demokratische Grundordnung als Basis für die Analyse von Autonomie, Privatheit und Selbstbestimmung. Es erläutert die vier Säulen des Liberalismus: Freiheit, Gleichheit, Demokratie und ein neutraler Staat.
- Verhältnis von privat und öffentlich: Dieses Kapitel beleuchtet die Abgrenzung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Es werden zwei Modelle vorgestellt: das Zwiebelmodell und ein Modell, das das Private als gesicherte Handlungssphäre definiert.
- Privatheit: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Privatheit. Es bezieht sich auf die beiden Modelle aus dem vorherigen Kapitel und kombiniert sie zu einem umfassenderen Verständnis von Privatheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die zentralen Konzepte Autonomie, Selbstbestimmung, Privatheit und informationelle Selbstbestimmung im Kontext der liberal-demokratischen Gesellschaft. Sie untersucht die Abgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit sowie die Determinanten von Autonomie und die Rolle der Authentizität.
- Quote paper
- Peggy Werner (Author), 2006, Autonomie, Privatheit und Selbstbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192519