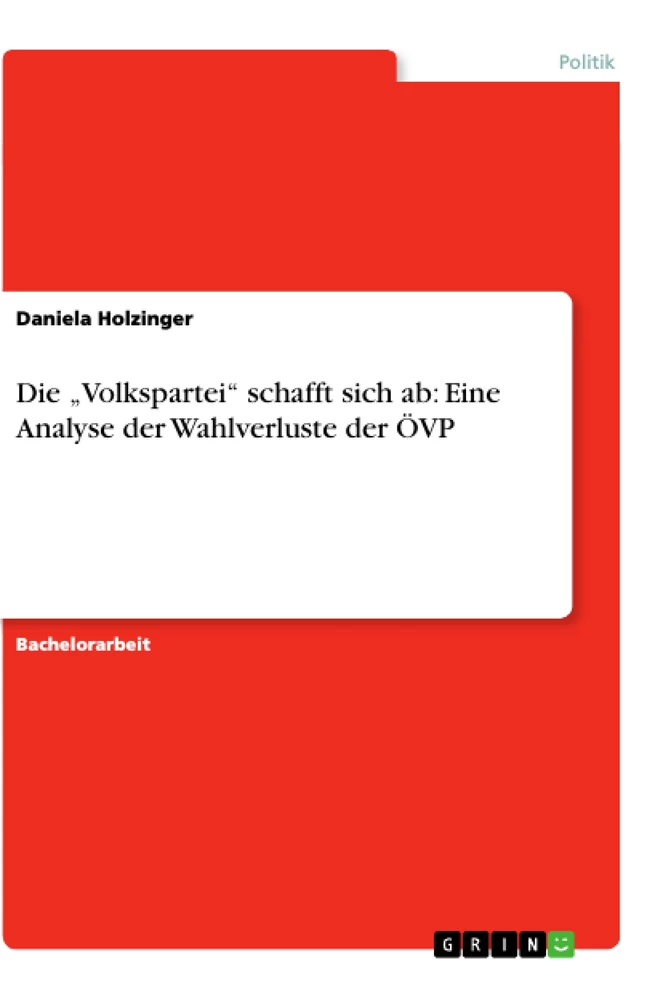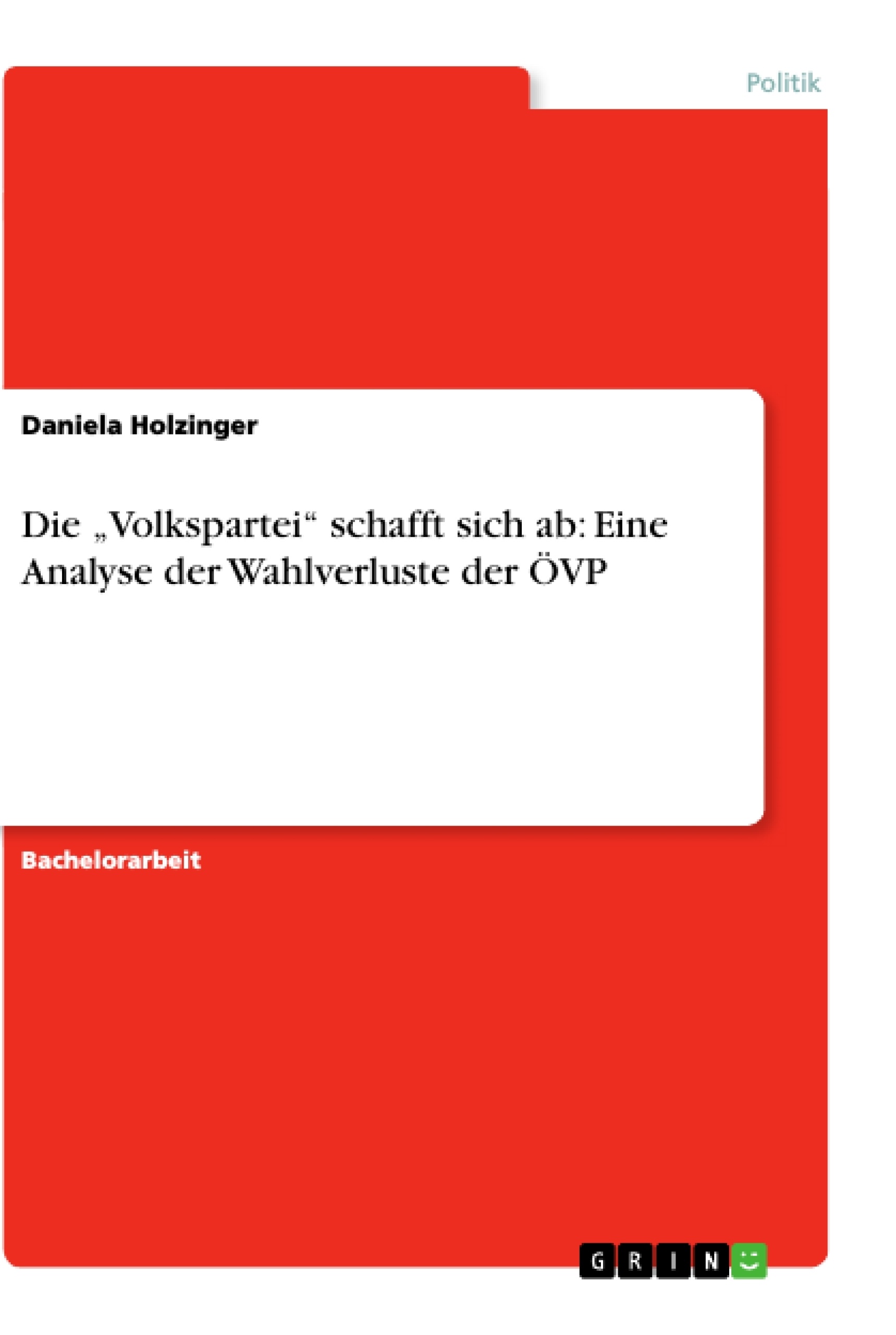Aufgrund der seit den 1970er Jahren stetig sinkenden Wahlergebnisse der ÖVP, ist es fraglich, ob die Österreichische Volkspartei überhaupt „Volkspartei“ im eigentlichen Sinne des Namens ist? Auch Müller33 stellt sich die Frage, inwieweit die Namensgebung der Parteien als „Volksparteien“, Aussagekraft über die schlussendliche strategische Positionierung dieser für das gesamte „Volk“ hat. Ist die ÖVP „Volkspartei“, nur weil sie dessen Namen trägt? Was sind die Gründe für die ab den 70er Jahren beginnenden Wahlverluste der Österreichischen Volkspartei?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Geschichte der Österreichischen Volkspartei
- 1.2 Relevanz des Themas
- 1.3 Forschungsleitende Fragestellungen
- 1.4 Arbeitshypothese
- 1.5 Vorgehensweise
- 2. Theoretische Einbettung
- 2.1 Theorie der „Catch-all Party” von Otto Kirchheimer (1966)
- 2.2 Der Weg hin zur „Catch-all Party”
- 3. Empirische Überprüfung
- 3.1 Analyse der ÖVP an der „CAP“-Theorie Kirchheimers
- 3.1.1 Teilaspekt: IDEOLOGIE
- 3.1.2 Teilaspekt: INNERPARTEILICHE MACHTVERTEILUNG
- 3.1.3 Teilaspekt: SOZIALE ZUSAMMENSETZUNG
- 3.1.4 Teilaspekt: VERBINDUNG ZU INTERESSENGRUPPEN
- 3.1.5 Teilaspekt: FUNKTION IM POLITISCHEN SYSTEM
- 3.2 Resümee: ÖVP als „Erfinderin“ der „CAP”
- 4. Wahlverluste von „Volksparteien”
- 4.1 Theoretischer Hintergrund von Wahlverlusten
- 4.2 ÖVP-spezifische Gründe für Wahlverluste
- 4.2.1 Entideologisierung/ Entpolitisierung
- 4.2.2 Innerparteiliche Machtverteilung/ organisatorische Struktur der ÖVP
- 4.2.3 Personalisierung/ Personaldebatten
- 4.3 Analyse der VP-Wahlverluste seit 1970
- 4.4 Resümee: Wahlverluste von Volksparteien
- 5. Die ÖVP im 21. Jahrhundert
- 5.1 Aktuelle innenpolitische Situation der Volkspartei
- 6. Resümee
- 6.1 Beantwortung der Arbeitshypothese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gründe für die anhaltenden Wahlverluste der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) seit den 1970er Jahren. Die Arbeit analysiert, inwieweit die ÖVP dem Modell einer „Catch-all Party“ entspricht und wie innerparteiliche Konflikte und die zunehmende Personalisierung der Politik zu den Wahlergebnissen beitragen.
- Analyse der ÖVP als „Catch-all Party“ nach Kirchheimer
- Innerparteiliche Konfliktdimensionen und ihre Auswirkungen auf Wahlerfolge
- Der Einfluss der Personalisierung der Politik auf die Wählergunst
- Die Rolle der bündischen Struktur der ÖVP
- Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die ÖVP
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Bachelorarbeit ein, indem es die Geschichte der ÖVP, die Relevanz des Themas aufgrund der Wahlverluste, die Forschungsfragen und die Arbeitshypothese präsentiert. Es wird die Methode der Analyse der ÖVP anhand der "Catch-all Party"-Theorie von Kirchheimer erläutert.
2. Theoretische Einbettung: Hier wird die Theorie der „Catch-all Party“ von Otto Kirchheimer vorgestellt, die den Wandel von Massenintegrationsparteien zu Volksparteien beschreibt. Die charakteristischen Merkmale dieser Partei, wie die Reduktion ideologischen Gepäcks und die Stärkung der Parteiführung, werden detailliert dargestellt.
3. Empirische Überprüfung: In diesem Kapitel wird die ÖVP anhand der Kriterien von Kirchheimers „Catch-all Party“-Theorie analysiert. Die Analyse umfasst die Aspekte Ideologie, innerparteiliche Machtverteilung, soziale Zusammensetzung der Wählerschaft, Verbindungen zu Interessengruppen und die Funktion der Partei im politischen System. Das Kapitel schließt mit einem Resümee, das die ÖVP als weitgehendes Beispiel einer „Catch-all Party“ darstellt.
4. Wahlverluste von „Volksparteien“: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Krise von Volksparteien in Europa und analysiert die spezifischen Gründe für die Wahlverluste der ÖVP. Es werden die Faktoren Entideologisierung/Entpolitisierung, innerparteiliche Machtstrukturen und die Personalisierung der Politik untersucht. Eine detaillierte Analyse der VP-Wahlergebnisse seit 1970 verdeutlicht die Zusammenhänge.
5. Die ÖVP im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Ausblick auf die aktuelle innenpolitische Situation der ÖVP und beleuchtet die anhaltenden Personaldebatten und die Herausforderungen, denen sich die Partei im 21. Jahrhundert gegenübersieht, im Kontext der vorherigen Kapitel.
Schlüsselwörter
Österreichische Volkspartei (ÖVP), Catch-all Party, Volkspartei, Wahlverluste, Entideologisierung, Personalisierung, innerparteiliche Konflikte, Bündestruktur, Parteiendemokratie, Parteientheorie, Wahlverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) - Analyse der Wahlverluste
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert die Gründe für die anhaltenden Wahlverluste der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) seit den 1970er Jahren. Sie untersucht, inwieweit die ÖVP dem Modell einer „Catch-all Party“ entspricht und wie innerparteiliche Konflikte und die zunehmende Personalisierung der Politik zu den Wahlergebnissen beitragen.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich zentral auf die Theorie der „Catch-all Party“ von Otto Kirchheimer (1966). Diese Theorie beschreibt den Wandel von Massenintegrationsparteien zu Volksparteien und deren charakteristische Merkmale, wie die Reduktion ideologischen Gepäcks und die Stärkung der Parteiführung. Zusätzlich werden Theorien zu Wahlverlusten von Volksparteien herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (mit Forschungsfragen und Hypothese), Theoretische Einbettung (Kirchheimers Theorie), Empirische Überprüfung (Analyse der ÖVP anhand der "Catch-all Party"-Theorie), Wahlverluste von Volksparteien (theoretische Hintergründe und ÖVP-spezifische Gründe), Die ÖVP im 21. Jahrhundert (aktuelle Situation) und Resümee (Beantwortung der Hypothese). Jedes Kapitel wird in Unterkapitel weiter unterteilt.
Welche Aspekte der ÖVP werden analysiert?
Die Analyse der ÖVP umfasst verschiedene Aspekte: ihre Ideologie, die innerparteiliche Machtverteilung, die soziale Zusammensetzung ihrer Wählerschaft, die Verbindungen zu Interessengruppen, ihre Funktion im politischen System und die Auswirkungen von Entideologisierung/Entpolitisierung, innerparteilichen Machtstrukturen und Personalisierung der Politik auf die Wahlergebnisse.
Welche konkreten Faktoren werden als Gründe für Wahlverluste genannt?
Die Arbeit identifiziert mehrere Faktoren, die zu den Wahlverlusten der ÖVP beitragen: Entideologisierung/Entpolitisierung, innerparteiliche Machtstrukturen und Konflikte, die Personalisierung der Politik, sowie der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels und die Rolle der bündischen Struktur der ÖVP.
Wie wird die ÖVP im Kontext der „Catch-all Party“-Theorie bewertet?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die ÖVP den Kriterien von Kirchheimers „Catch-all Party“-Theorie entspricht. Das Ergebnis dieser Analyse wird im Resümee zusammengefasst.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Die Analyse der Wahlverluste der ÖVP konzentriert sich auf die Periode seit den 1970er Jahren bis in die Gegenwart, mit einem Ausblick auf die aktuelle Situation im 21. Jahrhundert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Österreichische Volkspartei (ÖVP), Catch-all Party, Volkspartei, Wahlverluste, Entideologisierung, Personalisierung, innerparteiliche Konflikte, Bündestruktur, Parteiendemokratie, Parteientheorie, Wahlverhalten.
- Quote paper
- Daniela Holzinger (Author), 2011, Die „Volkspartei“ schafft sich ab: Eine Analyse der Wahlverluste der ÖVP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192494