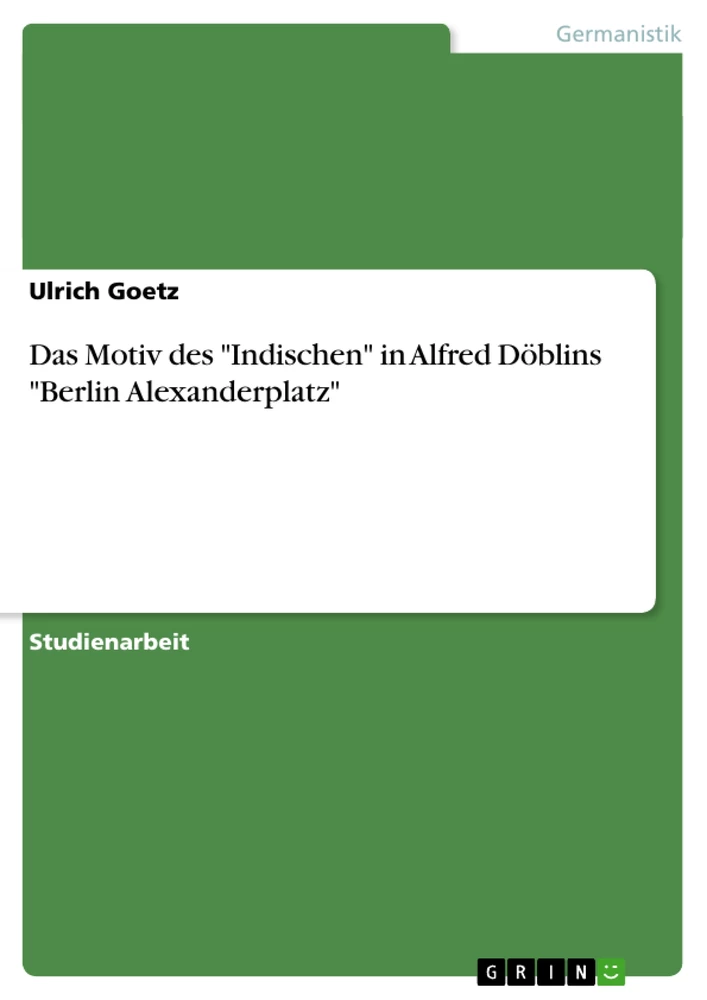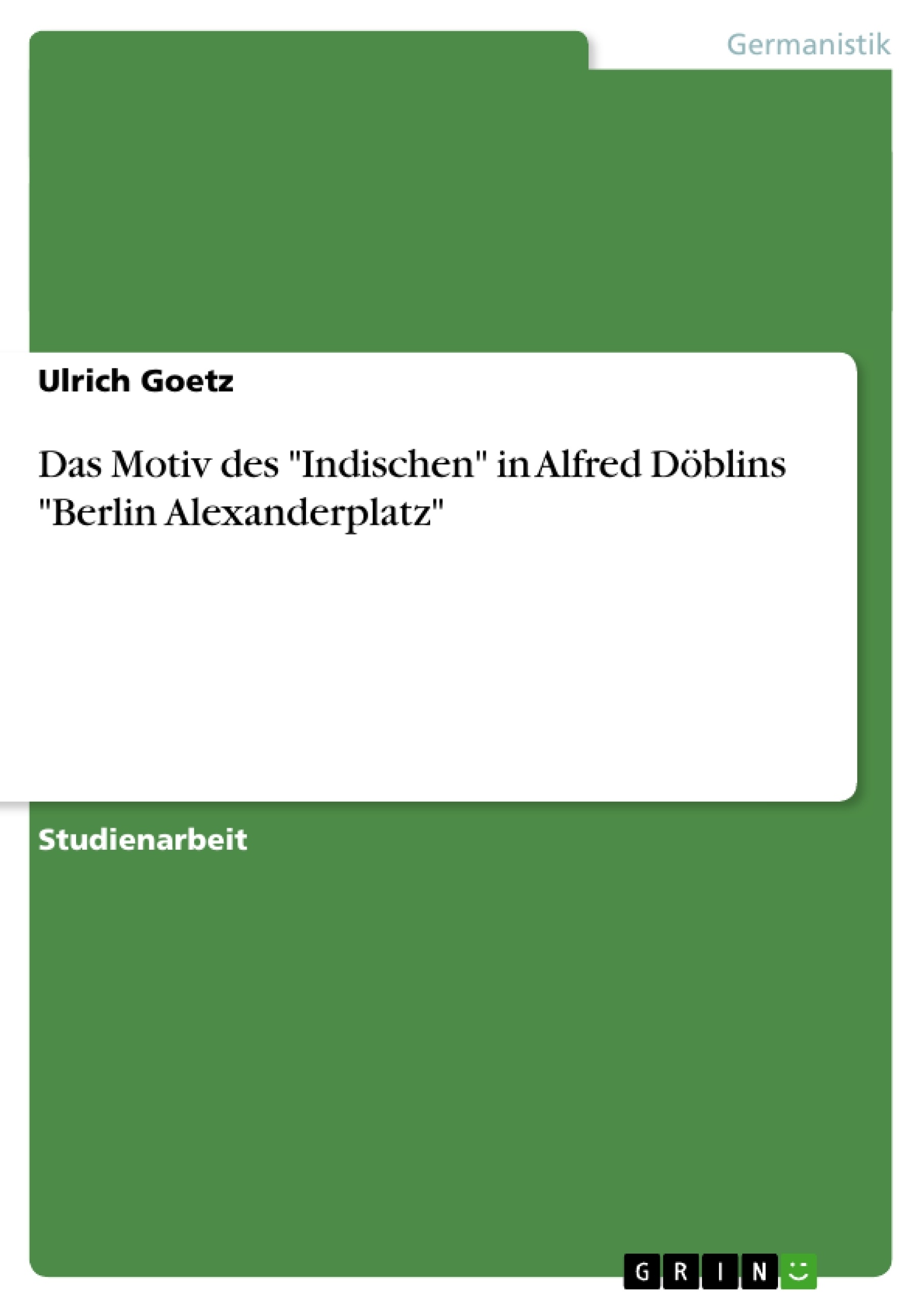Das eigentliche Hauptthema von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ ist nicht die Entwicklung des individuellen Ichs von Franz Biberkopf. Döblin verwendet seinen Protagonisten vielmehr als Musterbeispiel, um anschaulich zu demonstrieren, auf welchen Kausalzusammenhängen die (bürgerliche) Gesellschaft aufbaut:
„Es ist kein Grund zum verzweifeln. [...] Denn der Mann, von dem ich berichte, ist zwar kein gewöhnlicher Mann, aber doch insofern ein gewöhnlicher Mann, als wir ihn genau verstehen und manchmal sagen: wir könnten Schritt um Schritt dasselbe getan haben wie er und dasselbe erlebt haben wie er.“
Inspiriert zu dieser Thematik wurde Döblin durch sein vorheriges Werk, dem Versepos „Manas“, in welchem er Aspekte der indischen Mythologie verarbeitet hat:
„Die Frage, die mir der 'Manas' zuwarf, lautete: Wie ergeht es nun einem guten kräftigen Menschen in unserer Gesellschaft, - laß sehen, wie er sich verhält und wie vor ihm die Menschen aussehen. Es wurde 'Berlin Alexanderplatz'.“
Der Hauptgegenstand dieser Untersuchung ist daher die Frage, wie sich das Motiv des „Indischen“ in Döblins „Berlin Alexanderplatz“ ausgewirkt hat, und welche Rückschlüsse auf Döblins Interpretation des menschlichen Sozialwesens dies zulässt. Da Döblin in „Berlin Alexanderplatz“ mit keiner indischen Terminologie gearbeitet hat, werden seine inhaltlichen Anknüpfungen an das Motiv des „Indischen“ innerhalb dieser Untersuchung anhand eines direkten Vergleichs mit der indischen Mythologie explizit gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Religiöse Hintergründe des Romans
- Berlin als Metapher der „Weltseele“
- Franz Biberkopf und „das Andere“
- Das Weibliche als komplementärer Aspekt des Biberkopf-Ichs
- Reinhold als antagonistische Stimulans des Biberkopf-Ichs
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Motiv des „Indischen“ in Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und analysiert dessen Einfluss auf die Interpretation des menschlichen Sozialwesens in Döblins Werk. Im Zentrum steht die Frage, wie sich das „Indische“ in Döblins Roman manifestiert und welche Rückschlüsse sich daraus auf Döblins Verständnis des menschlichen Zusammenlebens ziehen lassen.
- Die Rolle des „Indischen“ in Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“
- Die Auswirkungen des „Indischen“ auf Döblins Interpretation des menschlichen Sozialwesens
- Die Verbindung zwischen Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und seinem vorherigen Werk „Manas“
- Der Vergleich mit Hermann Hesses „Der Steppenwolf“ und dessen Verwendung von „indischen“ Ideen
- Die Kritik an der traditionellen Interpretation des europäischen Ich-Begriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem offenen Ende von Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und der „Wiedergeburt“ von Franz Biberkopf als „Franz Karl Biberkopf“. Es wird erläutert, dass Döblin die Geschichte als Brücke zu einer geplanten Fortsetzung konzipiert hat, die jedoch nie vollendet wurde. Der Hauptteil der Untersuchung fokussiert auf das Motiv des „Indischen“ in Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und untersucht dessen Auswirkungen auf die Interpretation des menschlichen Sozialwesens.
Schlüsselwörter
„Indisches“ Motiv, Alfred Döblin, „Berlin Alexanderplatz“, Franz Biberkopf, „Weltseele“, soziales Wesen, „Manas“, Hermann Hesse, „Der Steppenwolf“, Überperson, Ich-Begriff, konstruktivistische Interpretation, Viabilität.
- Quote paper
- Ulrich Goetz (Author), 2003, Das Motiv des "Indischen" in Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19241