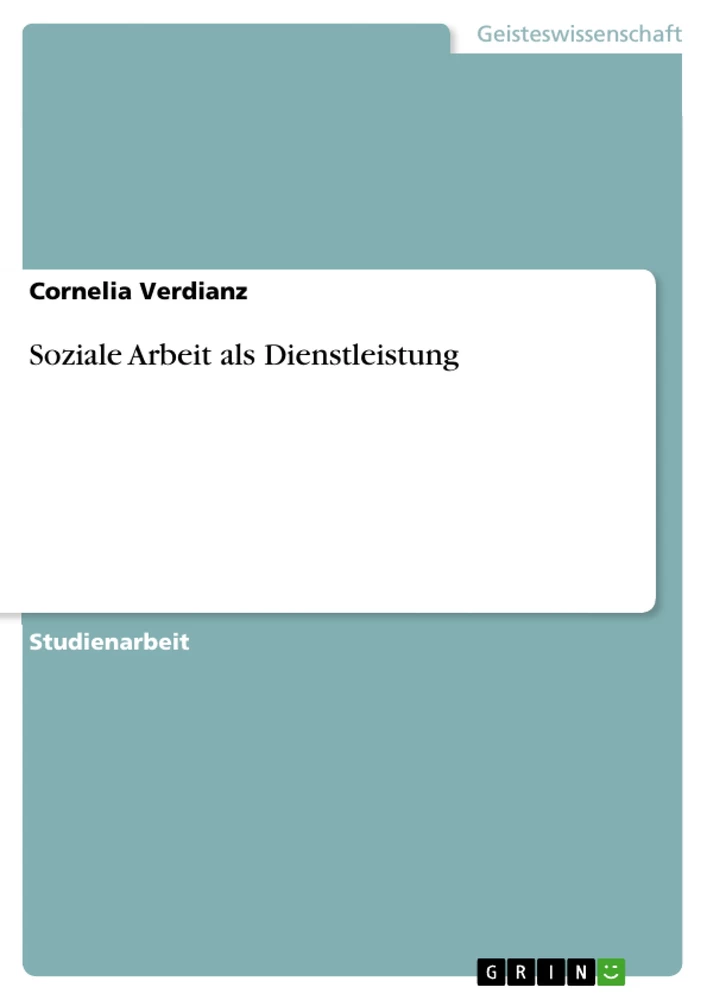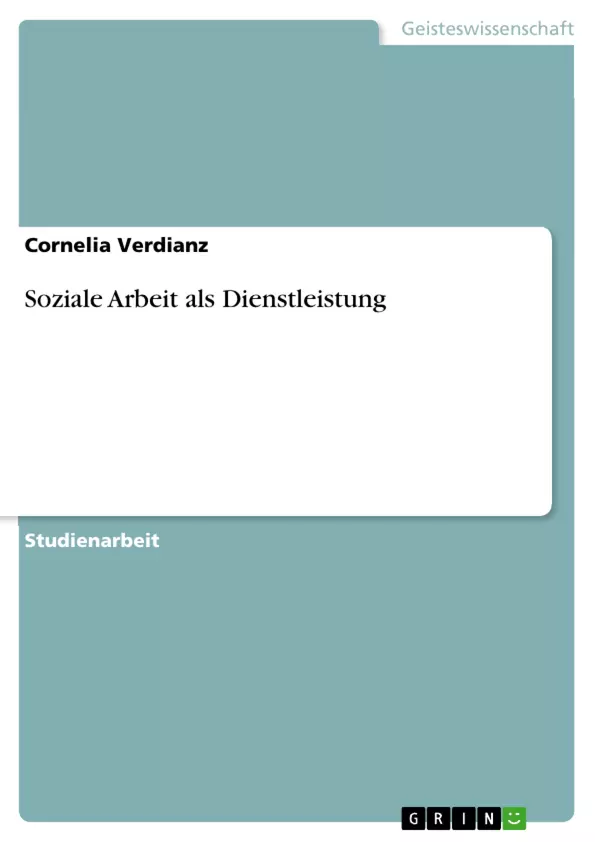Dienstleistungen werden „allgemein als Tätigkeiten definiert, die weder dem wirtschaftlichen Bereich der Nahrungsmittel- und Rohstoffgewinnung (primärer Sektor) noch der industriellen Rohstoffverarbeitung (sekundärer Sektor) zugeordnet werden können.“ (Flösser/Oechler 2005, S. 198) Merkmale für die Kategorie DL sind: Immaterialität, Nicht-Transportfähigkeit, Nicht-Lagerfähigkeit, etc. Personenbezogene soziale DL setzen die aktive Mitwirkung der AdressatInnen für eine gelingende Produktion von DL voraus. Die Produktion und Konsumtion der Leistung fallen zusammen. (Vgl. ebd., S. 198)
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Arbeit als Dienstleistung
- Die Privilegierung (Sonderrecht verleihen) des Nutzers/der Nutzerin
- Zur theoretischen Begründung sozialer Dienstleistung
- Dienstleistung als „Kundinnendienst“
- Theoretische Grundelemente Sozialer Dienstleistung
- Das Erbringungsverhältnis personenbezogener Dienstleistung
- Der Erbringungskontext personenbezogener sozialer Dienstleistung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen sozialer Dienstleistungen, insbesondere unter dem Aspekt der Nutzerorientierung und der daraus resultierenden Privilegierung des Nutzers. Es werden verschiedene theoretische Ansätze beleuchtet und deren Implikationen für die Praxis sozialer Arbeit diskutiert.
- Soziale Arbeit als Dienstleistung und deren Charakteristika
- Die Rolle des Nutzers und seine Privilegierung im Dienstleistungsprozess
- Theoretische Fundierung sozialer Dienstleistungen
- Der Einfluss von Konkurrenz und Nachfrageorientierung
- Das Verhältnis zwischen Professionellen und Nutzern
Zusammenfassung der Kapitel
Soziale Arbeit als Dienstleistung: Dieser Abschnitt definiert soziale Arbeit als Dienstleistung, indem er sie von anderen wirtschaftlichen Sektoren abgrenzt. Die Immaterialität, Nicht-Transportfähigkeit und Nicht-Lagerfähigkeit werden als zentrale Merkmale hervorgehoben. Besonders wird die aktive Mitwirkung der Adressaten für eine erfolgreiche Dienstleistungsproduktion betont, wobei Produktion und Konsumtion zeitgleich stattfinden.
Die Privilegierung (Sonderrecht verleihen) des Nutzers/der Nutzerin: Dieser Abschnitt thematisiert den Einfluss von Konkurrenz auf die Qualität und Innovation sozialer Dienstleistungen. Die Nutzerzentrierung wird als ein Modell vorgestellt, das die Macht der Nutzer im „Markt“ sozialer Angebote stärkt und einer möglichen Bevormundung durch die Professionellen entgegenwirkt. Die Bedürfnisse und Präferenzen des Nutzers werden in den Mittelpunkt gerückt.
Zur theoretischen Begründung sozialer Dienstleistung: Hier wird die theoretische Fundierung sozialer Dienstleistungen vertieft. Der Fokus liegt auf der wechselseitigen Konstitutionsbeziehung von Produktion und Konsumtion in personenbezogenen Dienstleistungen. Die aktive Rolle des Nutzers bei seiner Selbstproduktion durch Aneignung von Inhalten, die durch die Dienstleistung vermittelt werden, wird hervorgehoben. Der Nutzer wird als Primat im Dienstleistungsprozess positioniert.
Dienstleistung als „Kundinnendienst“: Dieser Abschnitt untersucht die Dienstleistungsorientierung in der Sozialen Arbeit. Die Nachfrageorientierung und die Anpassung der Leistungen an die Bedürfnisse der Nutzer stehen im Vordergrund. Die zunehmende Konkurrenz zwischen verschiedenen Einrichtungen und die daraus resultierende größere Entscheidungsmacht der Nutzer werden diskutiert. Die Arbeit betont die Bedeutung der Gleichstellung und des gegenseitigen Respekts zwischen Professionellen und Nutzern.
Theoretische Grundelemente Sozialer Dienstleistung: Dieser Abschnitt behandelt die theoretischen Grundelemente Sozialer Dienstleistung, insbesondere das Erbringungsverhältnis personenbezogener Dienstleistungen. Die wechselseitige Beziehung zwischen Produktion und Konsumtion wird detailliert erläutert, wobei der Nutzer durch die Aneignung von Inhalten selbst zum Produzenten seines Selbst wird. Die Rolle der Professionellen als Ko-Produzenten wird beschrieben.
Das Erbringungsverhältnis personenbezogener Dienstleistung: Dieser Teil erläutert das Erbringungsverhältnis personenbezogener Dienstleistungen im Detail. Der Fokus liegt auf der wechselseitigen Konstitutionsbeziehung von Produktion und Konsumtion. Es wird erklärt, wie der Nutzer durch den Konsum der Dienstleistung seinen eigenen Zustand verändert und somit selbst zum Produzenten seines Selbst wird. Der Gebrauchwert der Dienstleistung und die gesellschaftliche Nützlichkeit des professionellen Handelns werden betont.
Der Erbringungskontext personenbezogener sozialer Dienstleistung: Dieser Abschnitt vergleicht den marktförmigen und den sozialstaatlichen Erbringungskontext sozialer Dienstleistungen. Die Problematik der Alternativlosigkeit sozialstaatlicher Angebote wird angesprochen, und die Optimierung des Passungsverhältnisses von Angebot und Nachfrage durch Nutzerorientierung wird diskutiert. Der Beitrag von Hirschmanns "exit" und "voice"-Modell wird zur Veranschaulichung herangezogen.
Schlüsselwörter
Soziale Dienstleistung, Nutzerorientierung, Kundenorientierung, Konkurrenz, Produktion und Konsumtion, Professionelles Handeln, Selbstproduktion, Adressatenforschung, Gleichstellung, Ressourcenallokation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theoretische Grundlagen Sozialer Dienstleistungen
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht die theoretischen Grundlagen sozialer Dienstleistungen, insbesondere die Nutzerorientierung und die daraus resultierende Privilegierung des Nutzers. Er beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze und deren Auswirkungen auf die Praxis der Sozialen Arbeit.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt unter anderem folgende Themen: Soziale Arbeit als Dienstleistung und deren Charakteristika; die Rolle des Nutzers und seine Privilegierung; theoretische Fundierung sozialer Dienstleistungen; der Einfluss von Konkurrenz und Nachfrageorientierung; das Verhältnis zwischen Professionellen und Nutzern; das Erbringungsverhältnis personenbezogener Dienstleistungen; und der Erbringungskontext sozialer Dienstleistungen im Vergleich von Markt und Sozialstaat.
Wie wird Soziale Arbeit im Text definiert?
Soziale Arbeit wird als Dienstleistung definiert, die sich durch Immaterialität, Nicht-Transportfähigkeit und Nicht-Lagerfähigkeit auszeichnet. Die aktive Mitwirkung der Adressaten ist für eine erfolgreiche Dienstleistungsproduktion zentral, wobei Produktion und Konsumtion zeitgleich stattfinden.
Welche Rolle spielt der Nutzer in diesem Konzept?
Der Nutzer spielt eine zentrale Rolle. Der Text betont die Nutzerzentrierung und die daraus resultierende Privilegierung des Nutzers. Seine Bedürfnisse und Präferenzen stehen im Mittelpunkt. Durch die Aneignung von Inhalten, die durch die Dienstleistung vermittelt werden, wird der Nutzer sogar als Ko-Produzent seines Selbst betrachtet.
Wie wird die "Privilegierung des Nutzers" erläutert?
Die "Privilegierung" bezieht sich auf die Stärkung der Macht des Nutzers im "Markt" sozialer Angebote durch Nutzerzentrierung. Dies wirkt einer möglichen Bevormundung durch Professionelle entgegen und stärkt die Entscheidungsmacht des Nutzers durch Konkurrenz und Nachfrageorientierung.
Welche theoretischen Ansätze werden diskutiert?
Der Text vertieft die theoretische Fundierung sozialer Dienstleistungen, indem er die wechselseitige Konstitutionsbeziehung von Produktion und Konsumtion in personenbezogenen Dienstleistungen beleuchtet. Die aktive Rolle des Nutzers bei seiner Selbstproduktion durch Aneignung von Inhalten wird hervorgehoben.
Wie wird das Verhältnis zwischen Professionellen und Nutzern beschrieben?
Der Text betont die Bedeutung der Gleichstellung und des gegenseitigen Respekts zwischen Professionellen und Nutzern. Die Professionellen werden als Ko-Produzenten im Dienstleistungsprozess beschrieben. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen der Nachfrageorientierung und der Anpassung der Leistungen an die Bedürfnisse der Nutzer in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld.
Welche Bedeutung hat der Erbringungskontext?
Der Text vergleicht den marktförmigen und den sozialstaatlichen Erbringungskontext sozialer Dienstleistungen und diskutiert die Problematik der Alternativlosigkeit sozialstaatlicher Angebote. Das Hirschmann's "exit" und "voice"-Modell wird zur Veranschaulichung der Optimierung des Passungsverhältnisses von Angebot und Nachfrage durch Nutzerorientierung herangezogen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Soziale Dienstleistung, Nutzerorientierung, Kundenorientierung, Konkurrenz, Produktion und Konsumtion, Professionelles Handeln, Selbstproduktion, Adressatenforschung, Gleichstellung, Ressourcenallokation.
- Quote paper
- B.A. Cornelia Verdianz (Author), 2010, Soziale Arbeit als Dienstleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192368