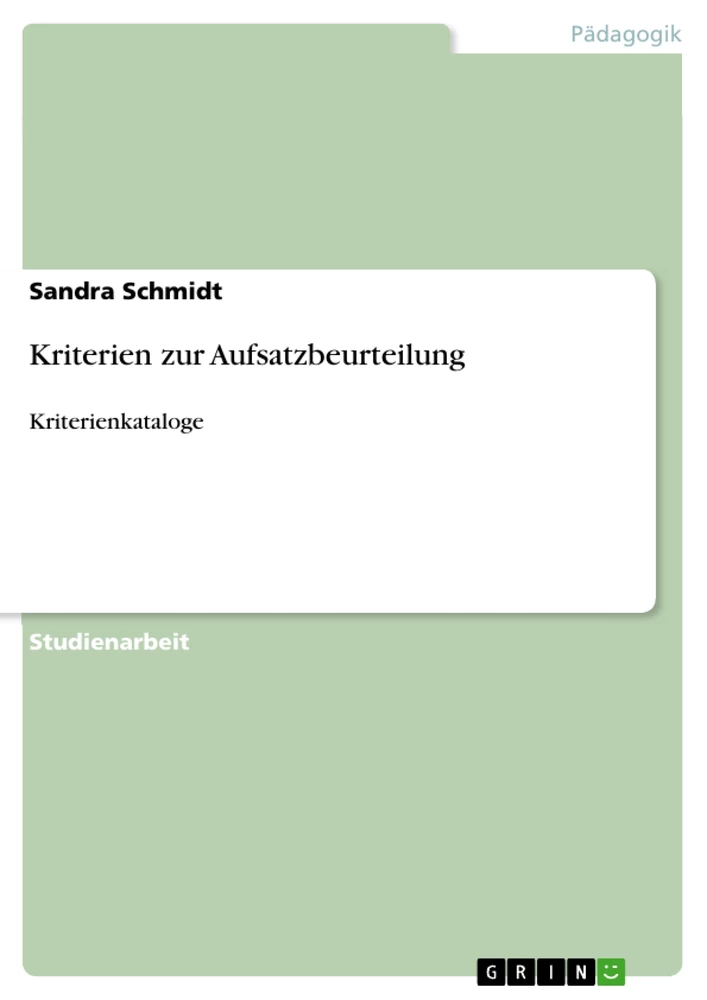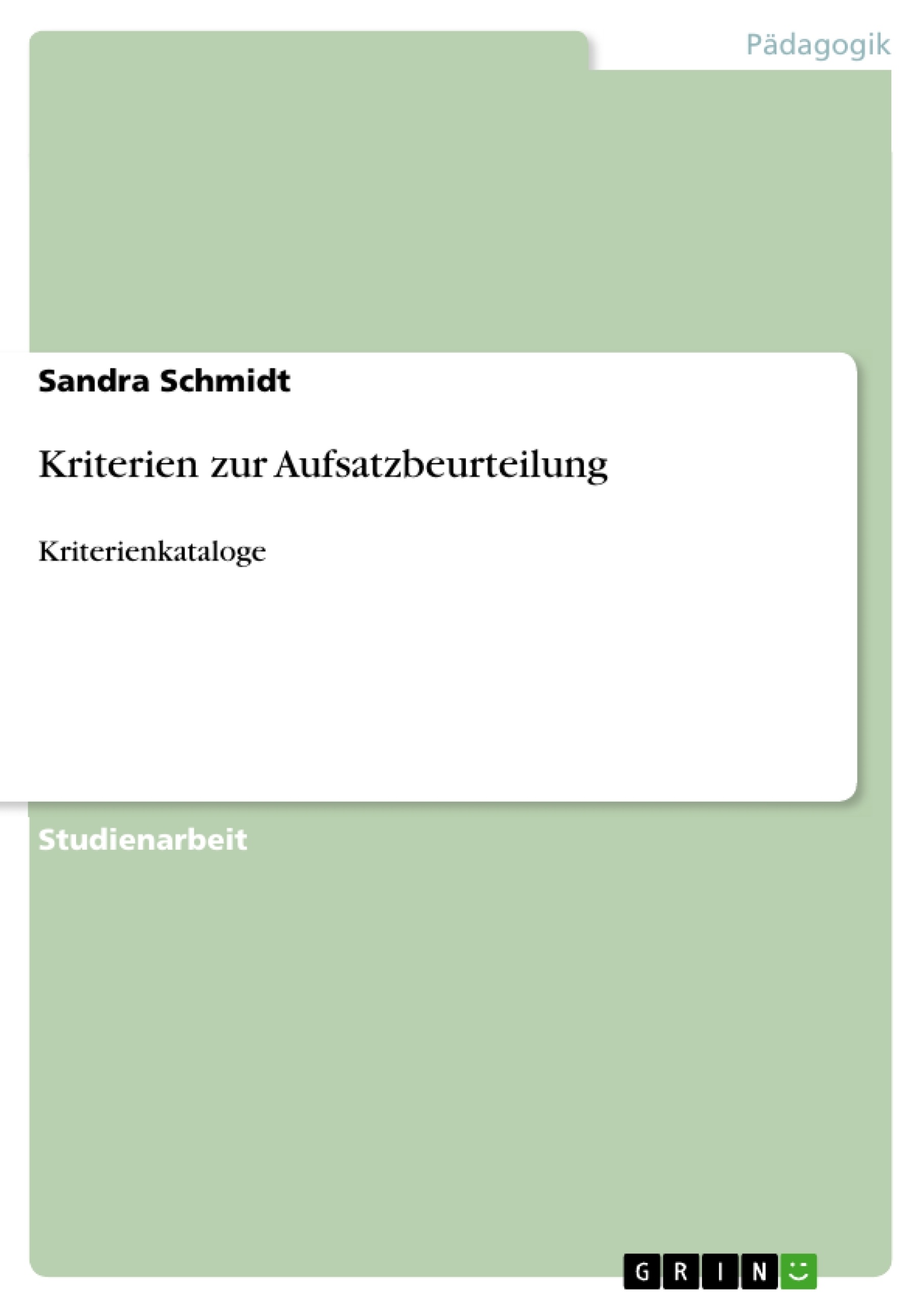1. Einführung
„Die Ziffernnote kann der Komplexität eines geschriebenen Textes nicht gerecht wer-den.“ Das Zitat Baurmanns verdeutlicht die Prämisse im Schulalltag, dass die Auf-satzbenotung in Form von Ziffernnoten den Schülerleistungen nicht gerecht wird.
Die objektive und vergleichbare Bewertung von schriftlichen Schülerleistungen wird von vielen Lehrern angestrebt, aber bleibt in der Praxis oft ein unerreichbares Kons-trukt. Bewertungen werden von erfahrenen Lehrern häufig durch Schätzurteile gefällt und durch kurze Lehrerkommentare erläutert. Es fehlt den Schülern bei dieser Art der Beurteilung an transparente Kriterien. Schüler können ihre schriftsprachlichen Defizite durch diese Beurteilungsform nicht nachvollziehen und das subsumieren der Schreibleistung in eine Ziffernote birgt wenig Motivationspotential für die Schüler ihre Schreibleistung zu verbessern.
Eine Alternative für das Bewerten von Schülertexten bietet im Schulalltag das Kon-zept des Kriterienkatalogs, das von dem Züricher Textanalyseraster abgeleitet worden ist. Anhand von bestimmten sprachlichen Kriterien kann der Lehrer die Textqualität der Schülertexte objektiv beurteilen.
In dieser Hausarbeit setzte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, welche linguis-tischen Merkmale denn wesentlich sind für die Beurteilung von Textqualität und wel-che Kriterien spielen in den praxisnahen Kriterienkatalogen eine wichtige Rolle zur Benotung von Schüleraufsätzen?
1. EINFÜHRUNG 2
2. BEWERTUNGSKONZEPTE FÜR SCHÜLERTEXTE 2
2.1 KRITERIEN DER BEWERTUNGSKONZEPTE 2
2.2 DAS „ZÜRICHER TEXTANALYSERASTER“- EIN MODELL3
2.2.1 KRITERIEN DES MODELLS 4
2.3 DER BASISKATALOG 6
2.3.1 DIE DIMENSIONEN DES BASISKATALOGS 6
3. DREI KRITERIENKATALOGE IM VERGLEICH 9
3.1 BESCHREIBUNG 9
3.2 BERICHT 11
3.3 KOMMENTIERTE ZUSAMMENFASSUNG 13
3.4 ERGEBNIS DER VERGLEICHENDEN ANALYSE 14
4. SCHLUSSBETRACHTUNG 15
5. LITERATURVERZEICHNIS 17
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Bewertungskonzepte für Schülertexte
- Kriterien der Bewertungskonzepte
- Das „Züricher Textanalyseraster“- ein Modell
- Kriterien des Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, welche linguistischen Merkmale für die Beurteilung von Textqualität relevant sind und welche Kriterien in der Praxis für die Benotung von Schüleraufsätzen eine wichtige Rolle spielen. Sie analysiert, welche Kriterien für die Bewertung von Schülertexten relevant sind und wie diese in konkreten Kriterienkatalogen implementiert werden können.
- Analyse von Bewertungskonzepten für Schülertexte
- Bedeutung von linguistischen Merkmalen für die Textqualität
- Anwendung des „Züricher Textanalyserasters“ für die Bewertung von Schülertexten
- Zusammenhang zwischen Kriterienkatalogen und sprachlicher Förderung
- Praxisrelevanz von Kriterienkatalogen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einleitung stellt das Problem der objektiven und vergleichbaren Bewertung von schriftlichen Schülerleistungen dar und führt die Notwendigkeit von transparenten Beurteilungskriterien an. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Kriterienkatalogen als Alternative zur Ziffernnote zur Förderung der Schreibleistung von Schülern.
Bewertungskonzepte für Schülertexte
Kriterien der Bewertungskonzepte
Dieser Abschnitt diskutiert die Anforderungen an Kriterienkataloge, die Validität, Objektivität und Reliabilität gewährleisten sollen. Er betont die Bedeutung von eindeutigen und leicht verständlichen Kriterien für Lehrer und Schüler, um schriftsprachliche Fähigkeiten nachhaltig zu fördern.
Das „Züricher Textanalyseraster“- ein Modell
Der Abschnitt stellt das „Züricher Textanalyseraster“ von Hanser, Nussbaumer und Sieber vor, das als Grundlage für die Entwicklung eines Kriterienkatalogs dient. Das Modell zielt darauf ab, die Textqualität durch die Analyse verschiedener textlicher Merkmale zu erfassen.
Kriterien des Modells
Die Kriterien des Modells werden im Detail vorgestellt. Das Modell gliedert sich in drei Teile: Null, A und B. Der Null-Teil umfasst Grundgrößen wie Textlänge und Kohäsionsleistung. Teil A analysiert die sprachliche Korrektheit des Textes. Teil B befasst sich mit der Angemessenheit des Textes und gliedert sich in funktionale, ästhetische und inhaltliche Relevanz.
- Quote paper
- Sandra Schmidt (Author), 2010, Kriterien zur Aufsatzbeurteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192354