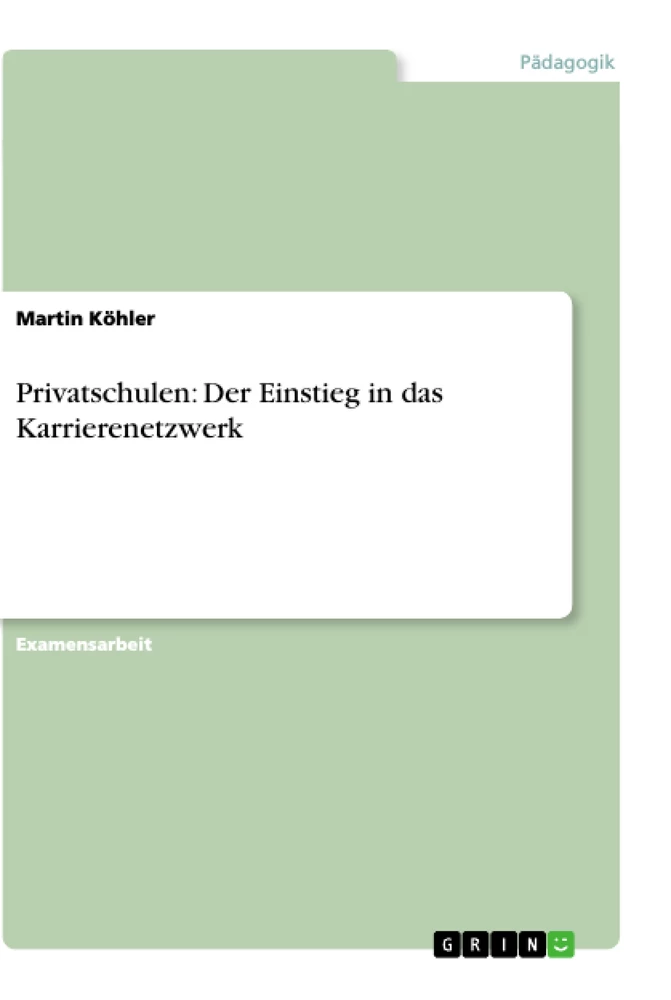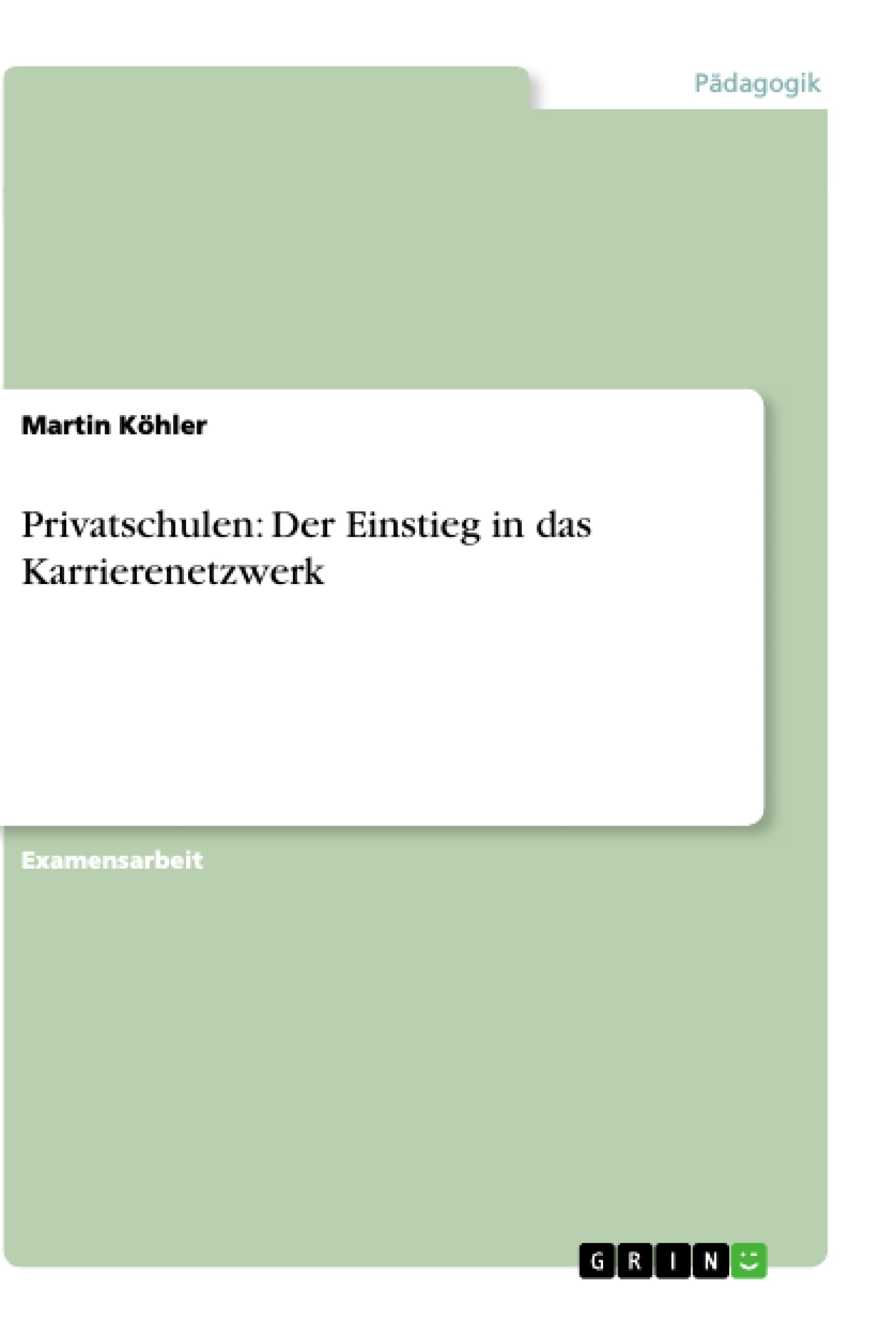„Bildung ist unser wertvollster Rohstoff, der Schlüssel zu Wachstum und Wohlstand sind Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft. Möglichst gleiche Bildungschancen für alle sind zudem unabdingbar für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens“ . Dieses Zitat stammt von dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, und hebt die immense Bedeutung der Bildung und Ausbildung der Kinder in der modernen Gesellschaft hervor. Zudem wird die Chan-cengleichheit von Ackermann als essentiell für das solidarische Miteinander betrachtet. In dieser Hinsicht stellt sich die Frage, welchen Beitrag das Privatschulwe-sen in Deutschland zu dieser Forderung beiträgt.
Das öffentliche Interesse an Bildung hat in den letzten Jahren in Deutschland stetig zugenommen. Beginnend mit der frühkindlichen Bildung („Frühförderung“) sorgen sich Eltern um die bestmögliche Ausbildung ihrer Kinder und das damit assoziierte Kindeswohl. Dies zeigt sich allein dadurch, dass 75% der Eltern den Schulab-schluss ihres Kindes als „sehr wichtig“ einstufen . Mit dieser erhöhten Sensibilität der Eltern geht ein Vertrauensverlust des staatlichen Schulsystems einher, wie Henry-Huthmacher schreibt: „Die Mehrzahl der Eltern hat wenig Vertrauen in das öffent-liche Bildungssystem“ . Jedoch ist dem Großteil der Eltern „die Bedeutung von Bildung und Schule als der zentralen Zuweisungsstelle von sozialen Lebenschancen“ bewusst.
Die Konsequenz aus dieser Bewertung spiegelt sich in der Tatsache wider, dass Eltern die Selbstinitiative ergreifen und sich unabhängig vom öffentlichen Bildungsauftrag persönlich um die Förderung ihrer Kinder bemühen. Die zunehmende Nachfrage nach privaten Bildungseinrichtungen, sei es nach Privatschulen oder privaten Nachhilfeeinrichtungen, und der damit einhergehende Stärkung des dritten Sektors gelten als Zeugnis dieser (bedrohlichen) Entwicklung.
Paradoxerweise spielt der Privatschulbereich in der Bildungsforschung bislang jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Diesbezüglich spricht Manfred Weiß von einer „Terra incognita“ .
Auf Grund dessen orientiert sich diese Arbeit an folgenden Leitfragen: Gibt es tatsächlich eine rapide ansteigende Zunahme von Privatschulen? Geht diese Entwicklung mit den PISA-Ergebnissen einher? Sind Privatschulen tatsächlich „besser“ als die staatlichen Schulen? Was sind die wirklichen Beweggründe für Eltern ihre Kinder an einer privaten Einrichtung unterrichten zu lassen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitsgrundlage und methodologische Überlegungen
- 3. Die Privatschule im deutschen Schulwesen – Rechtliche Grundlagen
- 3.1 Ersatzschulen
- 3.1.1 Akzessorietät der Ersatzschule
- 3.1.2 Genehmigungsbedingungen
- 3.1.3 Anerkennung der Ersatzschule
- 3.1.4 Staatliche Alimentierung der Ersatzschulen
- 3.1.5 Schulaufsicht über Ersatzschulen
- 3.2 Ergänzungsschulen
- 3.3 Trägerorganisationen
- 3.3.1 Konfessionelle Schulen
- 3.3.2 Schulen mit reformpädagogischer Prägung
- 3.3.3 Privatschulen des VDP
- 3.3.4 Internationale Schulen
- 3.3.5 Sonstige Privatschulen
- 3.1 Ersatzschulen
- 4. Legitimation und Funktionen des Privatschulwesens
- 4.1 Legitimation des Privatschulwesens
- 4.2 Die Funktionen der Privatschulen im deutschen Schulwesen
- 4.2.1 Die soziale Funktion
- 4.2.2 Die pädagogische Funktion
- 4.2.3 Die gesellschaftliche Funktion
- 5. Der Boom der Privatschulen – Mythos oder Realität?
- 5.1 Statistische Daten
- 5.1.1 Privatschulen
- 5.1.2 Privatschüler
- 5.1.3 Verteilung nach Bundesländern
- 5.1.4 Trägerorganisationen
- 5.1.5 Schularten
- 5.1.6 Mädchen-Jungen-Relation an Privatschulen
- 5.1.7 Klassenstärke
- 5.1.8 Ausländeranteil
- 5.1.9 Privatschüler nach sozio-ökonomischen Merkmalen der Eltern
- 5.1.10 Bildungshintergrund der Eltern
- 5.2 Auswertung
- 5.3 Zwischenfazit
- 5.1 Statistische Daten
- 6. Das ’Versagen’ der staatlichen Schulen
- 6.1 Internationale Untersuchungen
- 6.2 Nationale Untersuchungen
- 6.2.1 Schülerzusammensetzung
- 6.2.2 Leistungsvergleich
- 6.2.2.1 Realschulen
- 6.2.2.2 Gymnasien
- 6.2.2.3 Mädchenschulen
- 6.2.3 Verteilung auf Klassenstufen
- 6.2.4 Die Privatschulen als Spiegelbild der staatlichen Schulen?
- 6.3 Zwischenfazit
- 7. Die Expansion der Privatschulen und ihre Ursachen
- 7.1 Strukturwandel der Familie
- 7.1.2 Herausforderung Elternschaft
- 7.1.3 Bildungsdruck
- 7.2 Bildung als Dienstleistung
- 7.2.1 Privatschulfreiheit
- 7.2.2 Liberalisierung des Bildungsmarktes
- 7.3 Zwischenfazit
- 7.1 Strukturwandel der Familie
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Boom der Privatschulen in Deutschland. Die zentrale Frage ist, ob dieser Anstieg eine Reaktion auf das vermeintliche „Versagen“ staatlicher Schulen darstellt. Die Arbeit analysiert die quantitative Entwicklung der Privatschulen, vergleicht die Leistungen von Schülern an staatlichen und privaten Schulen, und beleuchtet die Perspektiven von Eltern und Schülern bezüglich der Schulwahl. Schließlich werden die Ursachen für die Expansion des Privatschulwesens erörtert.
- Quantitative Entwicklung des Privatschulwesens
- Leistungsvergleich zwischen staatlichen und privaten Schulen
- Schulwahlmotive von Eltern
- Perspektiven von Schülern
- Ursachen der Expansion des Privatschulwesens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Bildung und Chancengleichheit heraus und führt in die Forschungsfrage ein: Beitrag des Privatschulwesens zur Chancengleichheit und der Zusammenhang zwischen dem vermeintlichen „Versagen“ staatlicher Schulen und dem Boom der Privatschulen. Die Arbeit formuliert Leitfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2. Arbeitsgrundlage und methodologische Überlegungen: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur der Arbeit, die in drei Schwerpunkte gegliedert ist: Rechtliche Grundlagen des Privatschulwesens, quantitative Entwicklung und Leistungsvergleich, sowie die Perspektiven von Eltern und Schülern. Die methodologische Vorgehensweise, insbesondere die Verwendung statistischer Daten und Interviews, wird erläutert.
3. Die Privatschule im deutschen Schulwesen – Rechtliche Grundlagen: Das Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen des Privatschulwesens in Deutschland, fokussiert auf die Unterscheidung zwischen Ersatz- und Ergänzungsschulen und beschreibt die verschiedenen Trägerorganisationen (konfessionelle Schulen, reformpädagogische Schulen, Schulen des VDP, internationale Schulen und sonstige Privatschulen), ihre rechtliche Stellung und staatliche Finanzierung. Die Gleichwertigkeitsbedingungen für Ersatzschulen werden detailliert erläutert.
4. Legitimation und Funktionen des Privatschulwesens: Dieses Kapitel erörtert die historische Entwicklung und die Legitimation des Privatschulwesens in Deutschland. Es werden die sozialen, pädagogischen und gesellschaftlichen Funktionen privater Schulen analysiert, darunter die Kompensation staatlicher Defizite, die Rolle als Reformmotor und die Bewahrung kultureller Identität. Die historische Entwicklung vom Hausunterricht zur staatlichen Schule und die Bedeutung des Grundgesetzes werden diskutiert.
5. Der Boom der Privatschulen – Mythos oder Realität?: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse statistischer Daten zur Entwicklung von Privatschulen und -schülern in Deutschland von 1992 bis 2009. Die Daten werden nach verschiedenen Kriterien (Bundesländer, Trägerorganisationen, Schularten) aufgeschlüsselt und auf einen möglichen „PISA-Effekt“ untersucht. Es wird festgestellt, dass es tatsächlich einen Boom der Privatschulen gibt, der aber nicht allein auf die PISA-Studien zurückzuführen ist.
6. Das ’Versagen’ der staatlichen Schulen: Dieses Kapitel untersucht die These vom „Versagen“ staatlicher Schulen und den damit verbundenen Forderungen nach mehr Wettbewerb im Schulsystem. Es werden internationale und nationale Studien zum Leistungsvergleich zwischen staatlichen und privaten Schulen analysiert, wobei die Komplexität der Thematik und die Bedeutung der institutionellen Rahmenbedingungen hervorgehoben werden. Es wird argumentiert, dass ein signifikanter Leistungsunterschied zwischen privaten und staatlichen Schulen in Deutschland nicht belegt ist.
7. Die Expansion der Privatschulen und ihre Ursachen: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für die Expansion der Privatschulen. Der Strukturwandel der Familie, das veränderte Verständnis von Elternschaft und Bildungsdruck, die Ökonomisierung der Bildung und die Auswirkungen der Globalisierung (GATS) werden als zentrale Faktoren diskutiert. Es wird der Einfluss auf die soziale Ungleichheit und die Segmentierung der Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Privatschulen, staatliche Schulen, Chancengleichheit, PISA-Studie, Bildungssystem, Schulwahlmotive, Privatschuleffekt, Sozialkapital, Ökonomisierung der Bildung, Globalisierung, Familienstruktur, Bildungsdruck, Ersatzschule, Ergänzungsschule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Der Boom der Privatschulen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht den Anstieg der Privatschulen in Deutschland und analysiert, ob dieser auf ein vermeintliches „Versagen“ der staatlichen Schulen zurückzuführen ist. Sie beleuchtet die quantitative Entwicklung der Privatschulen, vergleicht die Leistungen von Schülern an staatlichen und privaten Schulen und untersucht die Motive von Eltern und Schülern bei der Schulwahl. Schließlich werden die Ursachen für die Expansion des Privatschulwesens erörtert.
Welche zentralen Fragen werden in der Studie behandelt?
Die Studie befasst sich mit folgenden zentralen Fragen: Wie hat sich die Anzahl der Privatschulen in Deutschland quantitativ entwickelt? Unterscheiden sich die Leistungen von Schülern an staatlichen und privaten Schulen? Welche Faktoren beeinflussen die Schulwahlentscheidungen von Eltern? Welche Perspektiven haben Schüler bezüglich der Schulwahl? Welche Ursachen liegen der Expansion des Privatschulwesens zugrunde? Trägt das Privatschulwesen zur Chancengleichheit bei?
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Arbeitsgrundlage und methodologische Überlegungen, Die Privatschule im deutschen Schulwesen – Rechtliche Grundlagen, Legitimation und Funktionen des Privatschulwesens, Der Boom der Privatschulen – Mythos oder Realität?, Das ’Versagen’ der staatlichen Schulen, Die Expansion der Privatschulen und ihre Ursachen und Fazit.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas. Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, Kapitel 4 die Legitimation und Funktionen, Kapitel 5 die quantitative Entwicklung, Kapitel 6 den Vergleich der Leistungen staatlicher und privater Schulen, Kapitel 7 die Ursachen der Expansion und Kapitel 8 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Einleitung und das Kapitel zu Methodik und Arbeitsgrundlage bilden den Rahmen der Untersuchung.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden. Quantitative Daten zur Entwicklung der Privatschulen werden analysiert und ausgewertet. Die Studie stützt sich auf Statistiken, um die quantitative Entwicklung zu belegen und Leistungsvergleiche durchzuführen. Die methodische Vorgehensweise wird im zweiten Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Studie zeigt eine signifikante Zunahme an Privatschulen in Deutschland. Es wird ein Leistungsvergleich zwischen Schülern staatlicher und privater Schulen durchgeführt, wobei die Komplexität des Themas und die Bedeutung der institutionellen Rahmenbedingungen hervorgehoben werden. Die Ursachen für die Expansion des Privatschulwesens werden in verschiedenen Faktoren wie dem Strukturwandel der Familie, dem Bildungsdruck und der Ökonomisierung der Bildung gesehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Boom der Privatschulen in Deutschland komplexen Ursachen hat und nicht allein auf ein „Versagen“ der staatlichen Schulen zurückzuführen ist. Es wird die Bedeutung verschiedener gesellschaftlicher und ökonomischer Faktoren für die Entwicklung des Privatschulwesens hervorgehoben. Die Ergebnisse werden im Schlusskapitel zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Privatschulen, staatliche Schulen, Chancengleichheit, PISA-Studie, Bildungssystem, Schulwahlmotive, Privatschuleffekt, Sozialkapital, Ökonomisierung der Bildung, Globalisierung, Familienstruktur, Bildungsdruck, Ersatzschule, Ergänzungsschule.
- Quote paper
- Martin Köhler (Author), 2011, Privatschulen: Der Einstieg in das Karrierenetzwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192328