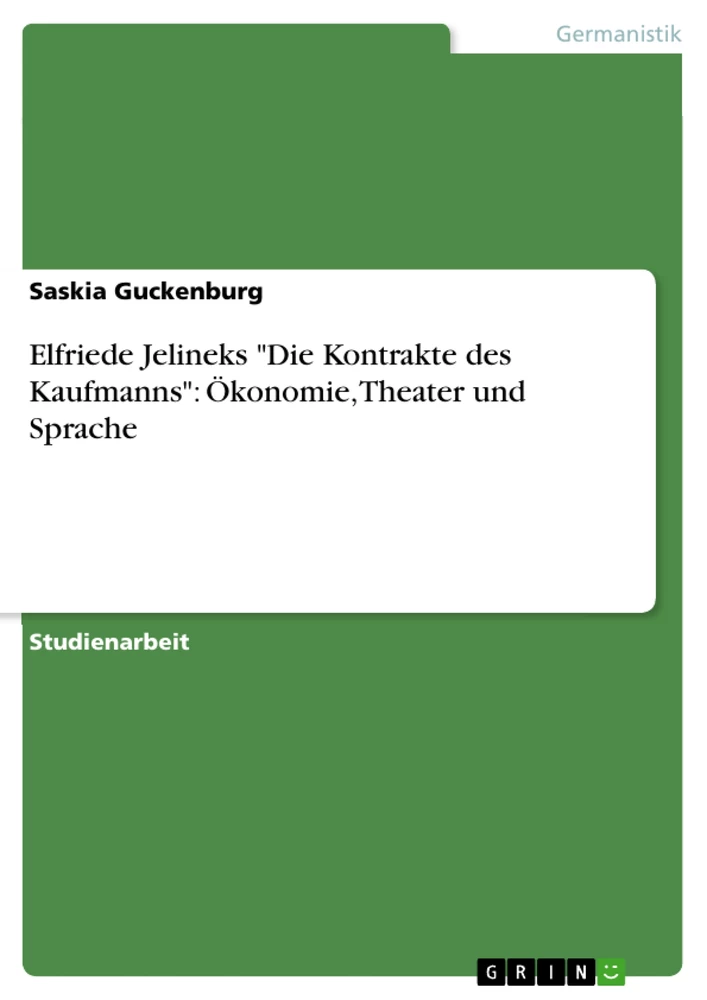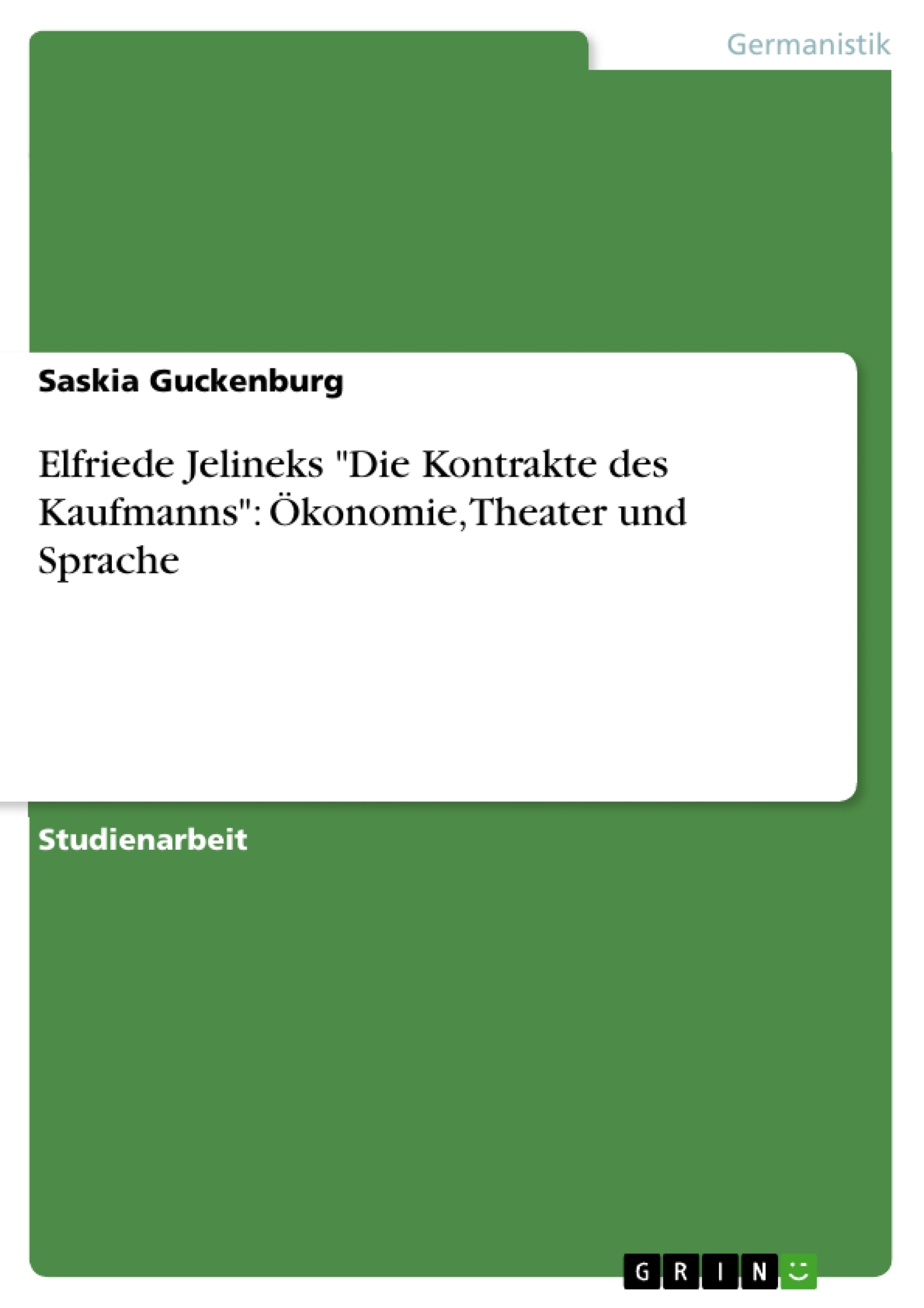Die Nobelpreisträgerin verarbeitet in ihrem Werk Die Kontrakte des Kaufmanns den Skandal um das Meinl-Unternehmen, welches das Geld ihrer Anleger in Offshore-Zertifikaten versi-ckern ließ. Desweiteren thematisiert sie den Skandal um die Gewerkschaftsbank BAWAG, die sich 2007 mit Arbeiterpensionen verspekuliert hatte. Besonders viele Rentner hatten im Vertrauen auf Rendite ihr Erspartes investiert und anschließend verloren. Jelinek reagierte sofort und noch bevor es zur weltweiten Wirtschaftskrise kam, hatte Jelinek schon das erste Drama darüber verfasst, welches sie zynisch als „Wirtschaftskomödie“ tituliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theaterästhetik Elfriede Jelineks
- Äußere Form
- Figuren, Kommunikation und Handlung
- Sprache und Stil
- Die Sprache der Finanzwelt
- Semantische Instabilität
- Bildlichkeit
- Wortschatz
- Methode der Montage
- Literatur der Klassik und Moderne
- Märchen
- Sprichwörter und Weisheiten
- Griechische Mythologie
- Werbung
- Theater und Film
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Elfriede Jelineks Stück „Die Kontrakte des Kaufmanns“ und beleuchtet die dekonstruktivistische Dramenästhetik sowie die spezifischen Sprach- und Stilmerkmale des Werkes. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Finanzskandalen und der Kritik am Kapitalismus durch Jelinek.
- Dekonstruktion traditioneller Theaterformen
- Die Sprache der Finanzwelt und ihre Ambivalenz
- Jelineks experimenteller Umgang mit Sprache und Stil
- Die Montagetechnik und die Verwendung von intertextuellen Anspielungen
- Die Kritik am Kapitalismus und seinen Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit vor und skizziert den Hintergrund von Jelineks Stück „Die Kontrakte des Kaufmanns“, welches auf realen Finanzskandalen beruht. Es wird auch auf die Methodik der Arbeit hingewiesen.
Das Kapitel „Die Theaterästhetik Elfriede Jelineks“ analysiert den dekonstruktivistischen Dramenstil Jelineks anhand ihres Stückes. Die Abweichung von traditionellen Gattungskonventionen und die Verzerrung der aristotelischen Einheiten von Ort, Zeit und Handlung werden beleuchtet.
Im Kapitel „Sprache und Stil“ wird Jelineks spezifische Schreibweise untersucht. Die Doppelbödigkeit der Finanzsprache, die semantische Instabilität und die Verwendung von Bildern und Metaphern werden analysiert.
Das Kapitel „Methode der Montage“ erklärt, wie Jelinek einzelne Fragmente aus verschiedenen Quellen in ihrem Stück verbindet. Die Verwendung von literarischen Zitaten, Märchen, Sprichwörtern, griechischen Mythen, Werbung und Theater- und Filminhalten wird untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Elfriede Jelinek, „Die Kontrakte des Kaufmanns“, Dekonstruktion, Theaterästhetik, Sprache, Stil, Finanzskandale, Kapitalismuskritik, Montagetechnik, Intertextualität.
- Quote paper
- Saskia Guckenburg (Author), 2010, Elfriede Jelineks "Die Kontrakte des Kaufmanns": Ökonomie, Theater und Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191990