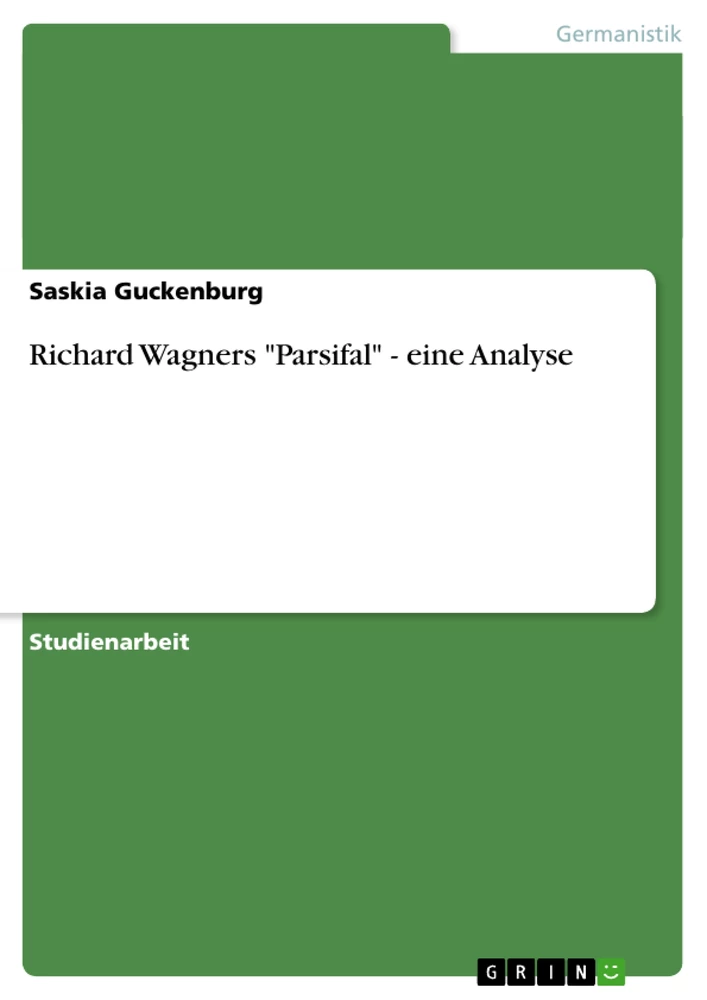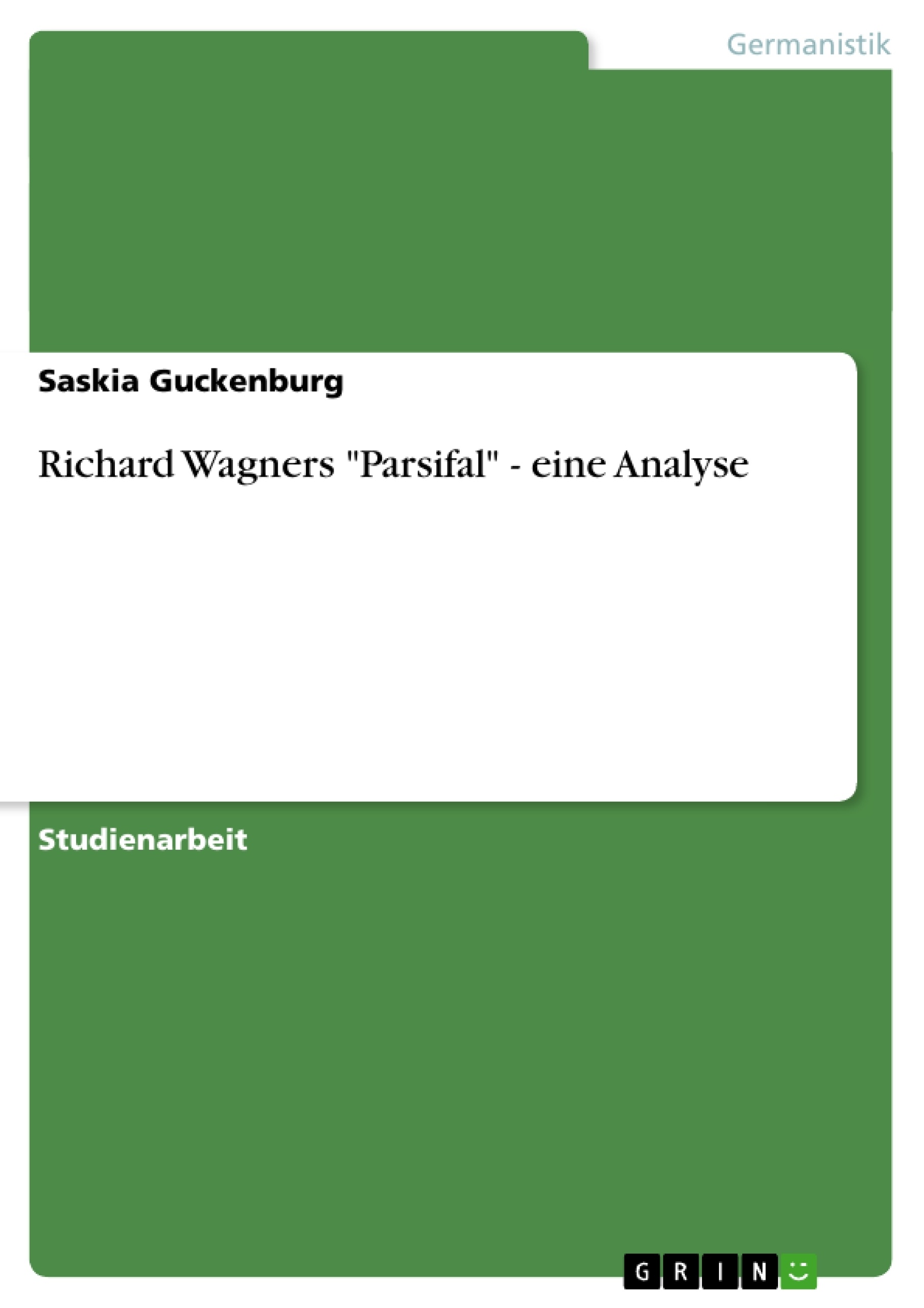Die Oper Parsifal ist Wagners spätestes Werk. Während seiner Arbeit an den Opernstücken Tannhäuser und Die Meistersinger von Nürnberg beschäftigte er sich 1845 in Marienbad erstmals mit dem Parzival-Stoff. Vierzig Jahre später, und damit nur ein Jahr vor seinem Tod, wurde das sogenannte „Bühnenweihfestspiel“ 1882 in Bayreuth urauf-geführt. Der dreißigjährigen Schutzfrist folgend durfte das „Bühnenweihfestspiel“ nur dort aufgeführt werden. Jedoch fand 1903 an der New Yorker Met eine nicht autorisier-te Aufführung statt und ist als „Gralsraub“ in die Geschichte eingegangen. Lange Zeit, und zum Teil auch noch heute, galt während und nach den Aufführungen ein Applausverbot aufgrund des religiösen Charakters. Jedoch hatte sich Wagner nie ausdrücklich gegen das Applaudieren ausgesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung und Rezeption
- Das Verhältnis von Kunst und Religion
- Der Unsagbarkeitstopos
- Abendmahlszene
- Das Siechtum des Amfortas
- Mitleiden, Erlösung und Abwendung der Erotik
- Raum und Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Richard Wagners "Parsifal", das letzte Werk des Komponisten, befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Kunst und Religion. Die Arbeit untersucht die Entstehung des Bühnenweihfestspiels, seine Rezeption sowie die Einbindung christlicher und buddhistischer Elemente. Der Fokus liegt auf Wagners Interpretation des Parzival-Stoffes und seiner Kritik an der Institutionalisierung von Religion.
- Der Einfluss von Religion auf die Kunst
- Die Rolle des Mitleidens in der Erlösung
- Die Bedeutung des Unsagbarkeitstopos
- Die Ambivalenz von Kunst und Religion
- Die Kritik an der dogmatischen Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Entstehung und Rezeption
Das Kapitel beleuchtet die Entstehung und Rezeption von "Parsifal". Es wird die lange Entwicklungsphase des Werkes sowie die Bedeutung der Uraufführung in Bayreuth und die daraus resultierende "Gralsraub"-Kontroverse beschrieben. Zudem wird auf Wagners Behauptung einer "Karfreitagslegende" eingegangen und die Inspiration durch Wolfram von Eschenbachs "Parzival" hervorgehoben.
Das Verhältnis von Kunst und Religion
Dieses Kapitel analysiert Wagners Auffassung von Kunst und Religion im Kontext der Goethezeit. Es wird die Idee einer "Ersatzreligion" durch Kunst und Wagners Kritik an der Institutionalisierung der Kirche behandelt. Die Argumentation bezieht sich auf Wagners Schrift "Religion und Kunst" und seine Interpretation des Christentums.
Der Unsagbarkeitstopos
Der Unsagbarkeitstopos des Grals wird in diesem Kapitel untersucht. Die Frage Parsifals nach der Identität des Grals führt zu dessen Personifikation und dem Aufzeigen der Grenzen des rationalen Denkens. Die Bedeutung des "unwissenden Thors" Parsifal wird hier herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Kunst und Religion, Erlösung, Mitleid, der Unsagbarkeit des Grals, Wagner und seine Werke, sowie dem Einfluss Schopenhauers und Nietzsches auf Wagners Schaffen. Die Untersuchung analysiert insbesondere die Ambivalenz von Religion und Kunst in Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal".
- Quote paper
- Saskia Guckenburg (Author), 2011, Richard Wagners "Parsifal" - eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191989