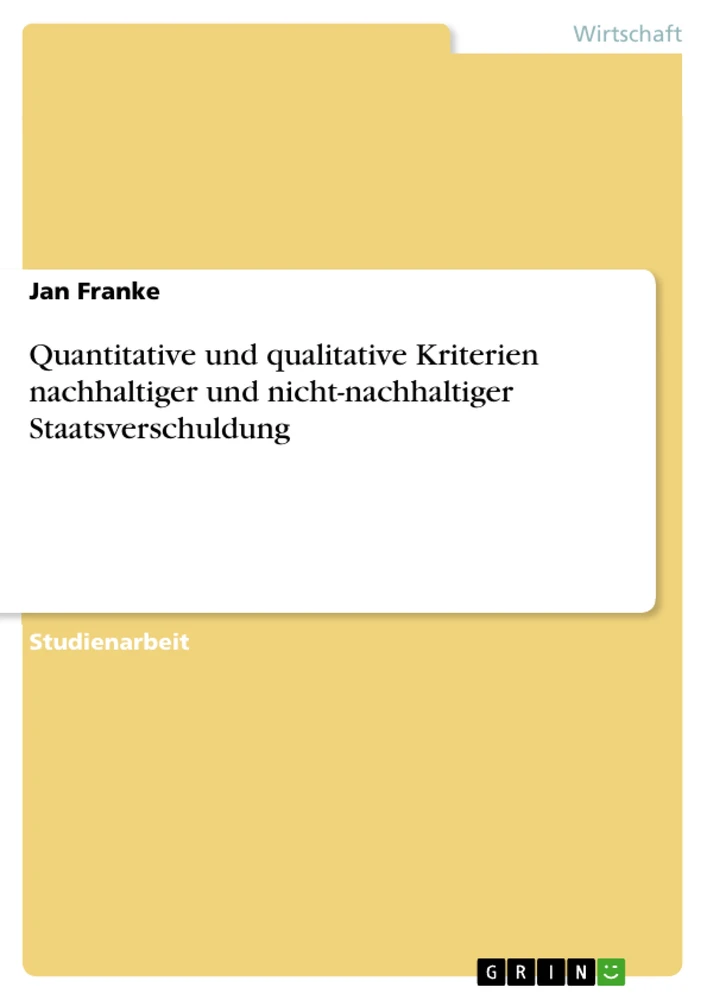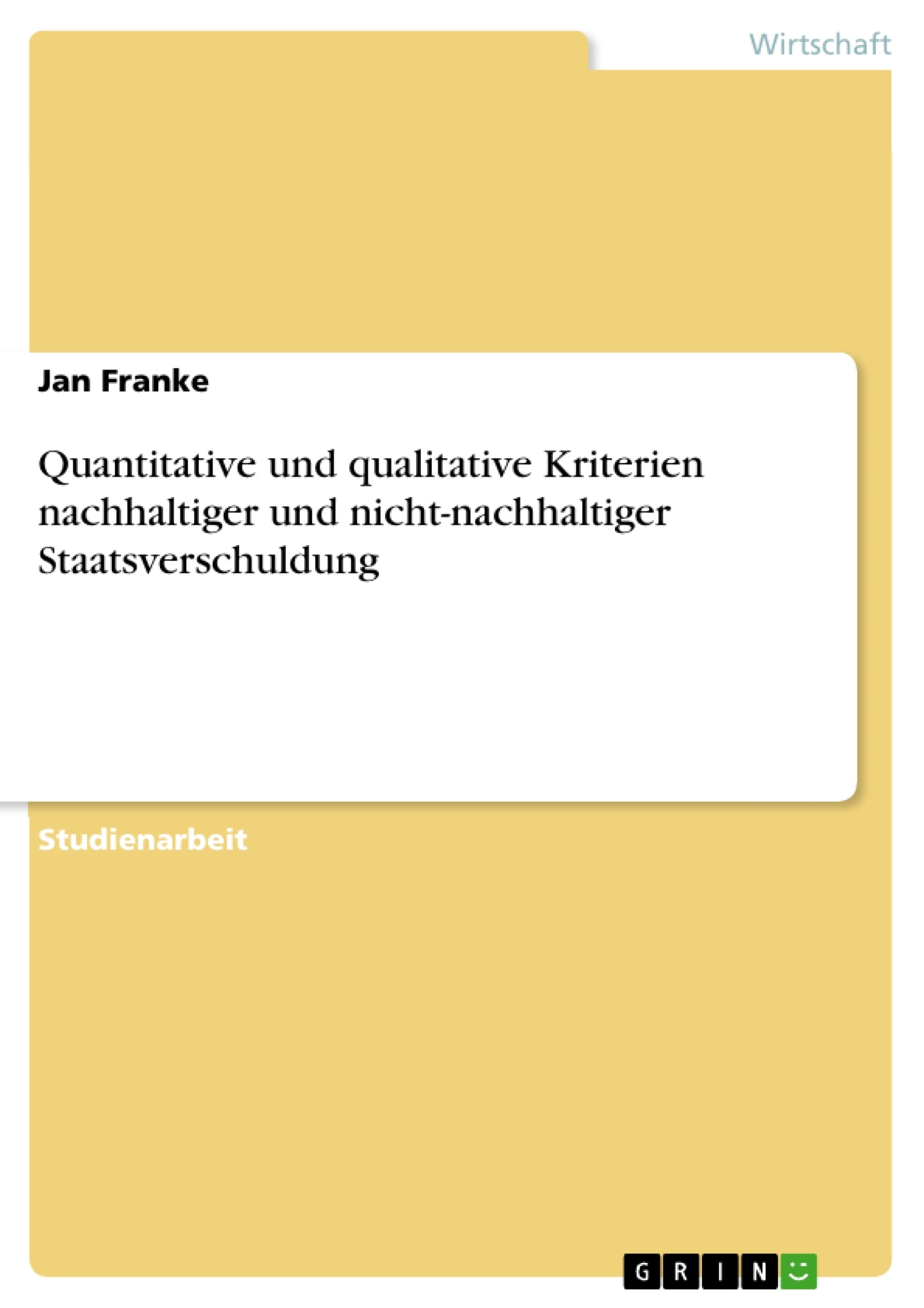Der Begriff „nachhaltig“ hat seine Wurzeln in der Forstwirtschaft. Hans Carl von Carlowitz empfahl es, einen „Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine continuirliche beständige und nahhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentberliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse [d.h. Dasein] nicht bleiben mag“. Hatte „nachhaltig“ ursprünglich die Bedeutung „kontinuierlich“, so ist heute ist eine Bedeutungsebene immanenter Bestandteil geworden, die früher nur Folge oder Implikation war: „intertemporal gerecht“. „Verschuldung“ bezeichnet die Verlagerung zukünftigen Konsums in die Gegenwart. Das verträgt sich nur mit Nachhaltigkeit, wenn es morgen mehr zu konsumieren gibt, als heute. Diese restriktive Definition wird in der Nachhaltigkeitsanalyse der Staatsverschuldung „NAS“ üblicherweise zugunsten einer Interpretation i.S. „dauerhafter Tragfähigkeit“ auf- gegeben. Diese klammert die Gerechtigkeitsfrage aus und ist erfüllt, sobald sich langfristig kein Bankrott einstellt5. Diesem Vorgehen folgend, soll in der vorliegenden Arbeit dem Verteilungsaspekt nur untergeordnete Bedeutung beigemessen werden. Im ersten Abschnitt des 2. Teils werden daher zunächst „reine“ NAS-Methoden beleuchtet, während im zweiten Teil eine Methode zur Analyse der Generationengerechtigkeit vorgestellt wird.
Eine erste umfangreiche Analyse der Nachhaltigkeit von Fiskalpolitik lieferte Domar (1944), der zeigte, dass Schuldenquoten und nicht Absolutwerte von Bedeutung sind. Damit war er der Initiator einer, fortan geführten Diskussion, in deren Verlauf immer deutlicher wurde: „Eindimensionale“ Kriterien einer nachhaltigen Verschuldung gibt es nicht. Daher wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ und sein Bezug zur Staatsverschuldung
- 2. Nachhaltigkeitsindikatoren
- 2.1. Finanzierungssaldo
- 2.2. Intertemporale staatliche Budgetrestriktion
- 2.2.1. Grundkonzept
- 2.2.2. „No-Ponzi-Game“-Bedingung
- 2.2.3. Beurteilung als Nachhaltigkeitsindikator
- 2.3. „OECD-Indikator“ nach Blanchard
- 2.3.1. Grundkonzept
- 2.4. Nachhaltigkeitskonzept der Europäischen Union
- 2.4.1. Grundkonzept
- 2.4.2. Interpretation und Implikationen der Maastricht-Kriterien
- 2.4.3. Umsetzung der Maastricht-Kriterien in einen Nachhaltigkeitsindikator
- 2.4.4. Bewertung der „EU-Nachhaltigkeitsindikatoren“
- 2.5. Generationenbilanzierung
- 2.6. Nachhaltigkeit und Goldene Regel
- 2.7. Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung unter Unsicherheit
- 3. Fazit - Liegt Nachhaltigkeit im Auge des Betrachters?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Staatsverschuldung. Ziel ist es, verschiedene quantitative und qualitative Kriterien zur Beurteilung nachhaltiger und nicht-nachhaltiger Staatsverschuldung zu analysieren und zu bewerten. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Anwendbarkeit.
- Definition von Nachhaltigkeit im Kontext der Staatsverschuldung
- Analyse verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren (Finanzierungssaldo, intertemporale Budgetrestriktion, OECD-Indikator, EU-Konzept)
- Bewertung der Stärken und Schwächen der einzelnen Indikatoren
- Einbezug des Aspekts der Generationengerechtigkeit
- Diskussion der Rolle von Unsicherheit bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ und sein Bezug zur Staatsverschuldung: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Nachhaltigkeit“, ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammend, und dessen Entwicklung zu einer intertemporal gerechten Verteilung von Ressourcen. Es wird der Gegensatz zwischen der ursprünglichen Bedeutung von „kontinuierlich“ und der heutigen, erweiterten Bedeutung von „intertemporal gerecht“ herausgestellt. Die Arbeit fokussiert sich auf die „dauerhafte Tragfähigkeit“ als Kriterium, wobei der Gerechtigkeitsaspekt eine untergeordnete Rolle spielt. Der Bezug zur Staatsverschuldung wird hergestellt, indem die Verlagerung zukünftigen Konsums in die Gegenwart als Kernproblem definiert wird, welches nur dann nachhaltig ist, wenn zukünftig mehr zu konsumieren ist als in der Gegenwart. Die Arbeit von Domar (1944) wird als Ausgangspunkt für die Diskussion um die Komplexität von Kriterien für nachhaltige Staatsverschuldung genannt, welche die Grundlage für die Entwicklung zahlreicher Nachhaltigkeitsindikatoren darstellt.
2. Nachhaltigkeitsindikatoren: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Indikatoren zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Staatsverschuldung. Der Finanzierungssaldo, oft als Nettoneuverschuldung bezeichnet, wird als unzureichend bewertet, da er von Faktoren wie Preisindizes, Zinssätzen und kurzfristigen politischen Maßnahmen beeinflusst wird und die Trennung zwischen konjunkturellen und strukturellen Einflüssen schwierig ist. Die intertemporale staatliche Budgetrestriktion (ISBR) wird als zentrales Konzept eingeführt, welches die dauerhafte Tragfähigkeit durch die Einhaltung der Bedingung beschreibt, dass die aktuelle Staatsschuld maximal den Barwert aller zukünftigen Primärüberschüsse betragen darf. Die Formel zur Berechnung der Tragfähigkeitslücke wird präsentiert und erklärt. Weitere Indikatoren wie der OECD-Indikator nach Blanchard und das Nachhaltigkeitskonzept der Europäischen Union (Maastricht-Kriterien) werden ebenfalls diskutiert. Das Kapitel behandelt auch die Generationenbilanzierung und die Anwendung der Goldenen Regel im Kontext der Staatsverschuldung und berücksichtigt die Herausforderungen der Nachhaltigkeit unter Unsicherheit.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Staatsverschuldung, Nachhaltigkeitsindikatoren, Finanzierungssaldo, Intertemporale staatliche Budgetrestriktion (ISBR), Tragfähigkeit, Generationengerechtigkeit, Maastricht-Kriterien, OECD-Indikator, Unsicherheit, Domar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Nachhaltigkeit und Staatsverschuldung
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Staatsverschuldung. Sie analysiert und bewertet verschiedene quantitative und qualitative Kriterien zur Beurteilung nachhaltiger und nicht-nachhaltiger Staatsverschuldung und konzentriert sich dabei auf die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Anwendbarkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Kriterien zur Beurteilung nachhaltiger und nicht-nachhaltiger Staatsverschuldung zu analysieren und zu bewerten. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Anwendbarkeit im Kontext der Staatsverschuldung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Nachhaltigkeit im Kontext der Staatsverschuldung, die Analyse verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren (Finanzierungssaldo, intertemporale Budgetrestriktion, OECD-Indikator, EU-Konzept), die Bewertung der Stärken und Schwächen der einzelnen Indikatoren, den Aspekt der Generationengerechtigkeit und die Diskussion der Rolle von Unsicherheit bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit.
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Finanzierungssaldo, die intertemporale staatliche Budgetrestriktion (ISBR), den OECD-Indikator nach Blanchard, das Nachhaltigkeitskonzept der Europäischen Union (inklusive der Maastricht-Kriterien), die Generationenbilanzierung und die Goldene Regel im Kontext der Staatsverschuldung.
Wie wird der Begriff „Nachhaltigkeit“ definiert?
Die Arbeit beleuchtet den Begriff „Nachhaltigkeit“ in seiner Entwicklung von der ursprünglichen forstwirtschaftlichen Bedeutung („kontinuierlich“) hin zur heutigen, erweiterten Bedeutung von „intertemporal gerecht“. Der Fokus liegt auf der „dauerhaften Tragfähigkeit“ als Kriterium, wobei der Gerechtigkeitsaspekt eine untergeordnete Rolle spielt. Im Kontext der Staatsverschuldung wird die Verlagerung zukünftigen Konsums in die Gegenwart als Kernproblem definiert.
Was ist die intertemporale staatliche Budgetrestriktion (ISBR)?
Die ISBR ist ein zentrales Konzept, das die dauerhafte Tragfähigkeit beschreibt. Sie besagt, dass die aktuelle Staatsschuld maximal den Barwert aller zukünftigen Primärüberschüsse betragen darf. Die Arbeit präsentiert und erklärt die Formel zur Berechnung der Tragfähigkeitslücke.
Welche Rolle spielt die Unsicherheit bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen, die die Unsicherheit bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Staatsverschuldung mit sich bringt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit fragt abschließend, ob Nachhaltigkeit letztlich im Auge des Betrachters liegt, da verschiedene Indikatoren zu unterschiedlichen Bewertungen führen können.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltigkeit, Staatsverschuldung, Nachhaltigkeitsindikatoren, Finanzierungssaldo, Intertemporale staatliche Budgetrestriktion (ISBR), Tragfähigkeit, Generationengerechtigkeit, Maastricht-Kriterien, OECD-Indikator, Unsicherheit, Domar.
- Quote paper
- Jan Franke (Author), 2011, Quantitative und qualitative Kriterien nachhaltiger und nicht-nachhaltiger Staatsverschuldung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191753