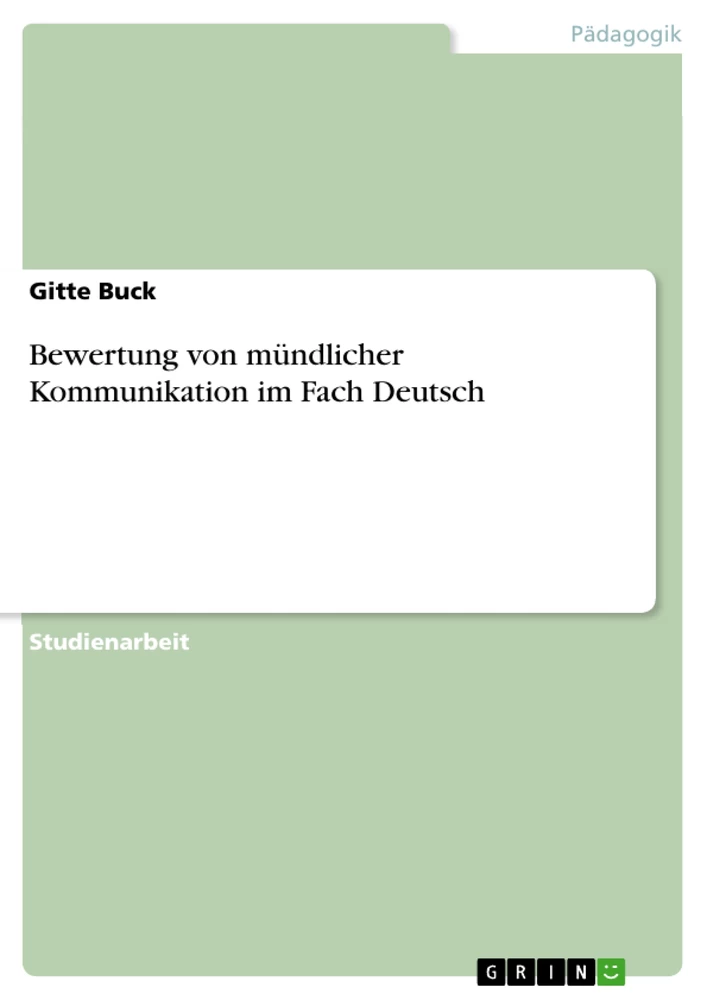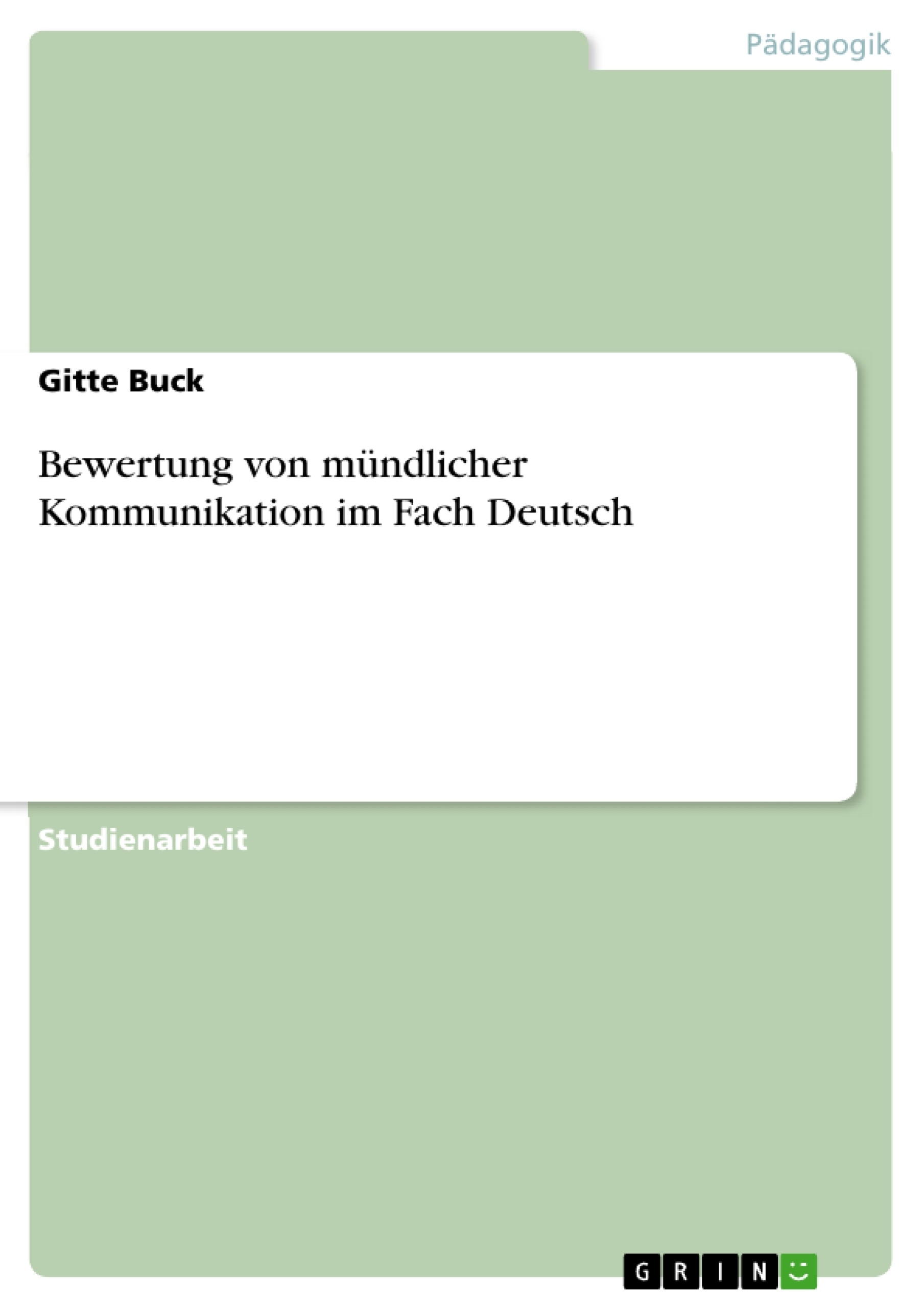1. Einleitung
„Sprache ist eine komplexe, hochentwickelte Fähigkeit, die sich ohne bewusste Anstrengung oder formale Unterweisung beim Kind ganz spontan entwickelt und sich entfaltet, ohne dass das Kind sich der zugrundeliegenden Logik bewusst wird; sie ist qualitativ bei allen Menschen gleich und von allgemeineren Fähigkeiten wie dem Verarbeiten von Informationen oder intelligenten Verhalten zu trennen.“
Sprache ist also in den Erbanlagen verankert, eine Fähigkeit, die man - im Normalfall - nicht erlernen muss.
In einer soziobiologischen Studie von Dunbar aus dem Jahr 1996 wurde festgestellt, das sich „die phylogenetische Entwicklung der Sprache an der kommunikativen Interaktion von zwei bis drei Individuen orientiert“ , d.h. kommen zu einem Gespräch Menschen hinzu, teilt sich die Gruppe quasi automatisch in mehrere 2er und 3er Gruppen auf. Denn, um in einer größeren Gruppe ein Gespräch zu führen, bedarf es rhetorischer Fähigkeiten, die wiederum nicht angeboren sind.
Hier kommen wir nun zur Gesprächsfähigkeit, die beim Menschen nicht genetisch veranlagt ist, die aber elementar ist, für jegliche mündliche Leistung.
„Gesprächsfähig sind Kinder, wenn sie sachangemessen und partnerbezogen miteinander sprechen. Sie finden sich in verschiedenen gegebenen Gesprächssituationen zurecht und können Sprecher- und Hörerrollen einnehmen, einen Gegenstand oder Sachverhalt richtig erfassen und verständlich wiedergeben, als Person authentisch sein und sich in Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen an vereinbarte Regeln halten. In schwierigen Situationen ergreifen sie die Möglichkeit zur Metakommunikation und thematisieren problematische Punkte.“
Dies bedeutet, ein grundlegendes Ziel muss es sein, Kinder gesprächsfähig zu machen. Mit der Gesprächsfähigkeit erlangen sie eine Befähigung, die wertvoll, ja elementar für ihr gesamtes schulisches, später berufliches, aber auch privates Leben ist. Will man eine Fähigkeit sinnvoll ausbilden, bedarf es einer permanenten Leistungskontrolle, um Stärken und Schwächen heraus zu finden, um diese dann wieder rum bestmöglichst zu unterstützen und zu fördern.
In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, wie man mündliche Kommunikation bewerten kann? Wo treten dabei Probleme auf? Wo liegen die Grenzen?
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Lernbereich Sprechen
- Kriterien der mündlichen Leistungserfassung
- Funktionen der Bewertung mündlicher Schülerleistung
- Bewertungshilfen bei der Beurteilung mündlichen Leistung
- Probleme bei der Bewertung von mündlicher Kommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Bewertung mündlicher Kommunikation im Fach Deutsch zu beleuchten und die Herausforderungen dabei zu analysieren.
- Die Bedeutung von Sprechen im Deutschunterricht und die Entwicklung der kommunikativen Wende
- Kriterien und Funktionen der Bewertung mündlicher Schülerleistung
- Mögliche Bewertungshilfen und praktische Ansätze zur Beurteilung
- Probleme und Grenzen bei der Bewertung mündlicher Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Rolle der Sprache im menschlichen Leben und die Bedeutung von Gesprächsfähigkeit für Kinder. Sie führt in das Thema der Bewertung mündlicher Kommunikation ein und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Der Lernbereich Sprechen: Dieses Kapitel beleuchtet den Lernbereich Sprechen im Deutschunterricht und stellt die Bedeutung der kommunikativen Wende und die im Bildungsplan verankerten Ziele für die Sprachentwicklung von Schülerinnen und Schülern dar.
- Kriterien der mündlichen Leistungserfassung: Hier werden verschiedene Kriterien für die Bewertung mündlicher Schülerleistung vorgestellt, die bei der Analyse von mündlicher Kommunikation herangezogen werden können.
- Funktionen der Bewertung mündlicher Schülerleistung: Dieses Kapitel erläutert die Funktionen von Leistungsbewertung im Allgemeinen und geht auf die spezifischen Funktionen der Bewertung von mündlichen Schülerleistungen ein.
- Bewertungshilfen bei der Beurteilung mündlicher Leistung: Hier werden verschiedene Bewertungshilfen vorgestellt, die Lehrkräften bei der Beurteilung von mündlichen Leistungen helfen können.
- Probleme bei der Bewertung von mündlicher Kommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, die bei der Bewertung von mündlicher Kommunikation auftreten können.
Schlüsselwörter
Mündliche Kommunikation, Bewertung, Deutschunterricht, Gesprächsfähigkeit, Bildungsplan, kommunikative Wende, Leistungserfassung, Kriterien, Funktionen, Probleme, Grenzen, Bewertungshilfen.
- Quote paper
- Gitte Buck (Author), 2010, Bewertung von mündlicher Kommunikation im Fach Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191666