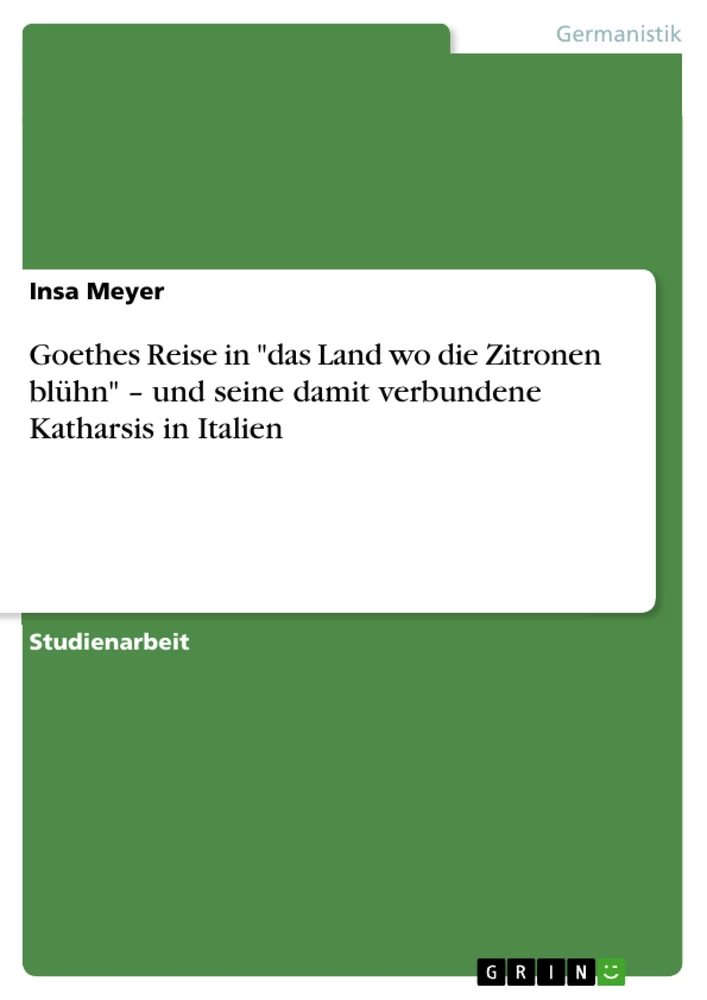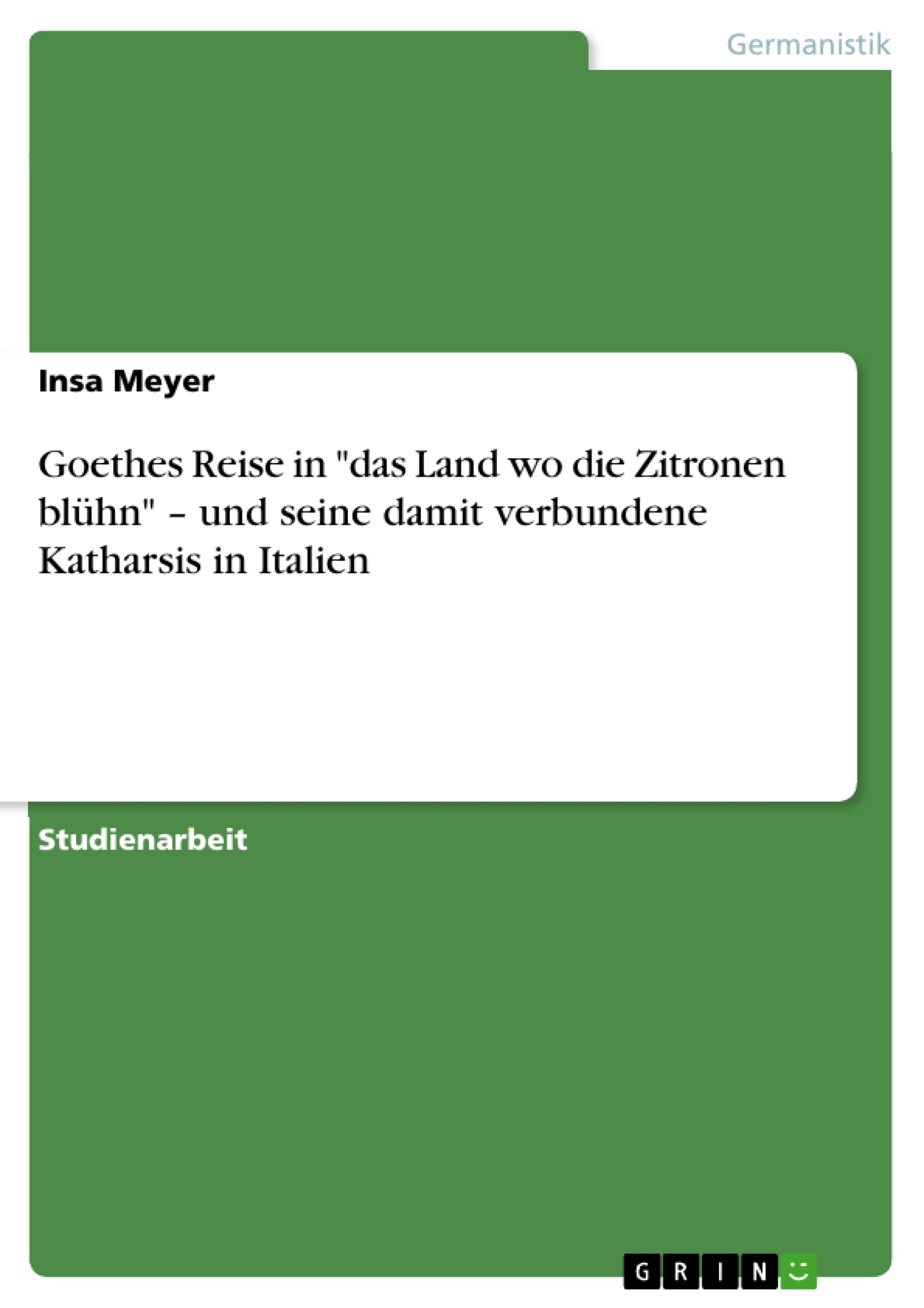„[...] Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll,
So ist das Leben mir kein Leben mehr.
Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, [...]“
lauten bedeutende Worte, die Goethe seinem noch vor der Italienfahrt begonnenen „Tasso“ (1780) in den Mund gelegt hat. Mit dem Gleichnis des Seidenwurms formuliert er seinen eigenen Status quo und trägt die für ihn als tragisch empfundene „Disproportion des Talents mit dem Leben“ in die Welt: Goethe konnte nicht mehr spinnen, er fühlte sich seiner lebensnotwendigen Tätigkeit beraubt, räumte ihm doch seine Umwelt, die Weimarer Gesellschaft, nicht die Freiheit ein, die er benötigte. Der Hof brauchte jemanden, der funktioniert, der auf Bestellung texten kann – das wollte und konnte Goethe nicht, das Genie will dichten! Wie der Seidenwurm nur spinnen will!
Das Werk „Die Italienische Reise“ zählt zu den wichtigsten autobiographischen Dokumenten Goethes. Sie stellt eine Komposition seiner Reiseaufzeichnungen und Korrespondenz aus den Jahren 1786 – 1788 und vielen erst später verfassten Berichten, Essays und Reflexionen dar. Bei dem Werk handelt es sich gattungsmäßig nicht um ein Reisebuch, sondern um „autobiographische Spätwerke, die aus der Distanz von jeweils drei – im Falle des Zweiten Römischen Aufenthalts sogar vier – Jahrzehnten verfasst sind.“ Insofern gibt „Die Italienische Reise“ Goethe die Möglichkeit, sich selbst darzustellen (das Thema ist Goethe ), aber auch mittelbar Stellung zur ästhetischen Situation um 1815 zunehmen – „eine indirekte Polemik gegen die Romantik und ihren Kultus des Mittelalters.“
Diese Hausarbeit soll den Weg Goethes zum Klassiker dokumentieren aber auch Diskrepanzen aufzeigen, die auf seine selektive Wahrnehmung der Gegenstände in Italien zurückzuführen sind. Bei der Textarbeit beziehe ich mich auf die Siebente Auflage der Sonderausgabe von Beck der Italienischen Reise von 2002. Dieser liegt folgende Ausgabe zugrunde: Goethes Werke, Band XI (Hamburger Ausgabe), die ich mir erlaube in den Fußnoten mit „Goethe: IR“ abzukürzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ewige Sehnsucht und mannigfaltige Unzufriedenheit gipfeln in Flucht
- Das Reisemotiv Sehnsucht
- Das Reisemotiv Unzufriedenheit
- Die Flucht: 03. September 1786
- Klassizität
- Der Klassikbegriff
- Weimarer Klassik
- Goethes klassische Ästhetik
- Der klassische Boden
- Herangehensweise an die Kunst
- Folgen seines Kunstverständnisses
- Wiedergeburt
- Zum Schluss: Warum eigentlich „italienische Reise“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit soll den Weg Goethes zum Klassiker dokumentieren aber auch Diskrepanzen aufzeigen, die auf seine selektive Wahrnehmung der Gegenstände in Italien zurückzuführen sind.
- Goethes Italienreise als autobiographisches Dokument
- Die Rolle von Sehnsucht und Unzufriedenheit als Reisemotive
- Die Auseinandersetzung Goethes mit dem Klassikbegriff und der Weimarer Klassik
- Goethes klassische Ästhetik und ihre Folgen
- Die Bedeutung der Italienreise für Goethes künstlerische Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert Goethes „Tasso“ als Ausgangspunkt für die Analyse seiner Italienreise und stellt die Bedeutung des Werks „Die Italienische Reise“ für Goethes Biografie und die ästhetische Situation um 1815 heraus.
- Ewige Sehnsucht und mannigfaltige Unzufriedenheit gipfeln in Flucht: Dieser Abschnitt beleuchtet Goethes tiefe Sehnsucht nach Italien, die bereits in seiner Kindheit durch seinen Vater und seinen italienischen Hauslehrer geweckt wurde. Er beschreibt Goethes zunehmende Sehnsucht und die Entscheidung, nach Italien zu reisen.
- Klassizität: Dieses Kapitel erörtert den Klassikbegriff und die Weimarer Klassik. Es analysiert Goethes klassische Ästhetik und seine Auseinandersetzung mit dem „klassischen Boden“.
- Wiedergeburt: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Wiedergeburt Goethes nach seiner Italienreise und der Entwicklung seiner künstlerischen Vision.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Goethe, Italienische Reise, Klassizität, Weimarer Klassik, Sehnsucht, Unzufriedenheit, Flucht, Kunstverständnis, Wiedergeburt, Katharsis.
- Quote paper
- Insa Meyer (Author), 2010, Goethes Reise in "das Land wo die Zitronen blühn" – und seine damit verbundene Katharsis in Italien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191656