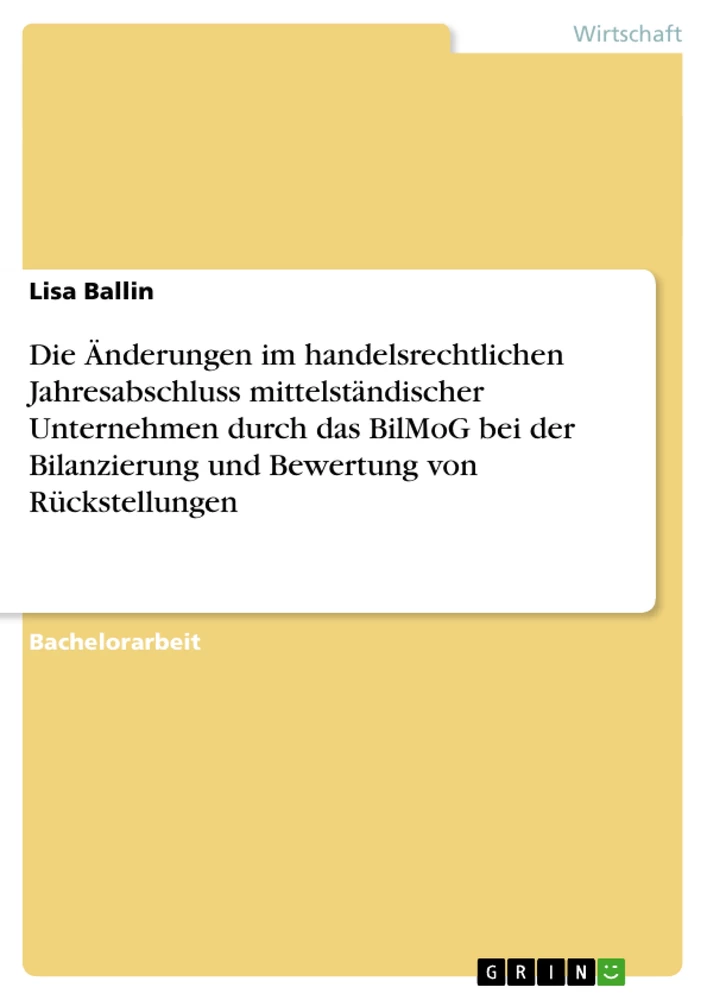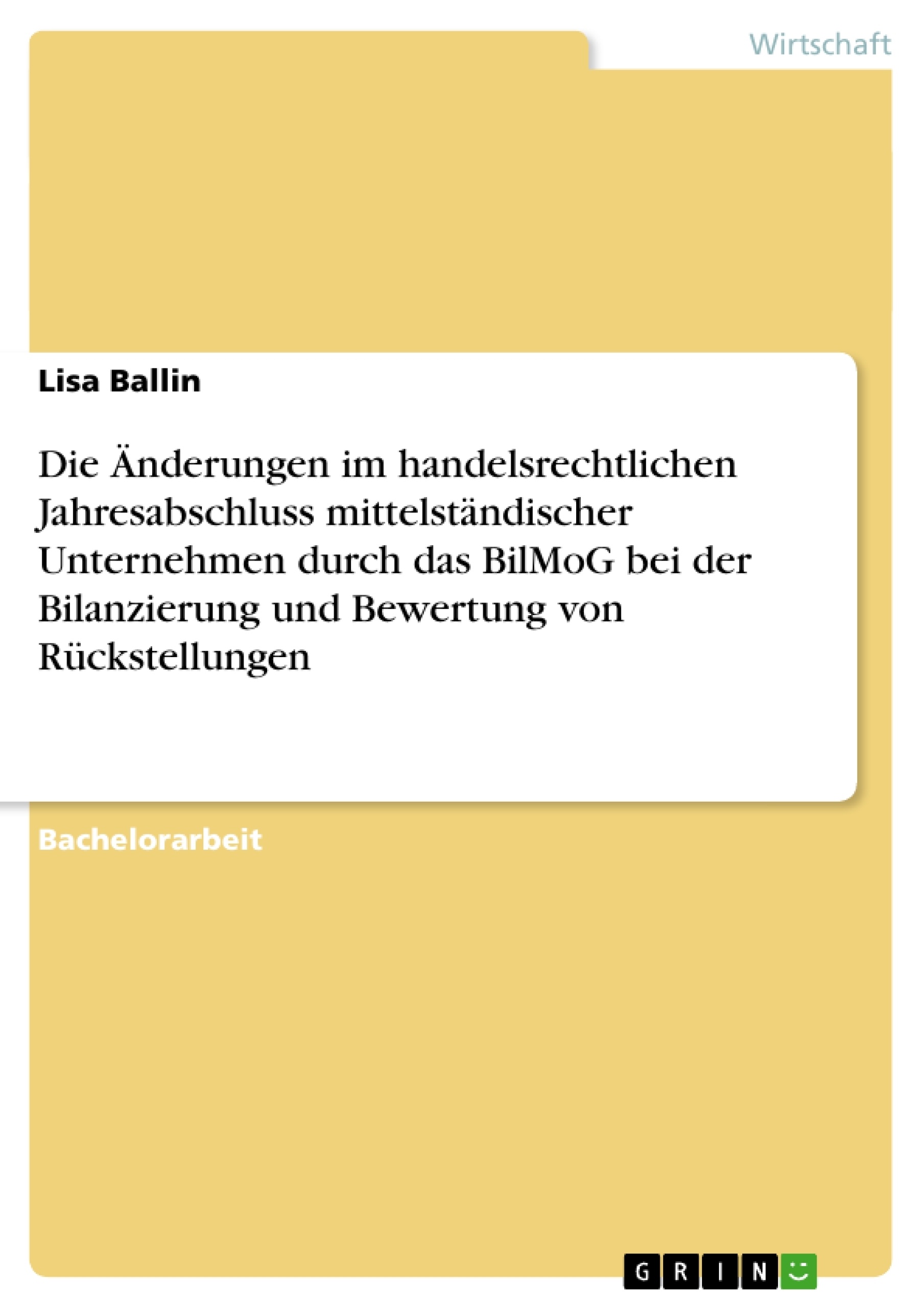Am 29. Mai 2009 ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in Kraft getreten.
Damit hat es die wahrscheinlich bedeutendste und umfassendste Reformierung der nationalen Rechnungslegungs- und Prüfungsvorschriften seit dem Bilanzrichtliniengesetz 1985 gegeben.
Mit dem BilMoG verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, das bisher geltende HGB-Bilanzrecht so umzuformen und auszubauen, dass eine Annäherung an die internationale Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) geschaffen werden kann.
Unter Beachtung der vom Gesetzgeber angestrebten Ziele wurden weitreichende Änderungen im deutschen Bilanzrecht vorgenommen.
Zu den wohl wesentlichsten und umfangreichsten Änderungen gehören insbesondere die neu eingeführten Rechnungslegungsvorschriften für Rückstellungen. Aufgrund der zahlreichen Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften haben Rückstellungen im Jahresabschluss zunehmend an Bedeutung gewonnen.
In Zukunft soll die Rückstellungsbewertung den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen eher entsprechen und damit zu einer realitätsgerechteren Darstellung der wirtschaftlichen Belastung eines Unternehmens beitragen. Daher wurde die (z.T. vorher schon in der Praxis angewandte) Bemessung der Höhe einer Rückstellung zu ihrem Erfüllungsbetrag im Gesetz ausdrücklich kodifiziert. Darin ist die ab sofort von jedem Bilanzierenden verbindliche Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenentwicklungen inbegriffen.
Mit der Einführung einer generellen Abzinsungspflicht für langfristige Rückstellungen soll sich das Handelsrecht von einer traditionellen, vorsichtigen Bewertung hin zu einer zukunftsorien-tierten Bewertung im Sinne des Fair-Value Gedankens nach IFRS entwickeln.
Ziel dieser Arbeit ist es, vor dem Hintergrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes einen Einblick in die neuen Regelungen für sonstige Rückstellungen zu geben und die damit verbundenen Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen aufzuzeigen. Der praktische Umgang mit sonstigen Rückstellungen wird anhand von einzelnen praxisbezogenen Beispielen mit Berechnungen, Buchungssätzen und zugehörigen Erläuterungen verständlich dargestellt. Des Weiteren wird auf die gesetzlichen Übergangsregelungen, die sich im Umstellungszeitpunkt auf das neue HGB-Recht ergaben, eingegangen. Ferner soll untersucht werden, inwieweit sich die neu eingeführten Bewertungsvorschriften für Rückstellungen auch auf Fundamentalgrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Einleitung und Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Gegenstand, Ziele und Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMOG)
- 3. Theoretische Grundlagen zu den Rückstellungen
- 3.1 Begriff, Bedeutung und Zweck
- 3.2 Abgrenzung der Rückstellungen zu anderen Passivpositionen
- 3.2.1 Rücklagen
- 3.2.2 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
- 3.2.3 Eventualverbindlichkeiten
- 3.2.4 Verbindlichkeiten
- 4. Die Bilanzierung von Rückstellungen
- 4.1 Allgemeine Voraussetzungen für die Bildung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- 4.1.1 Die Rückstellungsbildung
- 4.1.2 Die Inanspruchnahme der Rückstellung
- 4.1.3 Die Auflösung der Rückstellung
- 4.1.4 Beispiel zur Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- 5. Die Arten von Rückstellungen nach § 249 HGB
- 5.1 Schuldrückstellungen
- 5.1.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 5.1.2 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 5.1.3 Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung
- 5.2 Aufwandsrückstellungen
- 5.2.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
- 5.2.2 Rückstellungen für Abraumbeseitigungen
- 6. Wesentliche Änderungen zur Bilanzierung von Rückstellungen durch das BilMOG
- 6.1 Aufhebung von Rückstellungswahlrechten
- 6.2 Beibehaltung der passivierungspflichtigen Aufwandsrückstellungen
- 7. Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen
- 7.1 Die Rückstellungsbewertung nach HGB alter Fassung
- 7.2 Allgemeine Bewertungsgrundlagen nach neuem HGB-Recht
- 7.2.1 Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
- 7.2.2 Der Grundsatz der Einzelbewertung
- 7.3 Die Bedeutung des notwendigen Erfüllungsbetrages
- 7.4 Die Berücksichtigung von Preis- und Kostenentwicklungen bei der Rückstellungsbewertung
- 7.4.1 Vorbemerkung
- 7.4.1.1 Kostenentwicklungen
- 7.4.1.2 Preisentwicklungen
- 7.4.2 Die Objektivierungsfunktion
- 7.4.3 Branchenspezifische Trendfortschreibungen
- 7.4.4 Der Grundsatz der Bewertungsvorsicht
- 7.5 Die Abzinsung von sonstigen Rückstellungen
- 7.5.1 Vorbemerkung
- 7.5.2 Der Konflikt mit dem Realisationsprinzip
- 7.5.3 Die Abzinsung langfristiger Rückstellungen
- 7.5.3.1 Die Restlaufzeit
- 7.5.3.2 Die Ermittlung der Zinssätze
- 7.5.3.3 Abzinsung von Rückstellungen für Fremdwährungsverbindlichkeiten
- 7.5.4 Die Abzinsung kurzfristiger Rückstellungen
- 8. Ausweis und Angabepflichten der Rückstellungen
- 8.1 Bilanzieller Ausweis
- 8.2 Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
- 8.2.1 Vorbemerkung
- 8.2.2 Ausweis der Effekte aus der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen
- 8.2.2.1 Die Brutto- und die Nettomethode
- 8.3 Angabepflichten im Anhang
- 8.4 Angabepflichten im Lagebericht
- 9. Erstanwendung und Übergangsvorschriften
- 9.1 Vorbemerkung
- 9.2 Allgemeine Übergangsvorschriften nach Artikel 66 EGHGB n.F.
- 9.3 Allgemeine Übergangsvorschriften nach Artikel 67 EGHGB n.F.
- 9.3.1 Das Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
- 9.3.2 Das Beibehaltungswahlrecht für Aufwandsrückstellungen gem. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB
- 9.3.3 Abweichung vom Stetigkeitsgrundsatz
- 10. Fallstudie zur Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen
- 10.1 Vorbemerkung
- 10.2 Das Unternehmen
- 10.3 Fallstudien
- 10.3.1 Fall, Rückstellung für Rückbauverpflichtungen
- 10.3.2 Fall, Rückstellung für Gewährleistungsansprüche
- 10.3.3 Fall, Rückstellung für Steuernachzahlungen
- 10.3.4 Fall, Auflösung einer Aufwandsrückstellung
- 11. Zusammenfassung und Fazit
- 11.1 Zusammenfassung
- 11.2 Fazit
- Die wesentlichen Änderungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss durch das BilMOG
- Die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen nach altem und neuem HGB-Recht
- Die Auswirkungen des BilMOG auf die Praxis der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen
- Die Bedeutung des notwendigen Erfüllungsbetrages bei der Bewertung von Rückstellungen
- Die Abzinsung von Rückstellungen
- Kapitel 1: Einführung - Die Arbeit stellt die Problemstellung dar und erläutert die Vorgehensweise.
- Kapitel 2: Gegenstand, Ziele und Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMOG) - Dieses Kapitel beschreibt den Gegenstand, die Ziele und die Auswirkungen des BilMOG.
- Kapitel 3: Theoretische Grundlagen zu den Rückstellungen - Hier werden die Begriffe, die Bedeutung und der Zweck von Rückstellungen sowie die Abgrenzung zu anderen Passivpositionen erläutert.
- Kapitel 4: Die Bilanzierung von Rückstellungen - Dieses Kapitel behandelt die allgemeinen Voraussetzungen für die Bildung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen.
- Kapitel 5: Die Arten von Rückstellungen nach § 249 HGB - In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) erläutert.
- Kapitel 6: Wesentliche Änderungen zur Bilanzierung von Rückstellungen durch das BilMOG - Dieses Kapitel analysiert die wesentlichen Änderungen, die das BilMOG für die Bilanzierung von Rückstellungen mit sich bringt.
- Kapitel 7: Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen - Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Rückstellungen nach altem und neuem HGB-Recht und erläutert die Bedeutung des notwendigen Erfüllungsbetrages.
- Kapitel 8: Ausweis und Angabepflichten der Rückstellungen - Dieses Kapitel behandelt den Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angabepflichten im Anhang und im Lagebericht.
- Kapitel 9: Erstanwendung und Übergangsvorschriften - Dieses Kapitel befasst sich mit den Erstanwendung und den Übergangsvorschriften des BilMOG.
- Kapitel 10: Fallstudie zur Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen - Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Fallstudien zur Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den wesentlichen Änderungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss mittelständischer Unternehmen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG) bei der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des BilMOG auf die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen und zeigt die damit verbundenen Herausforderungen für die Praxis auf.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG), Rückstellungen, Bilanzierung, Bewertung, Handelsgesetzbuch (HGB), notwendiger Erfüllungsbetrag, Abzinsung, Ausweis, Angabepflichten, Übergangsvorschriften.
- Quote paper
- Lisa Ballin (Author), 2012, Die Änderungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss mittelständischer Unternehmen durch das BilMoG bei der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191650