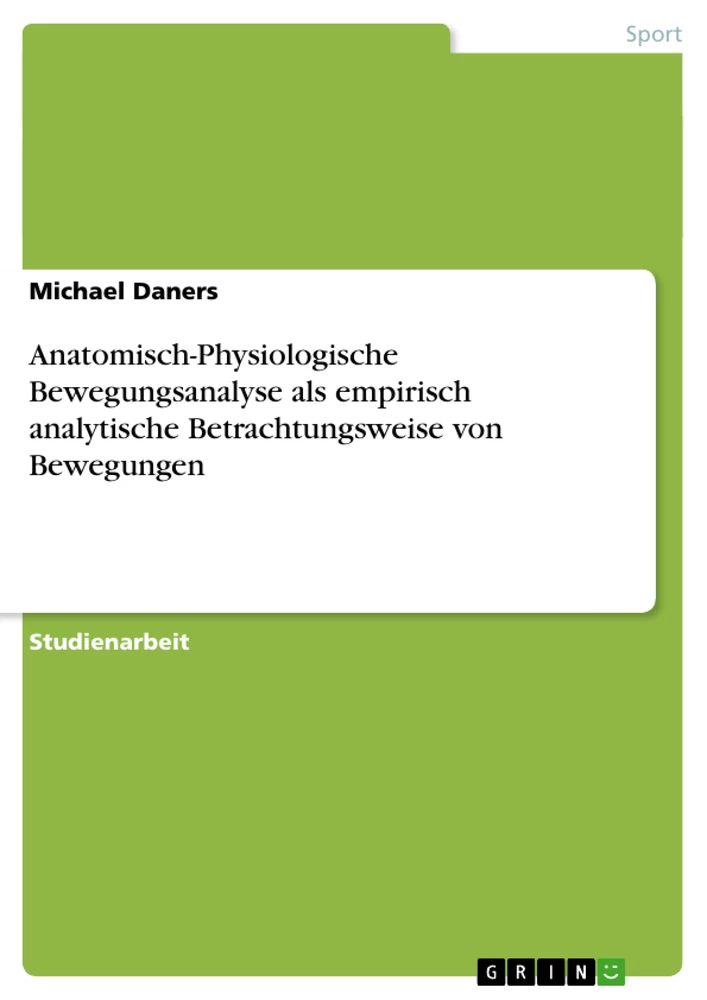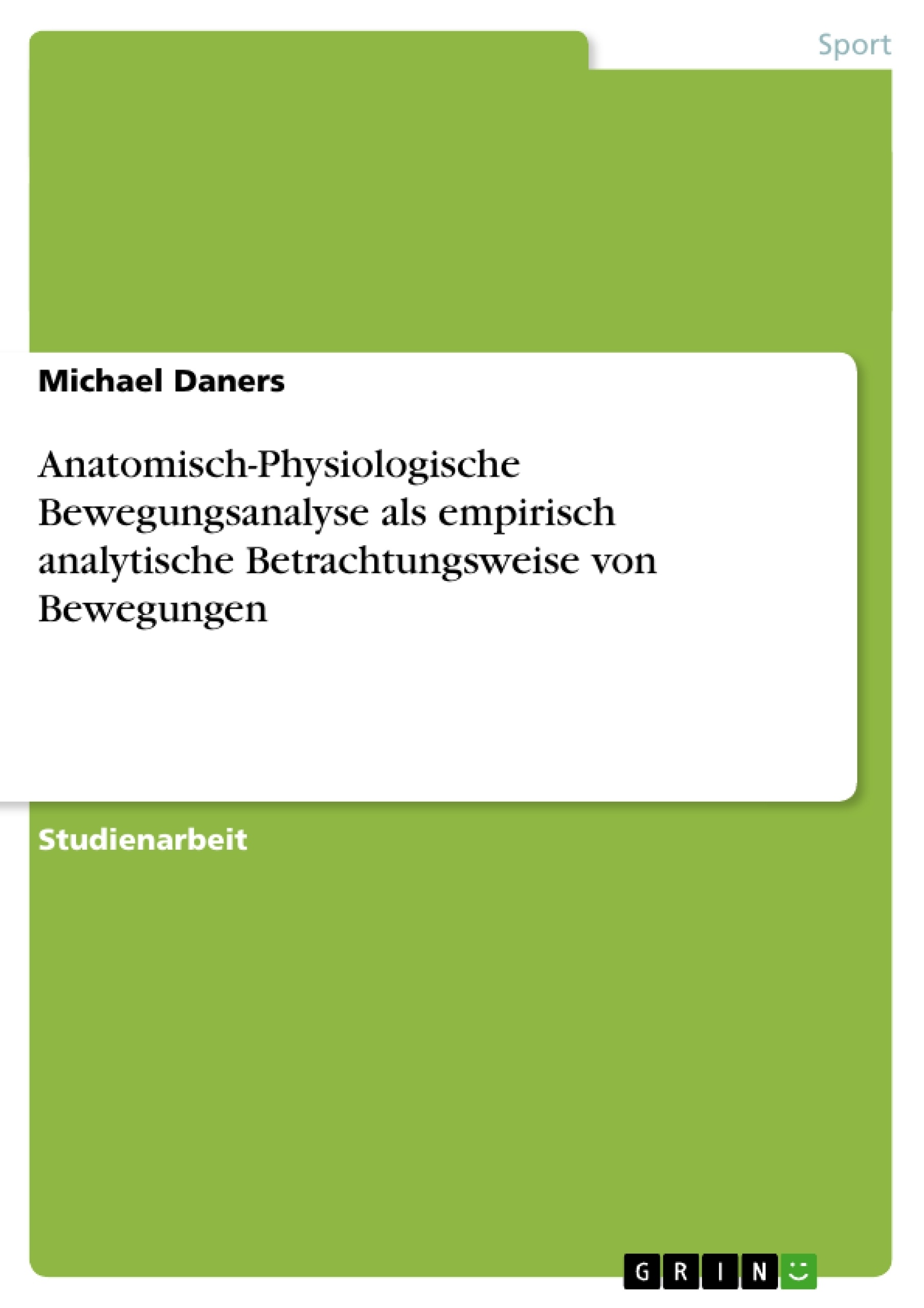Bei der Darstellung der Anatomie des Menschen wird entweder von einer
Regionalgliederung (= Systematik nach Körperregionen wie Gliedmaßen, Brustraum usw.) oder einer
funktionellen Gliederung (= Systematik nach Funktionssystemen wie Bewegungsapparat,
Stoffwechselapparat, Kommunikationsapparat) ausgegangen. Die erste Art ist als topographische
Anatomie die rein ärztliche Anatomie, da der untersuchende und behandelnde Arzt meist alle
Funktionsbereiche (Haut, Muskeln, Nerven, Blutgefäße usw.) einer Körperregion berücksichtigen
muss. Für Zielsetzungen wie unsere - Bewegungsanalysen - greift man auf die zweite Art, die
funktionelle Anatomie zurück, da ausschließlich das Funktionssystem Bewegungsapparat und
innerhalb dieses primär der aktive Bewegungsapparat von Interesse sind. Letztlich geht es vorrangig
um Muskelanalysen hinsichtlich ihrer speziellen (— bewegungsbezogenen) Funktion.
Diese Muskelfunktionsanalysen sollen erkennen lassen, dass
· sportliche Bewegungen auch muskulär Ganzheitsleistungen sind, da jeder Muskel innerhalb
seiner momentanen Muskelfunktionsschlinge(-kette) gesehen werden muss;
· jeder Muskel bei Beeinträchtigung als Glied der Kette Störungen innerhalb der ganzen
Funktionsschlinge und damit im Bewegungsablauf hervorruft;
· die Aufgabe von Muskeln nicht ständig ein- und dieselbe ist, sondern die
jeweilige Funktion von der Art der Einbettung in die Muskelschlinge (Haupt-, Hilfsmuskeln) abhängig
ist;
· Muskelform und Muskelaufgabe sich gegenseitig beeinflussen, gewissermaßen
eine sich gegenseitig beeinflussende Einheit bilden;
· Bewegungsabläufe nicht nur auxotonische Kontraktionsformen verlangen,
sondern auch mitunter isometrische Kontraktionen gewisser Muskeln (Stabili-sationsmuskeln) für
den optimalen Bewegungsablauf erforderlich sind.
Insgesamt lassen sich damit wesentliche Erkenntnisse für die
· Bewegungstechnik und das
· allgemeine und spezielle Konditionstraining gewinnen.
Wegen dieser Bedeutung wurde die funktionell-anatomische Betrachtung neben die
biomechanische Analyse gestellt. Im Grunde sind beide Betrachtungsweisen inhaltlich gar nicht
zu trennen, da einerseits die Feststellung der Muskeltätigkeit (z.B. über Elektromyographie) auch
ein Arbeitsbereich der Biomechanik ist und andererseits innerhalb einer funktionellen
Muskelanatomie biomechanische Aspekte (z. B. Kraft- und Lastarmverhältnisse, optimale
Arbeitswinkel) eine große Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fiederungswinkel & physiologischer Querschnitt des Skelettmuskels
- a. Faseranordnung der Muskeln
- b. Hubhöhe (Verkürzungslänge) eines Muskels
- c. Faktoren der Kraftentwicklung
- d. Fazit
- 3. Hebel, Drehmomente, & Arbeitswinkel
- a. Drehmoment
- b. Funktion mehrgelenkiger Muskeln
- c. Funktionelle Vielfältigkeit von Muskeln
- 4. Elastizitätskomponente
- 5. Sensorik & Rezeptorsysteme
- a. Empfindung und Wahrnehmung
- b. Aufbau und Funktion von Rezeptorensystemen in der Bewegungssteuerung
- c. Rezeptorensystem und Latenzzeit bei motorischen Reaktionen
- 6. Bau von Nervenzellen & Reizfortleitung
- 7. Reflexe
- a. Klassifikation und Kennzeichnung von Reflexe
- b. Unterscheidung nach Art und Anzahl beteiligter neurophysiologischer Strukturen
- c. Unterscheidung nach ihrer Funktion
- d. Reflexe im Sport
- e. Unerwünschte Wirkungen von Schutzreflexen
- f. Merksätze zum Umgang mit Reflexen im Sport
- 8. Forschungsmethoden (Elektromyographie, Plausibilität)
- 9. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, eine anatomisch-physiologische Bewegungsanalyse als empirisch-analytische Betrachtungsweise von Bewegungen zu präsentieren. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen Muskelstruktur, -funktion und Bewegungsausführung im sportlichen Kontext. Die Analyse berücksichtigt biomechanische Aspekte und neurophysiologische Prozesse.
- Muskelstruktur und -fasertypen im Bezug zur Kraftentwicklung und Bewegungsausführung
- Biomechanische Prinzipien wie Hebelwirkung, Drehmomente und Arbeitswinkel
- Rolle der Sensorik und Rezeptorsysteme in der Bewegungssteuerung
- Neurophysiologische Grundlagen von Bewegung, insbesondere Reflexe und ihre Bedeutung im Sport
- Anwendungsbezug der Erkenntnisse für Bewegungstechnik und Konditionstraining
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der funktionellen Anatomie im Kontext von Bewegungsanalysen ein. Sie betont den Unterschied zwischen topographischer und funktioneller Anatomie, wobei letztere für die Untersuchung des Bewegungsapparates und speziell der Muskulatur zentral ist. Es werden zentrale Aspekte der Muskelfunktionsanalyse hervorgehoben, wie die Ganzheitsleistung der Muskulatur innerhalb von Funktionsschlingen, die Abhängigkeit der Muskelaktivität von ihrer Einbettung in diese Schlingen und die Bedeutung sowohl auxotonischer als auch isometrischer Kontraktionen für optimale Bewegungsabläufe. Die Bedeutung für die Bewegungstechnik und das Konditionstraining wird unterstrichen und die Verknüpfung mit biomechanischen Aspekten betont.
2. Fiederungswinkel & physiologischer Querschnitt des Skelettmuskels: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Arten der Muskelfaseranordnung (parallelfaserig, gefiedert) und deren Einfluss auf die Kraftentwicklung und die Verkürzungslänge (Hubhöhe) des Muskels. Es wird erklärt, wie der Fiederungswinkel die Kraftübertragung beeinflusst und wie die unterschiedlichen Anordnungen zu verschiedenen Bewegungsausschlägen und Geschwindigkeiten führen. Parallelfaserige Muskeln ermöglichen größere Hubhöhen, während gefiederte Muskeln höhere Kraft entwickeln können. Das Kapitel verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen Muskelstruktur und -funktion.
3. Hebel, Drehmomente, & Arbeitswinkel: Dieses Kapitel befasst sich mit biomechanischen Prinzipien, die die Bewegungsausführung beeinflussen. Es erklärt den Begriff des Drehmoments und seine Bedeutung für die Kraftentwicklung bei Bewegungen. Die Funktion mehrgelenkiger Muskeln und die funktionelle Vielfältigkeit von Muskeln werden detailliert analysiert, um die Komplexität der Bewegungssteuerung zu verdeutlichen. Der optimale Arbeitswinkel und die Kraftarm-Lastarm-Verhältnisse werden als entscheidende Faktoren für eine effiziente Bewegungsausführung dargestellt.
4. Elastizitätskomponente: (Der Text bietet keine Informationen zu diesem Kapitel.)
5. Sensorik & Rezeptorsysteme: Das Kapitel beschreibt die Rolle der Sensorik und der Rezeptorsysteme in der Bewegungssteuerung. Es erläutert die Bedeutung von Empfindung und Wahrnehmung für die motorische Kontrolle und analysiert den Aufbau und die Funktion verschiedener Rezeptorensysteme. Die Auswirkungen der Latenzzeit von Rezeptoren auf motorische Reaktionen werden ebenfalls thematisiert, um die zeitlichen Abläufe bei Bewegungsabläufen zu verstehen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von sensorischer Rückmeldung und motorischer Reaktion.
6. Bau von Nervenzellen & Reizfortleitung: (Der Text bietet keine detaillierte Informationen zu diesem Kapitel, lediglich die Überschrift.)
7. Reflexe: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Reflexen, ihrer Klassifizierung und Funktion. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Reflexarten und den beteiligten neurophysiologischen Strukturen. Die Bedeutung von Reflexen im Sport und die unerwünschten Wirkungen von Schutzreflexen werden analysiert. Praktische Hinweise zum Umgang mit Reflexen im Sport sollen die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Reflexmechanismen und ihrer Bedeutung für die Bewegungskontrolle.
8. Forschungsmethoden (Elektromyographie, Plausibilität): (Der Text bietet keine detaillierte Informationen zu diesem Kapitel, lediglich die Überschrift.)
Schlüsselwörter
Anatomisch-physiologische Bewegungsanalyse, Muskelstruktur, Muskelfaseranordnung, Fiederungswinkel, Hebelwirkung, Drehmoment, Arbeitswinkel, Sensorik, Rezeptorsysteme, Reflexe, Elektromyographie, Bewegungssteuerung, Konditionstraining, Bewegungstechnik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur anatomisch-physiologischen Bewegungsanalyse
Was ist der Inhalt dieses Textes zur Bewegungsanalyse?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über die anatomisch-physiologischen Grundlagen der Bewegungsanalyse. Er behandelt Themen wie Muskelstruktur, biomechanische Prinzipien, Sensorik, Reflexe und Forschungsmethoden. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Zusammenspiels von Muskelstruktur, -funktion und Nervensystem bei der Bewegungsausführung im sportlichen Kontext.
Welche Muskelstrukturen und -funktionen werden behandelt?
Der Text behandelt detailliert den Fiederungswinkel und den physiologischen Querschnitt des Skelettmuskels, die verschiedenen Arten der Muskelfaseranordnung (parallelfaserig, gefiedert) und deren Einfluss auf Kraftentwicklung und Verkürzungslänge. Es wird erklärt, wie der Fiederungswinkel die Kraftübertragung beeinflusst und wie unterschiedliche Anordnungen zu verschiedenen Bewegungsausschlägen und -geschwindigkeiten führen. Die Zusammenhänge zwischen Muskelstruktur und -funktion werden ausführlich erläutert.
Welche biomechanischen Prinzipien werden erläutert?
Der Text erklärt wichtige biomechanische Prinzipien wie Hebelwirkung, Drehmomente und Arbeitswinkel. Die Funktion mehrgelenkiger Muskeln und die funktionelle Vielfältigkeit von Muskeln werden analysiert, um die Komplexität der Bewegungssteuerung zu verdeutlichen. Der optimale Arbeitswinkel und die Kraftarm-Lastarm-Verhältnisse werden als entscheidende Faktoren für eine effiziente Bewegungsausführung dargestellt.
Welche Rolle spielen Sensorik und Rezeptorsysteme?
Die Bedeutung der Sensorik und der Rezeptorsysteme für die Bewegungssteuerung wird ausführlich beschrieben. Der Text erläutert die Bedeutung von Empfindung und Wahrnehmung für die motorische Kontrolle und analysiert Aufbau und Funktion verschiedener Rezeptorensysteme. Die Auswirkungen der Latenzzeit von Rezeptoren auf motorische Reaktionen werden ebenfalls thematisiert.
Wie werden Reflexe im Text behandelt?
Der Text befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Reflexen, ihrer Klassifizierung und Funktion. Es werden verschiedene Reflexarten und die beteiligten neurophysiologischen Strukturen unterschieden. Die Bedeutung von Reflexen im Sport und die unerwünschten Wirkungen von Schutzreflexen werden analysiert. Praktische Hinweise zum Umgang mit Reflexen im Sport werden gegeben.
Welche Forschungsmethoden werden erwähnt?
Der Text erwähnt die Elektromyographie als Forschungsmethode, jedoch werden keine detaillierten Informationen zu den Methoden oder zur Plausibilität der Ergebnisse geliefert.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst die folgenden Kapitel: Einleitung, Fiederungswinkel & physiologischer Querschnitt des Skelettmuskels, Hebel, Drehmomente & Arbeitswinkel, Elastizitätskomponente, Sensorik & Rezeptorsysteme, Bau von Nervenzellen & Reizfortleitung, Reflexe und Forschungsmethoden (Elektromyographie, Plausibilität). Nicht alle Kapitel werden im vorliegenden Text vollständig behandelt.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, eine anatomisch-physiologische Bewegungsanalyse als empirisch-analytische Betrachtungsweise von Bewegungen zu präsentieren. Er untersucht die Zusammenhänge zwischen Muskelstruktur, -funktion und Bewegungsausführung im sportlichen Kontext unter Berücksichtigung biomechanischer Aspekte und neurophysiologischer Prozesse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Anatomisch-physiologische Bewegungsanalyse, Muskelstruktur, Muskelfaseranordnung, Fiederungswinkel, Hebelwirkung, Drehmoment, Arbeitswinkel, Sensorik, Rezeptorsysteme, Reflexe, Elektromyographie, Bewegungssteuerung, Konditionstraining, Bewegungstechnik.
- Quote paper
- Michael Daners (Author), 2003, Anatomisch-Physiologische Bewegungsanalyse als empirisch analytische Betrachtungsweise von Bewegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19159