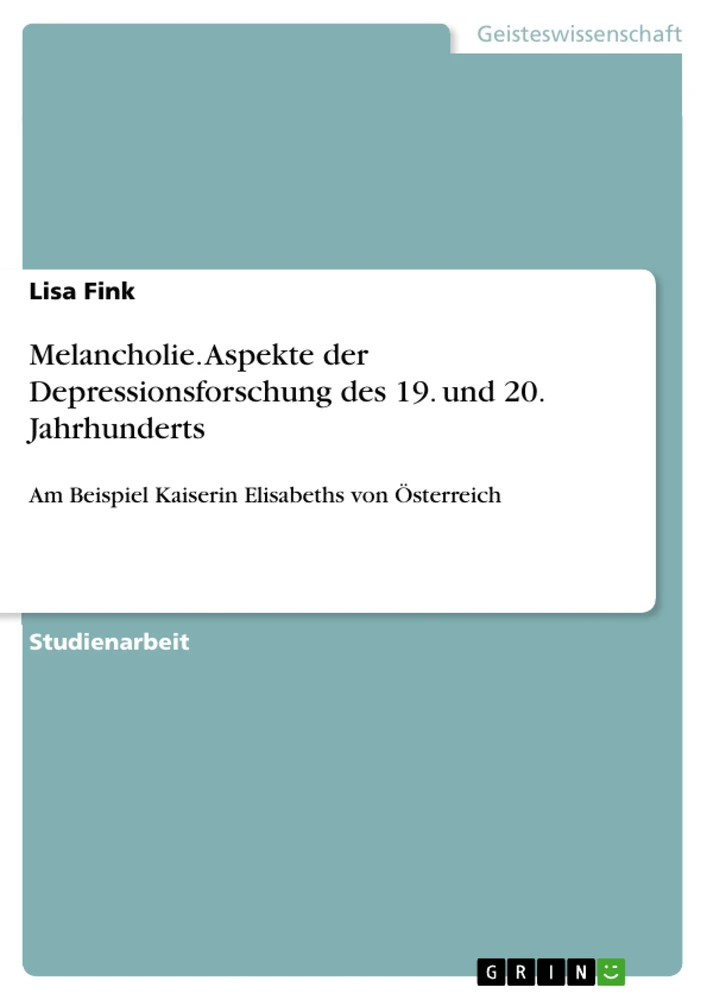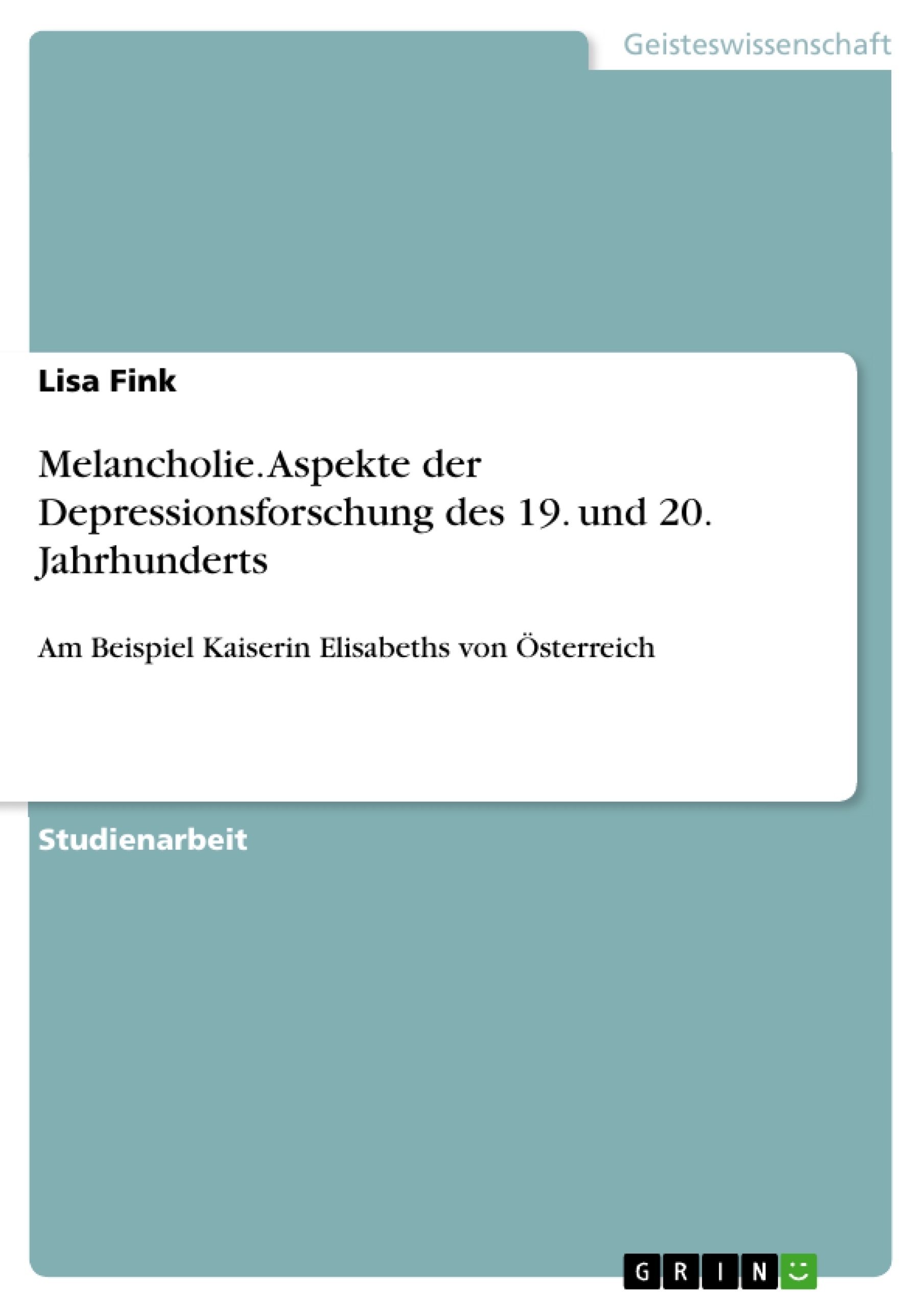In den Medien ist die Thematik hochaktuell. Als „neue Volkskrankheit“ der heutigen Industriestaaten wird die Depression immer häufiger bezeichnet.1 Dies vermittelt den Eindruck, die Depression sei lediglich ein Phänomen der heutigen Zeit. Tatsächlich ist die Melancholie, von der man sprach, bevor man den Begriff durch das Krankheitsbild der Depression ersetzte, seit jeher ein Thema unter den Menschen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden ihr dabei stets unterschiedliche Ursachen und Bedeutungen zugeschrieben.
Das Phänomen der Depression fasziniert nicht zuletzt auf Grund seiner Transparenz, seiner Komplexität. Da sich die Wissenschaften bislang nicht auf eine einzige Ursache der Krankheit einigen konnten, sowie auf Grund der Schwierigkeit, die Depression von einer kurzfristigen Verstimmung zu unterscheiden, wird der Begriff im Alltagsgebrauch großteils umgangssprachlich als Synonym für schlechte Laune verwendet.
Als Faszinosum gilt sie nicht zuletzt auch auf Grund der Darstellung und Verherrlichung in Kunst und Literatur. Insbesondere die Romantik bediente sich der Melancholie als Hauptmotiv und verdeutlichte die Ästhetik des Düsteren und Sehnsuchtsvollen in der Multidimensionalität der menschlichen Seele, sowie in der Natur.
Das Interesse an der Thematik der Depression stieg insbesondere im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ihre Bedeutung und Komplexität stellt ein breites, interdisziplinäres Forschungsfeld, nicht nur für Medizin und Psychologie, sondern darüber hinaus u.a. auch für die Literaturwissenschaft, die Soziologie, sowie für die Geschichts- und Kulturwissenschaften dar.
In der vorliegenden Arbeit sollen wesentliche Aspekte des Krankheitsbildes der Depression, bzw. der Melancholie, am Beispiel der zeitlebens zur Melancholie neigen-den österreichischen Kaiserin Elisabeth (1837-1898) erläutert werden.
Als Quelle hierzu dienen, auf der Mikroebene, Selbstzeugnisse, sowie Aussagen von Zeitgenossen der Kaiserin Elisabeth, sowie, auf der Makroebene, historische, als auch zeitgenössische Definitionen und Forschungserkenntnisse zu der Thematik der Depression, bzw. Melancholie, des 19. und 20. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Biographie Kaiserin Elisabeths
- Begriffsklärung
- Melancholie
- Depression
- Ursachen und Hintergründe der Depression am Beispiel Elisabeths
- Das genetische Risiko und das Familiensystem
- Mangelernährung als Ursache und Symptom
- Traumata
- Mangelnde Selbstverwirklichung und Sinnverlust
- Die Symptomatik der Depression am Beispiel Elisabeths
- Äußerer Eindruck
- „Losigkeits“-Symptome
- Suizidgedanken und selbstzerstörerisches Verhalten
- Einsamkeit und Isolation
- Grübelei, Selbstvorwürfe und Pessimismus
- Schlusswort
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit zielt darauf ab, wesentliche Aspekte des Krankheitsbildes der Depression, bzw. der Melancholie, am Beispiel von Kaiserin Elisabeth (1837-1898) zu erläutern. Die Arbeit untersucht die historischen und zeitgenössischen Definitionen sowie Forschungserkenntnisse zu Depression und Melancholie im 19. und 20. Jahrhundert, um die Ursachen und Symptomatik der Krankheit am Beispiel Elisabeths zu beleuchten.
- Historische und zeitgenössische Definitionen von Melancholie und Depression
- Ursachen der Depression: Genetik, Familiensystem, Mangelernährung, Traumata, mangelnde Selbstverwirklichung
- Symptome der Depression: Äußerer Eindruck, „Losigkeits“-Symptome, Suizidgedanken, Einsamkeit, Grübelei
- Kaiserin Elisabeth als Fallbeispiel für die Analyse der Depression in historischen Kontext
- Interdisziplinäre Forschungsansätze zur Thematik der Depression
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik der Depression, sowohl in der heutigen Zeit als auch in der Vergangenheit, heraus. Sie unterstreicht die Komplexität des Krankheitsbildes und die unterschiedlichen Ursachen und Bedeutungen, die ihr im Laufe der Geschichte zugeschrieben wurden.
Das zweite Kapitel widmet sich der Biographie Kaiserin Elisabeths und beleuchtet ihre Kindheit, ihre Ehe mit Kaiser Franz Joseph, ihre Kinder, sowie ihre zahlreichen Reisen, die sie zeitlebens auf Distanz zu dem Wiener Hof und der Familie führten. Es wird auch auf ihren Schönheitskult und ihre ständige Melancholie eingegangen, die sich in ihren Gedichten niederschlug.
Kapitel 3 befasst sich mit der Begriffsklärung von Melancholie und Depression. Es erläutert die historischen Wurzeln des Begriffs Melancholie und die verschiedenen Bedeutungsebenen, die ihm im Laufe der Zeit zugeschrieben wurden. Die Verbindung der Melancholie mit der „schwarzen Galle“ in der Humoralpathologie und ihre Entwicklung unter dem Einfluss des Planeten Saturn werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit fokussiert auf die Thematik der Depression und Melancholie im 19. und 20. Jahrhundert. Schlüsselbegriffe sind unter anderem: historische Definitionen von Melancholie, Ursachen der Depression, Symptomatik der Depression, Kaiserin Elisabeth, Selbstzeugnisse, zeitgenössische Forschungserkenntnisse, interdisziplinäre Forschungsansätze, „Losigkeits“-Symptome, Suizidgedanken, Einsamkeit, Grübelei, Schönheitskult, „Die Einzige“, Wiener Hof.
- Quote paper
- Lisa Fink (Author), 2012, Melancholie. Aspekte der Depressionsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191547