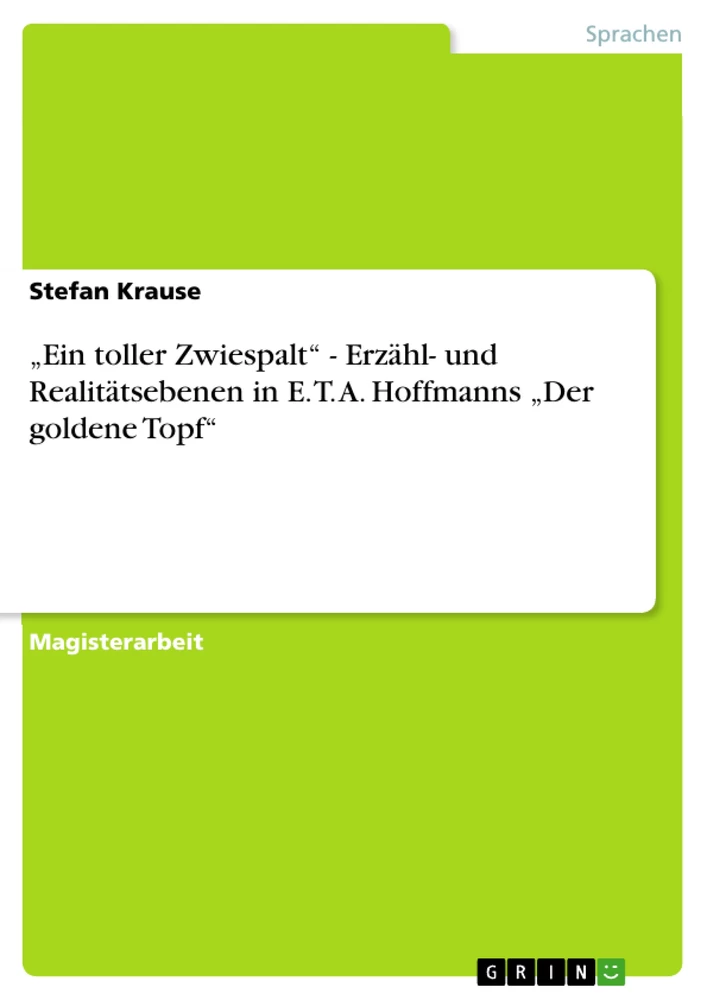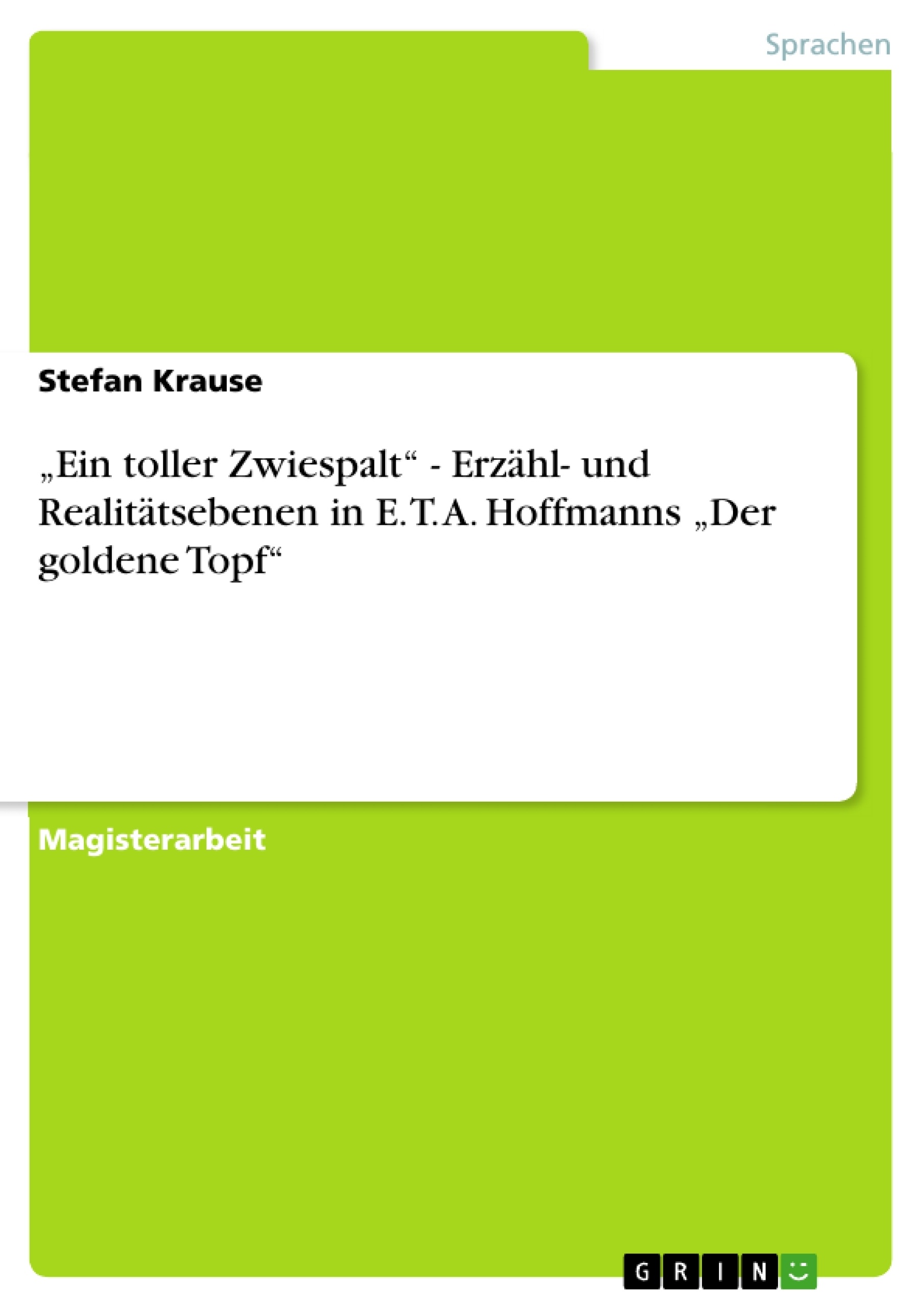‚Der goldene Topf’? Schon wieder? Zweifellos hat es E. T. A. Hoffmanns „Märchen aus der neuen Zeit“ zu einer ganz besonderen Prominenz gebracht. Dem negativen Diktum Goethes zum Trotz, der sich in seinem Urteil bezeichnenderweise nur auf die englische Übersetzung Carlyles stützte, waren bereits die Zeitgenossen sehr von diesem Werk angetan. Eine Hochschätzung, die bis heute anhält und sich u. a. in Wiederaufnahmen in den literarischen Werken und Opern anderer Künstler äußert. Zu den prominenten Bewunderern gehörten im Laufe der Zeit etwa Richard Wagner und Friedrich Nietzsche; Ingmar Bergmann griff Elemente aus dem ‚Märchen’ für einen seiner Filme auf. Noch zu Hoffmanns Lebzeiten erlebte ‚Der goldene Topf’ als Teil der ‚Fantasiestücke’ eine zweite Auflage, was keinem weiteren seiner Werke vergönnt war. In den folgenden fast zwei Jahrhunderten trat das ‚Märchen’ einen globalen Siegeszug an, der mit der frühen englischen Übersetzung durch den renommierten Thomas Carlyle beginnend heute bis nach Japan und Korea reicht. Parallel zu dieser Wertschätzung entwickelte sich eine umfangreiche Forschung, die ebenfalls keineswegs auf Deutschland beschränkt blieb.
Nur wenige Texte E. T. A. Hoffmanns haben ein vergleichbares Echo in der Fachliteratur gefunden, zahlreiche Beiträge beschäftigen sich mit den verschiedensten Aspekten seines „Urmärchen[s]“. Man hat ‚Der goldene Topf’ u. a. zum Schlüssel zu Hoffmanns Welt-anschauung erklärt, ihn tiefenpsychologisch ausgedeutet, ihn „als Utopie einer ästhetischen Existenz, als Aufbruch zu einer Reise in das Land Utopia, als Traum vom pflichtenfreien Leben für das Schöne“ gelesen. Braun unterscheidet in der neueren ‚Topf’-Forschung drei Hauptrichtungen, die das ‚Märchen jeweils primär „als Auseinandersetzung zwischen Bürgertum und Geisterwelt, als Krankheitsgeschichte des Anselmus und als Entwicklungsgeschichte des Studenten zum Dichter“ betrachteten. Hinzu kommen Untersuchungen, die ideengeschichtlich orientiert sind, biografische, literaturgeschichtliche und zahlreiche weitere und anders ausgerichtete Beiträge. Wie sich an der breiten Forschung vermuten lässt und wie Wührl bei Beobachtung seiner Schüler feststellt, „scheiden sich“ an „dem wohl vertracktesten und provozierendsten Märchen, das je aus der Feder eines deutschen Dichters floß, auch heute noch die Geister“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themensuche: Welten und Realitäten
- Dualität, Dualismus, Duplizität – über einen Forschungstopos
- Aus der Forschung
- Dualismus und Perspektivierung
- Künstler und Philister
- Zwischenfazit
- Eine Annäherung: das „Textweltmodell“
- Überlegungen: zur Definition
- Textweltmodell und Erzähltheorie
- Der „goldene“ und der „goldne“ Topf - zur Textgrundlage
- Ein „Märchen“ in den „Fantasiestücken“ – einige Überlegungen zum Paratext
- Paratext-Ebenen
- Ein „Fantasiestück“
- „Callot's Manier“: „Jaques Callot“
- Zum Inhalt
- Zur Deutung und Übertragbarkeit
- „Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten“
- Ein Märchen
- Das romantische Kunstmärchen
- Das Hoffmann-Märchen
- Exkurs: einige Anmerkungen über „Humor“ und „Ironie“
- Die „Vigilien“
- Paratext-Ebenen
- „Der goldene Topf“
- Erste Vigilie
- Erste Sätze
- Das Paradies der Philister
- Mythisierung realer Topographie
- Das „Linkische Paradies“
- Der „linkische“ Anselmus und sein Kampf gegen den Teufel
- Zwischen den Welten
- Das Holunderbaum-Erlebnis
- Die Schlangen unter dem Holunderbaum
- Naturoffenbarung
- Bei Sonnenuntergang sind gute Töchter zuhause
- Zweite Vigilie
- Erwachen in der Bürgerwelt
- Die brüchige Bürgerwelt: Heerbrand, die Paulmanns und die Elbe
- Lindhorst
- Dritte Vigilie
- Einige Anmerkungen über den „Mythos“
- Entzauberung oder Darstellungsproblem?
- Perspektiven
- Vierte Vigilie
- Erste Metalepse: die Wahrheit der Gefühle und der Fakten
- Ins Innere führt der Weg
- der Archivarius, der Schlangenvater und der Geier
- Fünfte Vigilie
- Spuk im Hause Paulmann: Veronika in der Mythenwelt?
- Die Rauerin
- Veronika und die Rauerin: zwei Arten, eine Hexe zu sehen
- Sechste Vigilie
- Ein anderes Haus
- Das Gewächshaus
- Die Palmenbibliothek und der „goldene Topf“
- Der Geisterfürst
- Siebente Vigilie
- Einflüsterungen
- Zweite Metalepse: wenn der Leser eine Figur wäre ...
- Tee und ein nasser Mantel
- Achte Vigilie
- Fortschreitender Übergang des Anselmus
- „Die Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange“
- Anmerkungen über das „Schreibermotiv“
- Überschneidungen
- Neunte Vigilie
- Rückkehr in die Philisterwelt: Veronikas Chance
- Die Punschgesellschaft
- Desillusion oder Zauberbann?
- Zehnte Vigilie
- Die dritte Metalepse: Wege in eine Flasche
- Anselmus in der Flasche
- Der letzte Kampf
- Exkurs: Über Schuld, Sühne und das Äpfelweib
- Fall und Himmelfahrt
- Elfte Vigilie
- Die Reinigung der Philisterwelt
- Ein Traum wird wahr
- Exkurs: Serpentina
- Himmelfahrt Teil Zwei?
- Zwölfte Vigilie
- Die vierte Metalepse: Der sprachlose Erzähler
- Der Student als Dichter
- Bedenken eines Salamanders
- Punsch und Feuergeist
- Die Entrückung des Erzählers
- Kein zweiter Anselmus
- Meinungen und Wertungen
- Erzähltheorie oder: wie viel Hoffmann ist ein Erzähler
- „Doppelte Welten“
- Exkurs: eine Strukturfrage
- Exkurs: Die Rückkehr aus Atlantis
- Anspielungen und Motivwiederholungen
- „Erscheinungen“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Erzähl- und Realitätsebenen in E. T. A. Hoffmanns „Der goldene Topf“. Ziel ist es, die Interaktion zwischen fiktionaler Welt und Realität in diesem „Märchen aus der neuen Zeit“ zu analysieren und die komplexen Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen zu beleuchten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie Hoffmann die Grenze zwischen Realität und Fantasie durch narrative Mittel verwischt und den Leser in eine Welt voller Ambivalenz und Ambiguität eintauchen lässt.
- Die Interaktion zwischen fiktionaler Welt und Realität
- Die Konstruktion von Dualitäten und die Frage der Perspektivierung
- Die Rolle des „Textweltmodells“ in der Analyse des Werkes
- Die Bedeutung des Paratexts und der „Vigilien“ für die narrative Struktur
- Die Frage nach der „Entzauberung“ und dem „Mythos“ in Hoffmanns Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und die Relevanz von „Der goldene Topf“ in der literarischen und wissenschaftlichen Diskussion. Es werden zentrale Forschungstopoi rund um die Dualität, den Dualismus und die Duplizität behandelt, die für die Analyse des Textes relevant sind. Anschließend wird das „Textweltmodell“ als analytisches Werkzeug eingeführt, das die Untersuchung der verschiedenen Erzähl- und Realitätsebenen in Hoffmanns Werk ermöglicht.
Im Fokus der folgenden Kapitel stehen die detaillierte Analyse der „Vigilien“, die die narrative Struktur des Textes bilden. Es werden die verschiedenen Welten und Perspektiven beleuchtet, die in den einzelnen Vigilien dargestellt werden, sowie die Bedeutung von Elementen wie den „Schlangen“, dem „Holunderbaum“ oder dem „goldenen Topf“. Die Kapitel befassen sich auch mit der Frage nach der „Entzauberung“ und der „Mythos“-Bildung in der „Bürgerwelt“ und der „Fantasiestücke“.
Im weiteren Verlauf werden Exkurse zu Strukturfragen und der „Rückkehr aus Atlantis“ behandelt, die die Analyse des Textes ergänzen und vertiefen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen E. T. A. Hoffmann, „Der goldene Topf“, Erzähltheorie, Textweltmodell, Dualität, Dualismus, „Fantasiestücke“, Märchen, „Vigilien“, Entzauberung, Mythos, Realität, Fiktion, Perspektivierung, „Schlangen“, „Holunderbaum“, „goldener Topf“ und die „Rückkehr aus Atlantis“.
- Erste Vigilie
- Citar trabajo
- Stefan Krause (Autor), 2011, „Ein toller Zwiespalt“ - Erzähl- und Realitätsebenen in E. T. A. Hoffmanns „Der goldene Topf“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191237