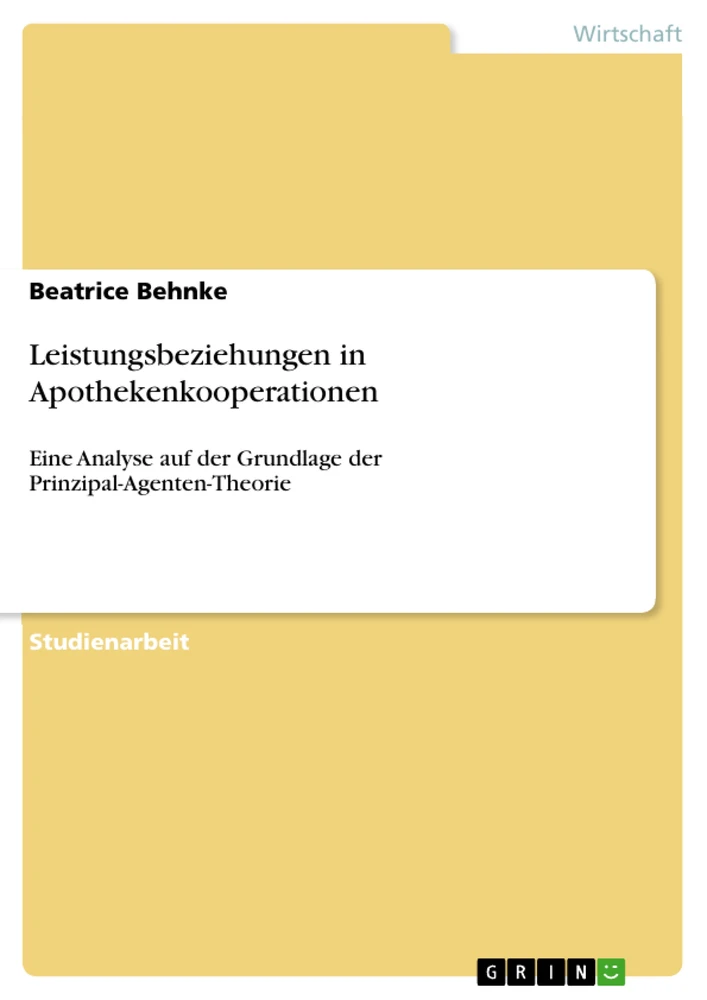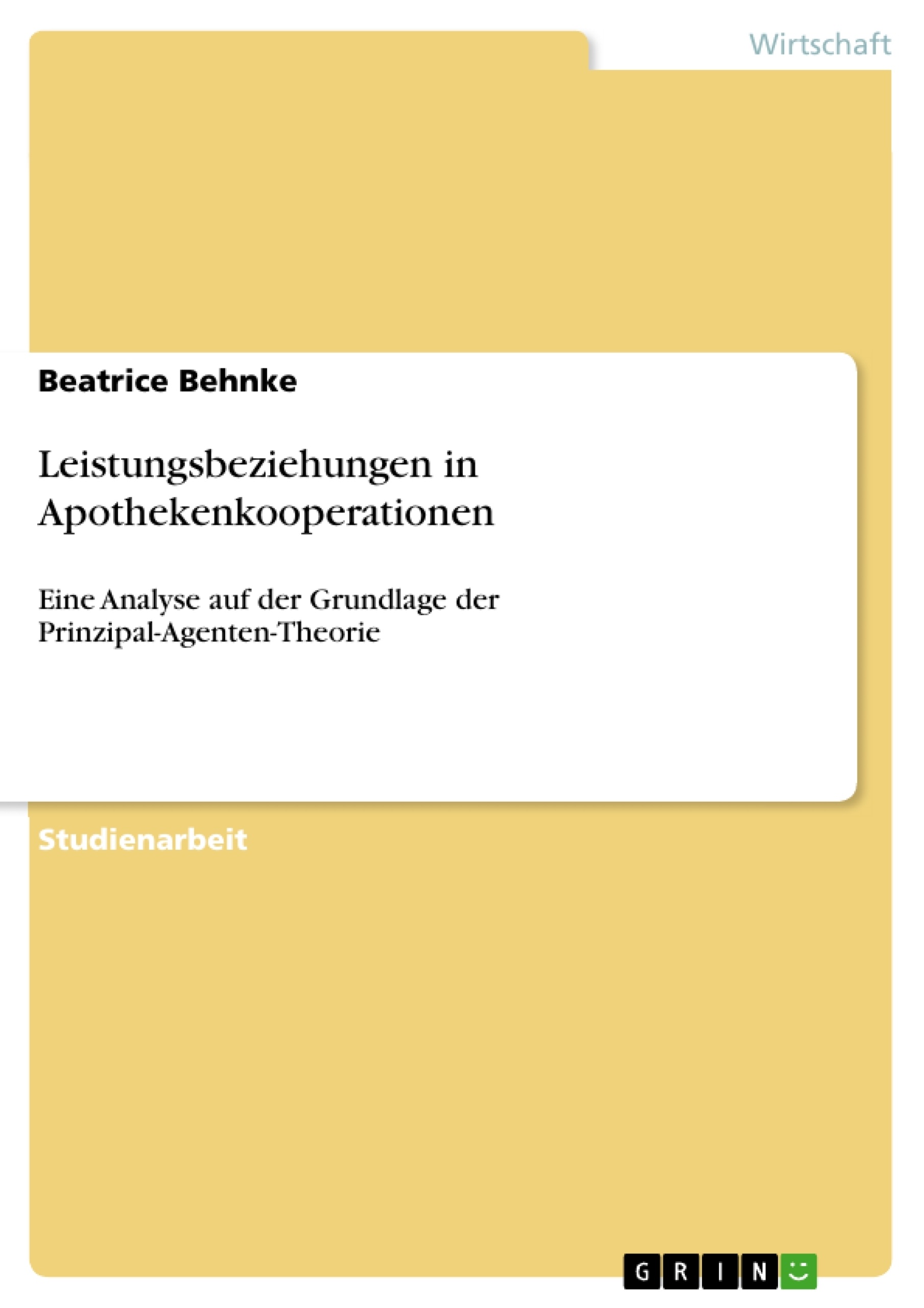„Die Apothekenlandschaft befindet sich spürbar im Wandel und seit Kooperationskonzepte wie DocMorris, VitaPlus oder die easy Apotheken an Bedeutung gewinnen, fragen sich immer mehr Apotheker nach den Risiken und Nebenwirkungen von Kooperationen für ihren Berufsstand.“
Durch die sich fortwährend verändernden Rahmenbedingungen des Apothekenmarktes hat sich in den letzten Jahren ein Trend zu Apothekenkooperationen gebildet, um die Marktpositionierung der inhabergeführten Apotheke zu stärken. Mehr als zwei Drittel der Apotheken in Deutschland sind inzwischen in mindestens einer Kooperation Mitglied. Die Vorteile für Apotheken scheinen klar auf der Hand zu liegen, wohingegen Risiken im Zusammenhang mit einem Kooperationsbeitritt kaum erörtert werden. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wodurch sich Leistungsbeziehungen in Apothekenkooperationen auszeichnen und welche Risiken sich dabei für die Apotheke ergeben können. Als Basis der Analyse wird die Prinzipal-Agenten-Theorie herangezogen. Die Übertragung ihrer Grundannahmen soll nicht nur Aufschluss über Problematiken innerhalb der Leistungsbeziehung zwischen Apotheke und Kooperationspartner, sondern auch Lösungsmöglichkeiten zur Risikoreduktion geben.
Dazu wird zunächst dargestellt, welche Wettbewerbsbedingungen gegenwärtig für Apotheken bestehen, einschließlich der rechtlichen Rahmenbedingungen, die mit Fremd- und Mehrbesitzverbot den wirtschaftlichen Spielraum eines Apothekers deutlich eingrenzen. Daraus ergibt sich die Argumentation für die Existenz von Kooperationsbeitritten inhabergeführter Apotheken, wobei in Abhängigkeit des Kooperationsvertrages der Bindungsgrad stark variiert. Für die detaillierte Betrachtung wird sich der Prinzipal-Agenten-Theorie bedient. Ihre Anwendung widmet sich der Frage, unter welchen Umständen Risiken in der Leistungsbeziehung für die Apotheke entstehen können, die durch Informationsdefizite hervorgerufen werden.
Für den zukünftigen Erfolg der Apotheke als Kooperationsmitglied ist es essenziell sich für den richtigen Partner zu entscheiden. Deshalb sollte der Apotheker über potenzielle Risiken aufgeklärt sein und die Leistungen des Kooperationspartners beurteilen können oder aber über Instrumente verfügen, gegebene Unsicherheiten zu minimieren. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, entsprechende Risiken und mögliche Herangehensweisen zu deren Reduktion herauszustellen. Abschließend werden die Ergebnisse einer kritischen Würdigung unterzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Der Apothekenmarkt und seine gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen
- Besonderheiten des Gutes Arzneimittel
- Fremd- und Mehrbesitzverbot
- Grundzüge der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent
- Informationsasymmetrien und Vertragsprobleme
- Apothekenkooperationen
- Abgrenzungsmerkmale
- Voraussetzungen und Verpflichtungen der Apotheke
- Analyse einzelner Leistungsangebote
- Einkauf
- Category Management
- Marketing, Marktinformationen
- Lösungsansätze zur Reduktion von Informationsasymmetrien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Leistungsbeziehungen in Apothekenkooperationen im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen für Apotheken in kooperativen Strukturen zu beleuchten. Dabei wird die Bedeutung von Informationsasymmetrien und deren Auswirkungen auf die Leistungsbeziehung zwischen Apotheke und Kooperationspartner untersucht.
- Wettbewerbsbedingungen auf dem Apothekenmarkt
- Prinzipal-Agenten-Theorie und ihre Anwendung auf Apothekenkooperationen
- Informationsasymmetrien in Leistungsbeziehungen
- Risiken und Chancen von Apothekenkooperationen
- Lösungsansätze zur Reduktion von Informationsasymmetrien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Problemstellung der Seminararbeit und führt in die Thematik der Apothekenkooperationen ein. Dabei werden die aktuellen Herausforderungen des Apothekenmarktes beleuchtet und die Bedeutung von Kooperationen für die Wettbewerbsfähigkeit der Apotheke hervorgehoben. Das zweite Kapitel analysiert die Wettbewerbsbedingungen des Apothekenmarktes. Es beleuchtet die Besonderheiten des Gutes Arzneimittel sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen, die mit Fremd- und Mehrbesitzverbot den wirtschaftlichen Spielraum des Apothekers einschränken. Im dritten Kapitel werden die Grundzüge der Prinzipal-Agenten-Theorie vorgestellt. Es wird die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent sowie die Problematik von Informationsasymmetrien erläutert. Das vierte Kapitel widmet sich den Apothekenkooperationen. Es werden verschiedene Arten von Kooperationen abgegrenzt und die Voraussetzungen sowie Verpflichtungen der Apotheke im Rahmen einer Kooperation dargestellt. Das fünfte Kapitel analysiert einzelne Leistungsangebote von Apothekenkooperationen, darunter Einkauf, Category Management und Marketing. Das sechste Kapitel beleuchtet Lösungsansätze zur Reduktion von Informationsasymmetrien in Apothekenkooperationen.
Schlüsselwörter
Apothekenmarkt, Apothekenkooperationen, Prinzipal-Agenten-Theorie, Informationsasymmetrien, Wettbewerbsbedingungen, Arzneimittel, Fremd- und Mehrbesitzverbot, Risiken, Chancen, Leistungsbeziehungen, Kooperationspartner.
- Quote paper
- B.A. Gerontolgie Beatrice Behnke (Author), 2011, Leistungsbeziehungen in Apothekenkooperationen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191195