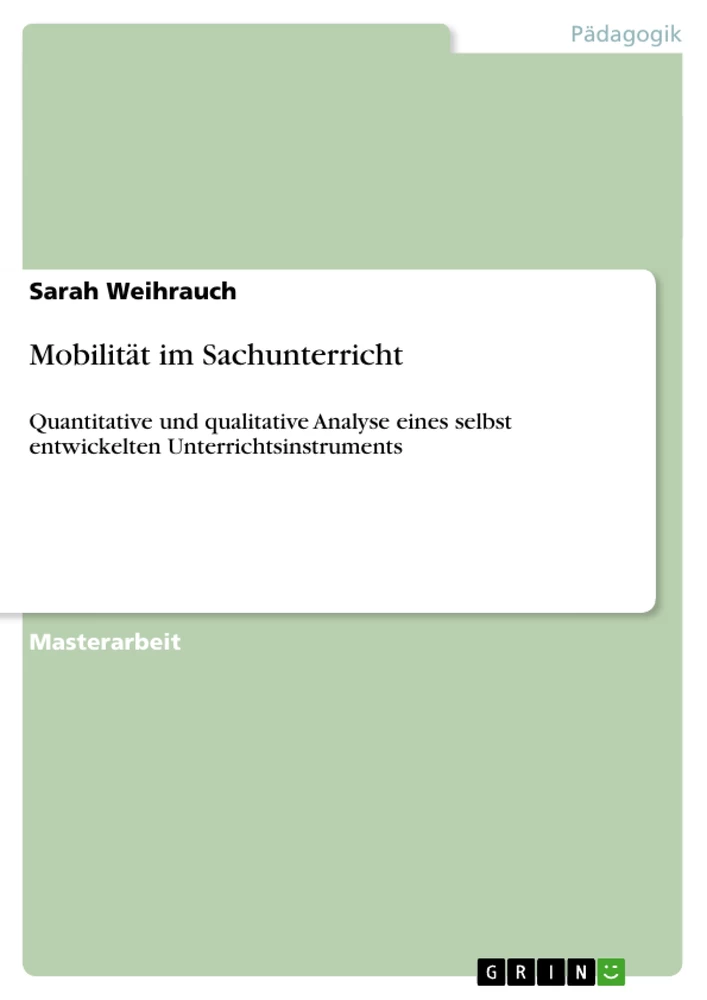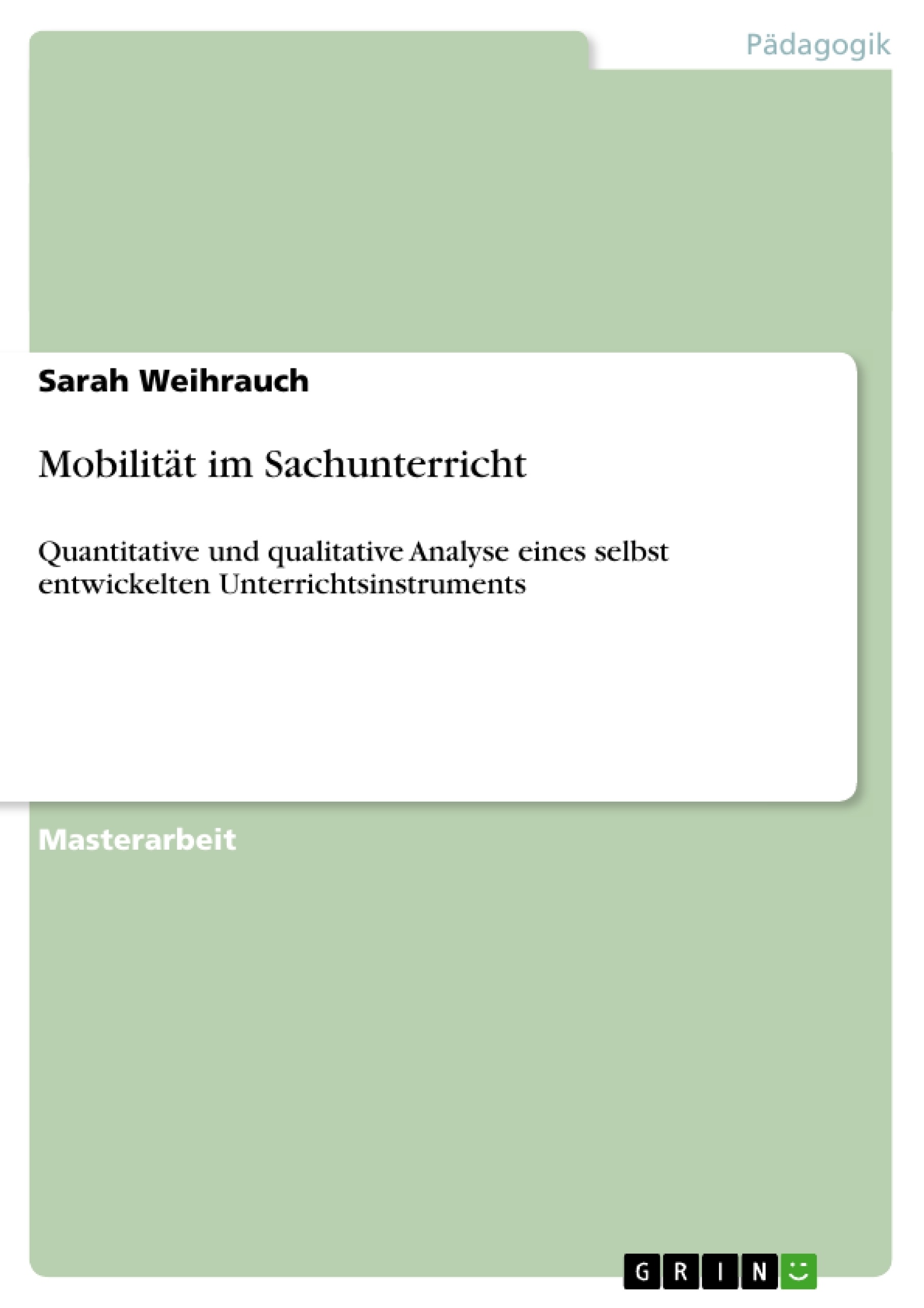Bereits in der Grundschule machen Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: SuS) ihre eigenen Mobilitätserfahrungen, die wesentlich zu ihrer Welterschließung beitragen.
Sie legen ihre wichtigsten Wege zu Freunden, Freizeitaktivitäten sowie zur Schule zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln zurück, somit muss der Verkehr als Lerngegenstand dem Kind im benötigten Umfang erschlossen werden.
Welche positiven und negativen Mobilitätserfahrungen haben SuS aus einer mittelgroßen Stadt am Ende der Grundschule bereits gemacht haben und wie gestalten sie ihre Mobilität?
Dazu habe ich ein “Mobilitätsbuch“ als qualitatives Instrument entwickelt. Es hat den Anspruch, meine Forschungsfragen zu beantworten, gleichzeitig soll es als didaktisches Unterrichtsmaterial in einen modernen Mobilitätsunterricht integrierbar sein.
Bevor ich mich mit dem Mobilitätsbuch beschäftige, stehen einige theoretische Aspekte im Fokus meiner Arbeit. Zunächst werde ich mich mit dem Begriff „Mobilität“ auseinandersetzen sowie grundsätzliche Erkenntnisse zu dem Begriff vorstellen.
Danach werde ich die Aufgaben und Ziele der Mobilitätserziehung darlegen. Was gehört aus Sicht der Forschung zu einem „guten“ Mobilitätsunterricht, welche Aspekte müssen berücksichtigt werden? Auch werde ich erläutern, was die Richtlinien zum Thema „Mobilitätserziehung“ vorsehen, um dem Thema aus einer fachlichen sowie bildungspolitischen Sicht gerecht zu werden.
Ich werde weiter auf die kindlichen Lernvoraussetzungen zum Thema Mobilität eingehen und herausstellen, was das Kind im Verkehr vom Erwachsenen unterscheidet. Dieser Blickwinkel ist wichtig, um dem Kind einen guten, weil auf seine speziellen Bedürfnisse zugeschnittenen Mobilitätsunterricht bieten zu können.
Im Praxisteil meiner Arbeit werde ich zunächst mein Instrument, das Mobilitätsbuch, sowie einige grundlegende Aspekte des Konzeptes erläutern. Der Praxisteil gliedert sich in zwei Bereiche: Zunächst werde ich mich dem didaktischen Potenzial meines Instrumentes widmen. Dazu habe ich das Mobilitätsbuch in einen ausführlichen Unterrichtsentwurf integriert, diesen an einer Grundschule durchgeführt und ein Fazit gezogen. Fotos, ein detaillierter Unterrichtsverlauf sowie Schülerarbeiten unterstützen meine Dokumentation im Anhang.
Als zweiten Teil meiner Praxisphase werde ich eine quantitative und qualitative Analyse der im Unterricht gestalteten Mobilitätsbücher vornehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundlegendes zur Begrifflichkeit „Mobilität“
- Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule
- Die historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- Entwicklungen der Verkehrserziehung bis 1972
- Beschluss der Kultusministerkonferenz am 7.7. 1972
- Entwicklungen ab der Kultusministerkonferenz 1994: Von der Verkehrs- zur Mobilitätserziehung
- Aufgaben und Ziele der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- Ausgangssituation sowie Grundtendenzen des thematisierten ,,Verkehr“ Lernbereichs
- Leitlinien der Kompetenzbildung
- Lernziele in der Mobilitätserziehung
- Die kindlichen Lernvoraussetzungen zum Thema „Mobilität“
- Die visuelle Leistungsfähigkeit des Kindes
- Die auditive Leistungsfähigkeit des Kindes
- Die motorische und physische Leistungsfähigkeit des Kindes
- Das niedersächsische Curriculum- Modell „Mobilität“ (Primarbereich)
- Mobilitätserziehung in den niedersächsischen Richtlinien
- Das Mobilitätsbuch
- Konzept und Entwicklung
- Allgemeines
- Inhaltliche/thematische Konzeption des Instruments
- Optische Gestaltung
- Didaktisches Potenzial des Wege- und Reisebuches: Praxiserprobter Unterrichtsentwurf ,,Arbeit mit dem Wege-und Reisebuch“
- Einleitung mit Problem- und Zielaufriss
- Bedingungs- und Lebensweltanalyse
- Didaktische Überlegungen
- Lernziel-/Kompetenzbeschreibung
- Methodischer Kommentar und Erfahrungen aus der Praxisphase
- Quantitative/ qualitative Analyse einiger Mobilitätsbücher
- Vorstellung der Probandenklasse
- Untersuchungsdesign
- Darstellung der Ergebnisse
- Nutzungshäufigkeiten der Transportmittel
- Präferenzen hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl
- Präferenzen hinsichtlich des Spielortes
- Subjektiv empfundene Sicherheit auf dem Schulweg
- Erkenntnisse über den Mobilitätsradius der Schüler
- Interpretation der Ergebnisse: Konsequenzen für Sachunterricht und Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Mobilitätserziehung im Sachunterricht der Grundschule. Ziel ist es, die Mobilitätserfahrungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Grundschule zu untersuchen und das Potential von "Mobilitätsbüchern" als Instrument zur Erhebung dieser Erfahrungen sowie als didaktisches Material zu evaluieren.
- Historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- Aufgaben und Ziele der Mobilitätserziehung
- Kindliche Lernvoraussetzungen im Kontext der Mobilität
- Konzeption und Einsatz des Mobilitätsbuches als Instrument der Erhebung und des Unterrichts
- Qualitative und quantitative Analyse von Mobilitätsbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in den Begriff der Mobilität und seine Bedeutung im Kontext der Verkehrswissenschaft, Soziologie und Wirtschaftstheorie. Anschließend wird die historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule betrachtet, mit Fokus auf die Entwicklung von der Verkehrserziehung zur Mobilitätserziehung. Kapitel drei beleuchtet die Aufgaben und Ziele der Mobilitätserziehung, die kindlichen Lernvoraussetzungen zum Thema Mobilität sowie das niedersächsische Curriculum-Modell „Mobilität“ und die entsprechenden Richtlinien. Kapitel vier konzentriert sich auf das Mobilitätsbuch als Instrument der Erhebung und des Unterrichts. Das Konzept und die didaktische Umsetzung des Mobilitätsbuches werden ausführlich erläutert, einschließlich eines praxiserprobten Unterrichtsentwurfs. Im fünften Kapitel wird eine quantitative und qualitative Analyse von Mobilitätsbüchern aus der Praxisphase vorgestellt. Es werden Nutzungshäufigkeiten von Verkehrsmitteln, Präferenzen hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl und des Spielortes sowie die subjektiv empfundene Sicherheit auf dem Schulweg analysiert. Die Ergebnisse werden im Kontext des Sachunterrichts und der Gesellschaft interpretiert.
Schlüsselwörter
Mobilität, Verkehrserziehung, Mobilitätserziehung, Grundschule, Sachunterricht, Mobilitätsbuch, Unterrichtsmaterial, Erhebungsinstrument, qualitative Analyse, quantitative Analyse, Schulweg, Freizeitaktivitäten, kindliche Lernvoraussetzungen, Verkehrswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftstheorie, Curriculum, Richtlinien.
- Quote paper
- Sarah Weihrauch (Author), 2012, Mobilität im Sachunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191179