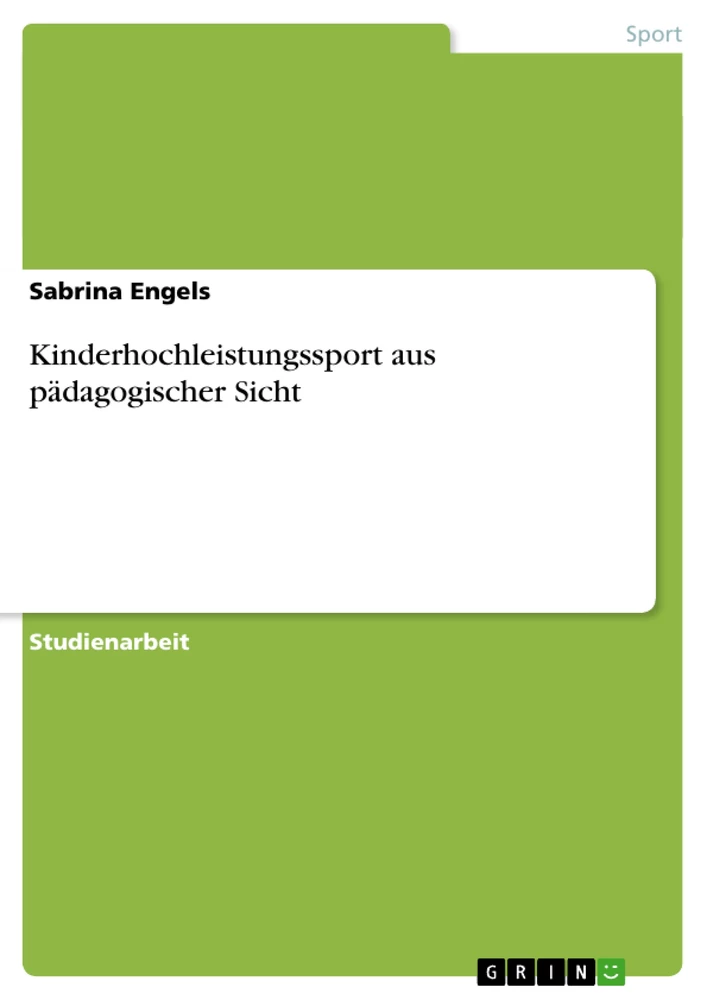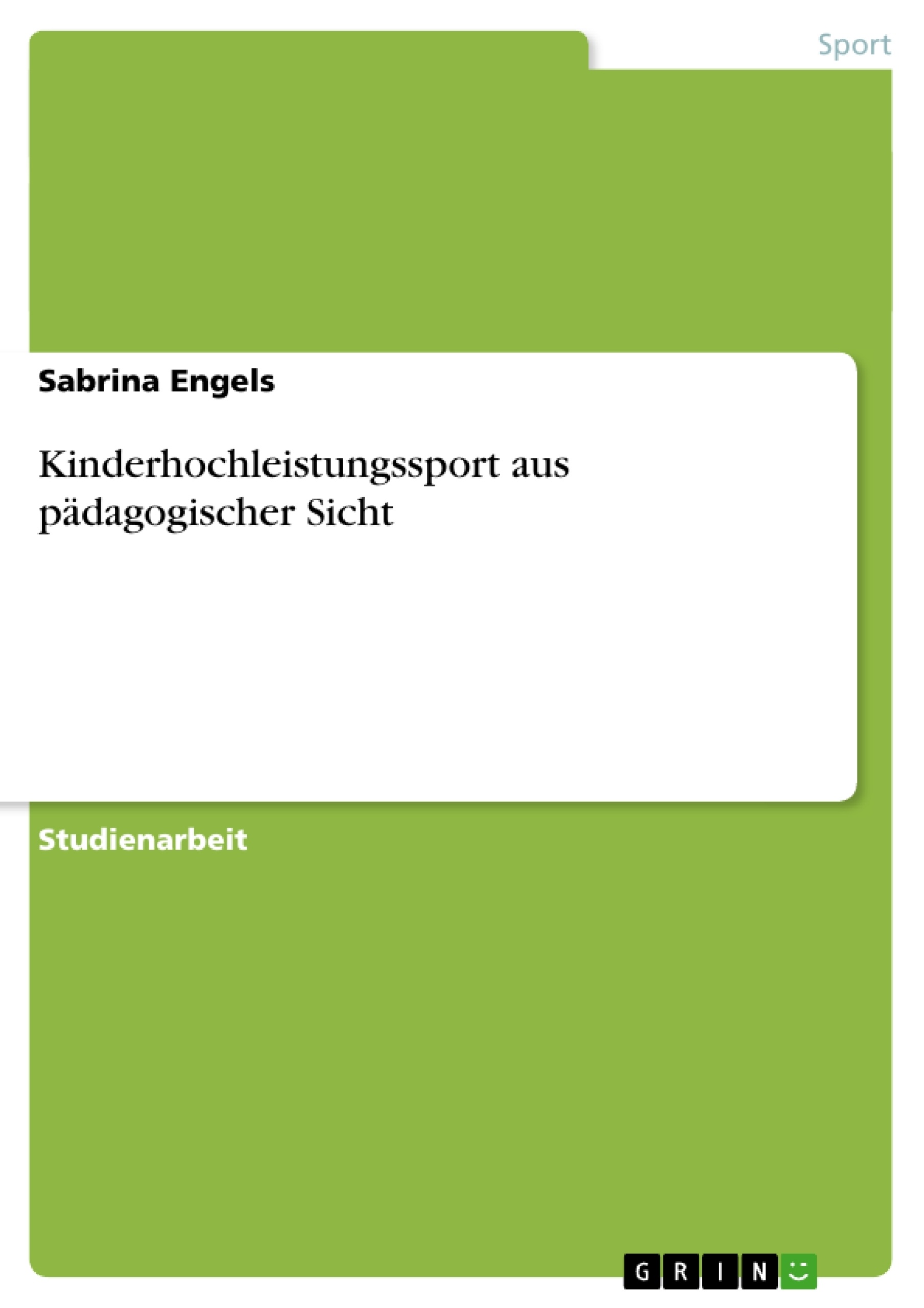Der Kinderhochleistungssport ist nicht erst in den letzten Jahren ein kontrovers diskutiertes Thema geworden. Diese Thematik wird schon seit etlichen Jahren aufgeworfen und immer wieder von Kritikern angegriffen, sowie von Befürwortern verteidigt. Die Äußerungen derjenigen, die den Kinderhochleistungssport ablehnen, reichen von ,,Leistungsknecht", ,,Muskelmaschine" und ,,Leistungsroboter" bis hin zu einem ,,Mängelwesen mit Orientierungslosigkeit". Diese Äußerungen zielen alle auf eine Reizverarmung der Umwelt dieser Kinder, auf eine Überbetonung des Leistungsgedankens, auf eine Unterdrückung durch z.B. Trainer, Eltern, Funktionäre und auf die Herausbildung von fremdbestimmten Menschen durch das Umfeld des Kindes (z.B. Trainer, Trainingsalltag, Trainingsmethoden, ...) ab. Im Gegenzug sprechen die Befürworter davon, dass dem Kind neue Möglichkeiten aufgezeigt werden, sich selbst zu erkunden, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen, soziale Kontakte (vor allem in Mannschaftssportarten) zu knüpfen, positive (z.B. Sieg) wie auch negative (z.B. Niederlage) Erfahrungen zu sammeln und somit ihre Kindheit intensiv auszuleben. (vgl. MEINBERG, E.: Kinderhochleistungssport. Fremdbestimmung oder Selbstentfaltung. Köln 1984)
Dazu Zitate einiger Pädagogen: " Du bist mein Glück, mein Kind, mein Werk; von deinem Glück erwarte ich mein eigenes; täuscht du meine Hoffnung, so stiehlst du mir zwanzig Jahre meines Lebens und bist das Unglück meiner alten Tage" J.J. Rousseau, 1762)
" Die 18- jährigen sehen aus wie dreizehn, und den 15-jährigen möchte man am liebsten einen großen Teddy zum Geburtstag schenken oder eine kräftige Portion Pommes, damit sie nicht so ausgemergelt aussehen. .... Wer genau hinsieht, entdeckt kaputte Füße, Blutergüsse an den Oberschenkeln, wundgeriebene Hände" ( aus: Franke, E.: Kinder im Hochleistungssport - Eine ethische Herausforderung)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition sportlicher Leistungsentwicklung und des Kindertrainings
- Leistungsvoraussetzungen und Leistungsfähigkeit von Kindern
- Doppelbelastung der Kinder im Hochleistungssport - Integration von Training, Bildung und Ausbildung
- Äußere Einflüsse – Eltern, Trainer, Gesellschaft
- Pro und Kontra des Kinderhochleistungssport
- biologisch-medizinische Perspektive
- soziale Komponente
- psychologische Sichtweise
- Zur Schwierigkeit einer konsequent pädagogischen Betrachtung des Kinderhochleistungssport und zum Problem der Kindgemäßheit
- Lösungsansätze und -vorschläge für einen humaneren Kinderhochleistungssport
- Zur Schwierigkeit der Diskussion über den Kinderhochleistungssport
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Kinderhochleistungssport aus pädagogischer Sicht. Sie untersucht die komplexen Anforderungen, die dieser Bereich an Kinder stellt, und beleuchtet die Herausforderungen, denen junge Sportler im Hochleistungssport ausgesetzt sind. Die Arbeit analysiert die Argumente für und gegen den Kinderhochleistungssport, beleuchtet die Auswirkungen auf die Entwicklung und den Lebensalltag der Kinder und untersucht die ethischen und pädagogischen Aspekte des Themas.
- Definition und Entwicklung des Kinderhochleistungssports
- Biologische und psychologische Herausforderungen für Kinder im Hochleistungssport
- Integration von Training, Bildung und Ausbildung
- Ethische und pädagogische Aspekte des Kinderhochleistungssports
- Mögliche Folgen und Lösungsansätze für einen humaneren Kinderhochleistungssport
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Kinderhochleistungssport ein und stellt die Kontroverse um diese Thematik dar. Sie zeigt unterschiedliche Perspektiven auf, die den Kinderhochleistungssport kritisch hinterfragen und zugleich auch die Vorteile beleuchten.
- Kapitel 2 definiert die Begriffe sportliche Leistungsentwicklung und Kindertraining. Es werden Unterschiede zwischen dem Training von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hervorgehoben und die Notwendigkeit eines altersgerechten Trainings betont.
- Kapitel 3 untersucht die Leistungsvoraussetzungen und -fähigkeiten von Kindern. Es erklärt, dass Kinder im Vergleich zu Jugendlichen und Erwachsenen noch in der Entwicklung sind und sich schnell an äußere Reize anpassen können. Es werden die unterschiedlichen Trainingsbereiche und ihre optimalen Trainingszeiträume im Kindesalter beschrieben.
- Kapitel 4 analysiert die Doppelbelastung von Kindern im Hochleistungssport, die durch den Spagat zwischen Training, Bildung und Ausbildung entsteht. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dieser Situation ergeben, und diskutiert die Bedeutung der Integration dieser Bereiche.
- Kapitel 5 widmet sich den äußeren Einflüssen auf Kinder im Hochleistungssport, insbesondere der Rolle von Eltern, Trainern und Gesellschaft. Es untersucht, wie diese Akteure die Entwicklung und das Leben von Kindern beeinflussen können.
- Kapitel 6 befasst sich mit den Vor- und Nachteilen des Kinderhochleistungssports aus unterschiedlichen Perspektiven. Es analysiert die biologisch-medizinischen, sozialen und psychologischen Aspekte des Themas.
- Kapitel 7 widmet sich der Schwierigkeit einer konsequent pädagogischen Betrachtung des Kinderhochleistungssports und dem Problem der Kindgemäßheit. Es stellt die Frage, ob und inwiefern der Kinderhochleistungssport mit den Bedürfnissen und Entwicklungsphasen von Kindern vereinbar ist.
- Kapitel 8 bietet Lösungsansätze und -vorschläge für einen humaneren Kinderhochleistungssport. Es zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie der Kinderhochleistungssport so gestaltet werden kann, dass er den Bedürfnissen und der Entwicklung der Kinder gerecht wird.
Schlüsselwörter
Kinderhochleistungssport, pädagogische Sicht, Leistungsentwicklung, Kindertraining, Doppelbelastung, Integration, Bildung, Ausbildung, Eltern, Trainer, Gesellschaft, biologisch-medizinische Perspektive, soziale Komponente, psychologische Sichtweise, Kindgemäßheit, Lösungsansätze, humaner Kinderhochleistungssport.
- Quote paper
- Sabrina Engels (Author), 2002, Kinderhochleistungssport aus pädagogischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19116