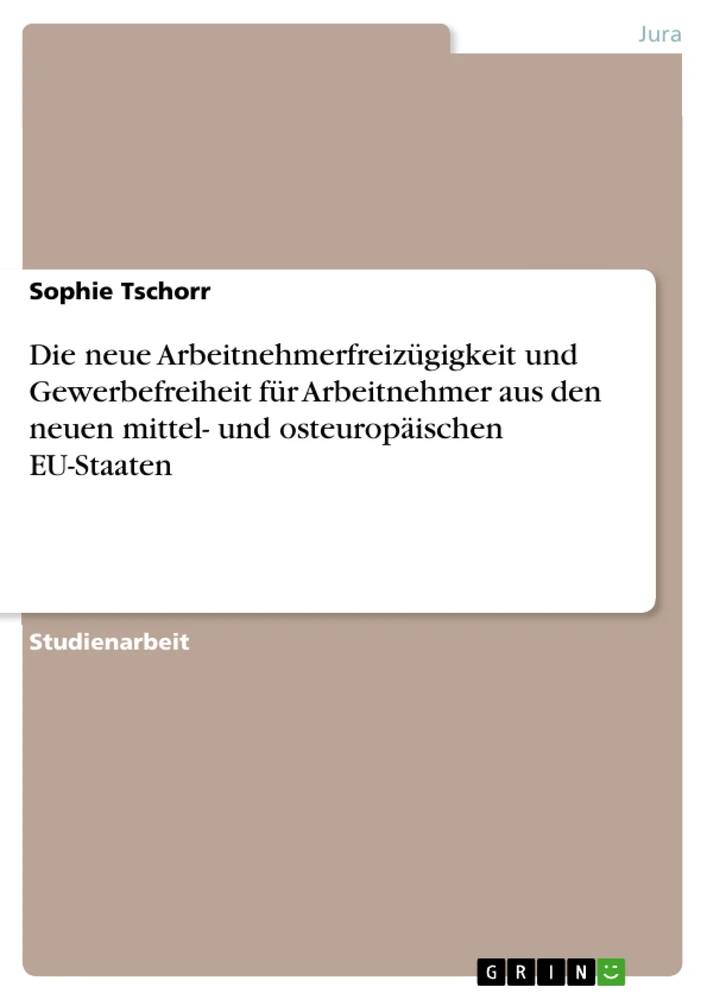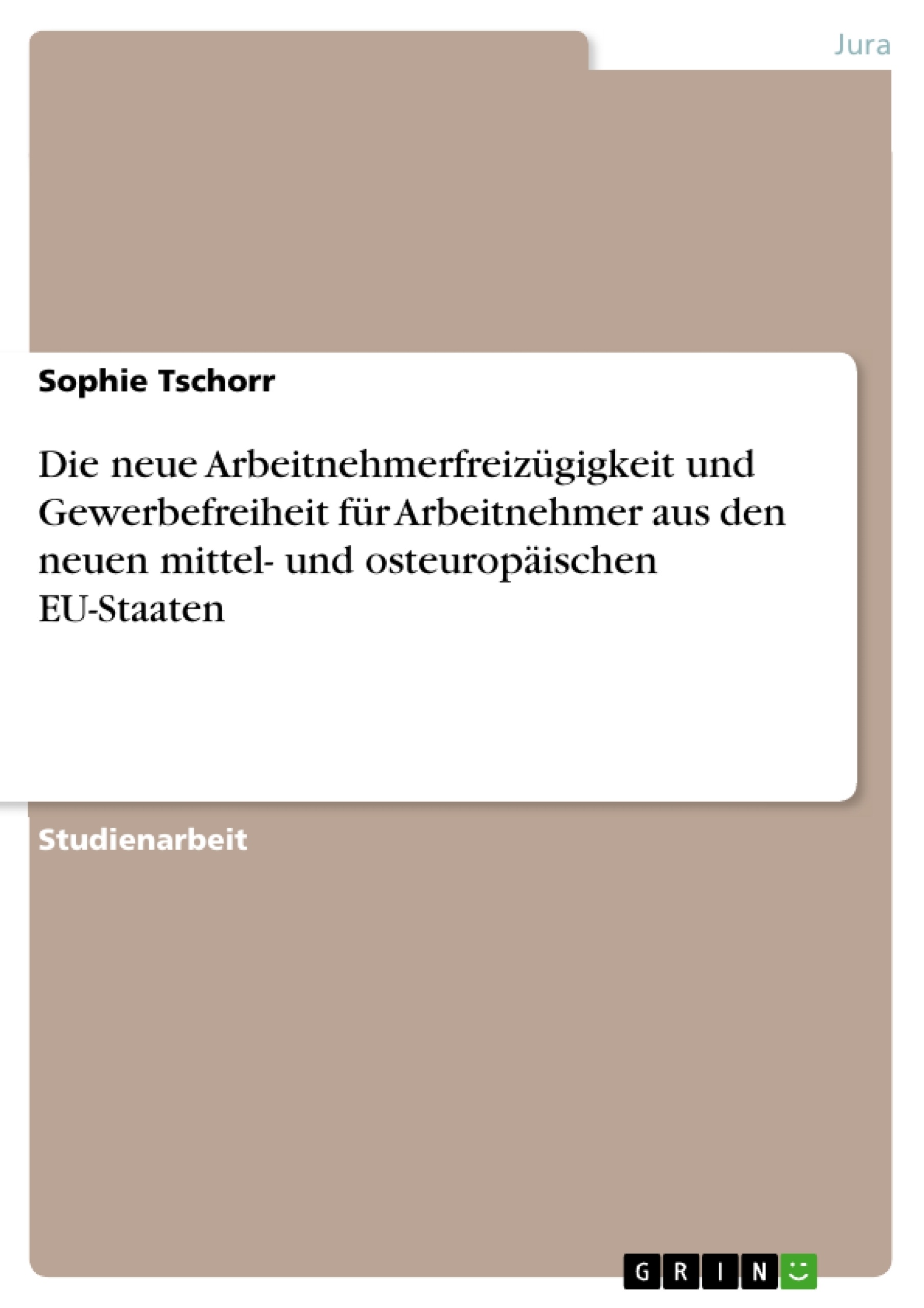Am 30. April 2011 endeten die Übergangsfristen des EU- Beitrittsvertrages vom 16. April 2003, welche im Rahmen der ersten Phase der EU-Osterweiterung zwischen der Europäischen Union und den zehn Ländern Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien, Slowakei und der Republik Zypern mit Wirkung zum 01. Mai 2005 vereinbart worden sind. Die zweite Phase erfolgte am 01. Januar 2007 mit dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien in die EU. Der Beitritt der zehn Länder im Jahre 2003 und der zwei Länder 2007 stellte die größte Erweiterungsrunde in der Geschichte der europäischen Integration dar und erhöhte die Mitgliederzahl von 15 auf 27. Sowohl die Beitrittsstaaten als auch die Altmitgliedstaaten setzten hohe Erwartungen in die EU- Erweiterung, in wirtschaftlicher und politscher, als auch in stabilitäts-, friedens-, verteidigungs-, sicherheits- und umweltpolitscher Hinsicht.
Zum Schutz des heimischen Marktes und der Stabilitätssicherung der nationalen Sozialversicherungssysteme nutzten die Altmitgliedstaaten eine Übergangsfrist, welche sich auf maximal 7 Jahre erstreckte. Die Mitgliedstaaten Malta und Zypern waren von dieser Regelung nicht betroffen. Das sog. „2+3+2“-Modell bildete den Rahmen dieser Übergangsfristen, welches sich im Beitrittsvertrag , als auch in der Beitrittsakte wiederfindet. Mit Ablauf dieser Frist am 30. April 2011 wurden ökonomische, juristische und rechtspolitische Debatten in Deutschland hervorgerufen und Fragen, wie hoch das Migrationspotenzial sein wird und welche Auswirkungen die „neue“ uneingeschränkte Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes mit sich bringt, gestellt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit und dem Grundrecht der Gewerbefreiheit im Zuge der Osterweiterung und den rechtlichen Aspekten der EU- Erweiterung in Deutschland seit dem ersten Beitrittsjahr 2004.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU
- 1. Grundfreiheiten
- a) Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 45 ff. AEUV
- b) Arbeitnehmerbegriff im Gemeinschaftsrecht
- c) Arbeitnehmerfreizügigkeit im sekundären Gemeinschaftsrecht
- 2. Die Übergangsfristen und das „2 + 3 + 2-Modell“
- a) Beschäftigung von Drittstaatsbürgern
- b) Beschäftigung von Unionsbürgern
- c) Beschäftigung von Neu-Unionsbürgern
- 1. Grundfreiheiten
- C. Stellung der Neu-Unionsbürger im Arbeitsrecht
- D. Sozialrechtliche Flankierung des Art. 45 durch Art. 48 AEUV. Lösung zur Bewahrung der Stabilität?
- Exkurs: Arbeitnehmerüberlassung
- E. Gewerbefreiheit
- 1. Berufsfreiheit für Ausländer
- 2. Berufsfreiheit für Staatsangehörige der EU-Staaten
- 3. Gewerbefreiheit für Unionsbürger
- F. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gewerbefreiheit für Arbeitnehmer aus den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten nach dem Ende der Übergangsfristen im Jahr 2011. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die Übergangsfristen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Altmitgliedstaaten.
- Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU und Art. 45 AEUV
- Die Übergangsfristen und das „2 + 3 + 2-Modell“
- Stellung der Neu-Unionsbürger im Arbeitsrecht der Altmitgliedstaaten
- Sozialrechtliche Aspekte der Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Gewerbefreiheit für Unionsbürger
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses einführende Kapitel beleuchtet den Hintergrund der EU-Osterweiterung von 2003 und 2007, die den Beitritt von zehn bzw. zwei mittel- und osteuropäischen Staaten bedeutete. Es hebt die hohen Erwartungen an die Erweiterung hervor und stellt die Grundfreiheiten – Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsrecht und Dienstleistungsverkehr – im Kontext des gemeinsamen Marktes dar. Der Fokus liegt auf dem Beginn der uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit und den damit verbundenen Sorgen der Altmitgliedstaaten bezüglich möglicher negativer Auswirkungen auf den heimischen Arbeitsmarkt, insbesondere in Deutschland. Die Einführung stellt den Kontext und die Problematik der Arbeit dar, die in den folgenden Kapiteln vertieft werden.
B. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU, basierend auf Artikel 45 AEUV und weiterführenden Rechtsvorschriften. Es definiert den Begriff des "Arbeitnehmers" im europäischen Recht und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Beschäftigung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Übergangsfristen und dem „2 + 3 + 2-Modell“, das die schrittweise Einführung der uneingeschränkten Freizügigkeit regelte. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Regelungen für Drittstaatsbürger, Unionsbürger und die neu hinzugekommenen Unionsbürger aus den mittel- und osteuropäischen Ländern. Die verschiedenen Aspekte dieses komplexen Rechtsgebiets werden detailliert beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Lage zu vermitteln.
C. Stellung der Neu-Unionsbürger im Arbeitsrecht: Dieses Kapitel analysiert die spezifische rechtliche Position der Arbeitnehmer aus den neuen mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten im Arbeitsrecht der Altmitgliedstaaten. Es untersucht, wie die nationalen Arbeitsgesetze die EU-Vorschriften zur Arbeitnehmerfreizügigkeit umsetzen und welche Besonderheiten für die neu hinzugekommenen Arbeitnehmer gelten. Es werden möglicherweise relevante Aspekte des Arbeitsrechts, wie z.B. Lohnniveau, Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz, im Kontext der Integration der neuen Arbeitnehmer diskutiert. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und den rechtlichen Implikationen der Integration dieser Arbeitnehmergruppe in den bestehenden Arbeitsmarkt.
D. Sozialrechtliche Flankierung des Art. 45 durch Art. 48 AEUV. Lösung zur Bewahrung der Stabilität?: Dieses Kapitel befasst sich mit der sozialrechtlichen Absicherung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und untersucht, wie Artikel 48 AEUV die Bestimmungen des Artikels 45 AEUV flankiert. Es analysiert die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Stabilität des Arbeitsmarktes in den Altmitgliedstaaten zu gewährleisten, und diskutiert, inwieweit diese Maßnahmen erfolgreich waren. Ein Exkurs zu Arbeitnehmerüberlassung vertieft die Komplexität der Thematik. Die Analyse umfasst die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme und die Vermeidung von Missbrauch im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität.
E. Gewerbefreiheit: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Gewerbefreiheit im Kontext der EU-Osterweiterung. Er analysiert das Recht von Ausländern und Unionsbürgern auf Berufsausübung in den Mitgliedsstaaten, untersucht die rechtlichen Hürden und die Möglichkeiten, die sich für Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedsstaaten ergeben. Die Kapitel erörtern die verschiedenen Aspekte der Gewerbefreiheit, einschließlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Vermeidung von Diskriminierung.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Gewerbefreiheit, EU-Osterweiterung, mittel- und osteuropäische EU-Staaten, Art. 45 AEUV, Art. 48 AEUV, Übergangsfristen, „2 + 3 + 2-Modell“, Arbeitsmarkt, Sozialrecht, Integrationspolitik, Gemeinschaftsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gewerbefreiheit nach der EU-Osterweiterung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gewerbefreiheit für Arbeitnehmer aus den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten nach dem Ende der Übergangsfristen im Jahr 2011. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die Übergangsfristen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Altmitgliedstaaten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU (Art. 45 AEUV), die Übergangsfristen und das „2 + 3 + 2-Modell“, die Stellung der Neu-Unionsbürger im Arbeitsrecht der Altmitgliedstaaten, sozialrechtliche Aspekte der Arbeitnehmerfreizügigkeit, und die Gewerbefreiheit für Unionsbürger. Es wird auch die Gewerbefreiheit für Ausländer und Staatsangehörige der EU-Staaten betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: A. Einführung: Hintergrund der EU-Osterweiterung und die Grundfreiheiten. B. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU: Arbeitnehmerfreizügigkeit, Artikel 45 AEUV, Übergangsfristen und das „2 + 3 + 2-Modell“. C. Stellung der Neu-Unionsbürger im Arbeitsrecht: Rechtliche Position der Arbeitnehmer aus den neuen EU-Staaten. D. Sozialrechtliche Flankierung des Art. 45 durch Art. 48 AEUV: Sozialrechtliche Absicherung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Maßnahmen zur Stabilität des Arbeitsmarktes. E. Gewerbefreiheit: Recht auf Berufsausübung für Ausländer und Unionsbürger. F. Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit?
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Gewerbefreiheit, EU-Osterweiterung, mittel- und osteuropäische EU-Staaten, Art. 45 AEUV, Art. 48 AEUV, Übergangsfristen, „2 + 3 + 2-Modell“, Arbeitsmarkt, Sozialrecht, Integrationspolitik, Gemeinschaftsrecht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gewerbefreiheit auf den Arbeitsmarkt der Altmitgliedstaaten nach dem Ende der Übergangsfristen. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Auswirkungen auf die Integration der Arbeitnehmer aus den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Arbeit in Abschnitte (A-F), Unterabschnitte und Unterpunkte (1, 2, a, b, c etc.), die die einzelnen Themenbereiche detailliert darstellen. Es bietet einen strukturierten Überblick über den gesamten Inhalt der Arbeit.
- Quote paper
- Sophie Tschorr (Author), 2011, Die neue Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gewerbefreiheit für Arbeitnehmer aus den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191103