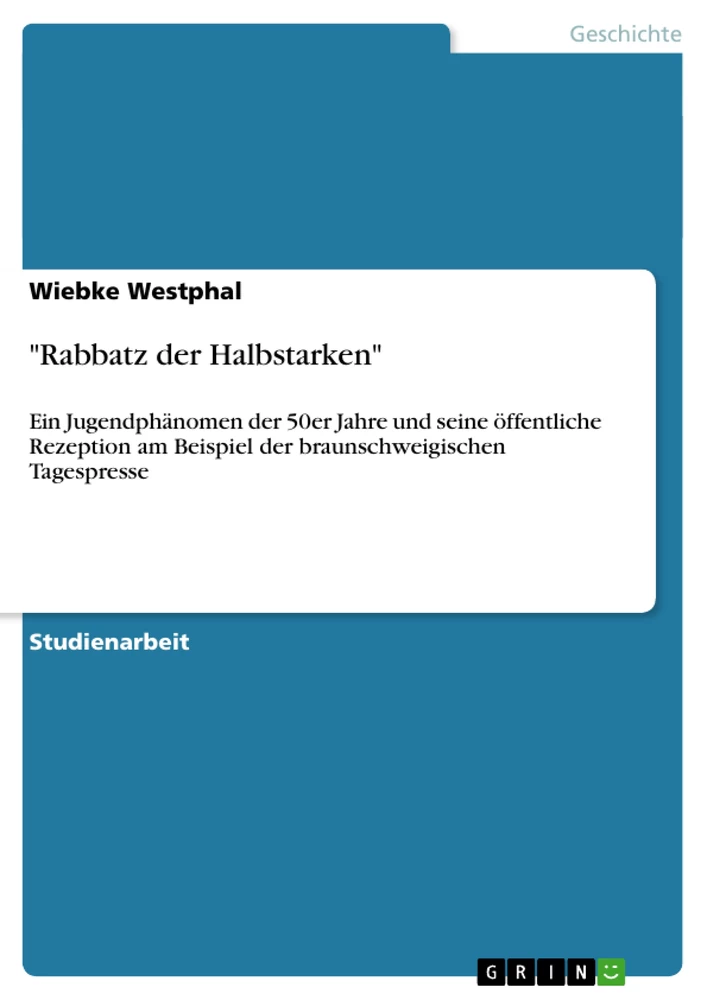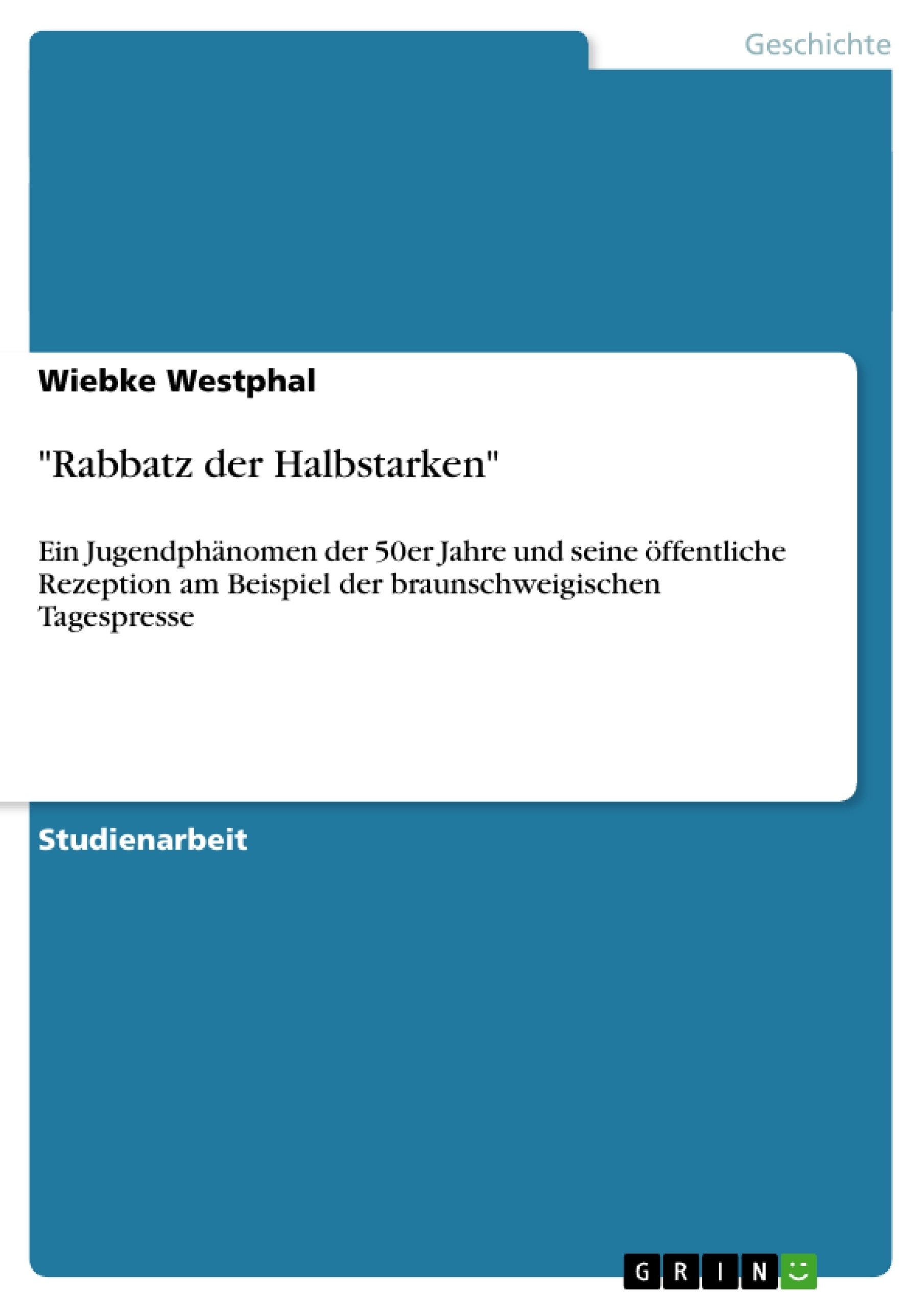Wer heute einen Blick auf die Bundesrepublik der 50er Jahre wirft, läuft leicht Gefahr, die Dekade angesichts heiterer Heimatfilme wie dem "Schwarzwaldmädel" aus dem Jahr 1950, strahlend weißer Persil-Hemden in den Illustrierten und fleißiger Hausfrauen wie "Klementine" aus der Ariel-Fernsehwerbung, nostalgisch als kleinbürgerliche Idylle zu verklären. Natürlich war ein Teil der 50er Jahre durch Nierentische und Tütenlampen geprägt – diese Elemente waren jedoch niemals die bestimmenden, sondern lediglich ein kleiner Ausschnitt aus einer viel breiteren Palette. Ein Blick auf die Gesellschaft der Bundesrepublik in den 50er Jahren ist immer auch ein Blick auf eine Gesellschaft "nach der Katastrophe". Nach horrenden Verlusten an Mensch und Material im Zweiten Weltkrieg leiteten die 50er die Rückkehr zu "geordneten und gesitteten Verhältnissen" ein. Die Wohnungsnot wurde langsam beseitigt, die Lebensbedingungen allmählich verbessert. Ehemalige Trümmerkinder, die jahrelang die Freiräume und Freiheiten der großstädtischen Ruinenlandschaften als "Abenteuerspielplätze" genutzt und genossen hatten, wurden im Zuge einer konservativen Werterestauration wieder verstärkt in Familie und Gesellschaft eingebunden. Die CDU/CSU erreichte unter Konrad Adenauer bei den Bundestagswahlen 1957, bislang einmalig in der Nachkriegsgeschichte, die absolute Mehrheit der Stimmen mit einer Kampagne, die den Namen "Keine Experimente!" trug – mehr als bezeichnend für den Zeitgeist. Und inmitten dieser neu und lieb gewonnenen Sicherheit erschien scheinbar aus dem Nichts eine Generation "völlig verjazzter und versporteter" Jugendlicher auf der Bildfläche und versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken: "Halbstarke", unorganisierte Gruppierungen Halbwüchsiger, "die in der Öffentlichkeit durch normwidriges, sinn- und nutzloses Randalieren friedensstörend auffallen und primitive Antriebserlebnisse befriedigen wollen."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jungsein nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1. Flüchtlinge, Vertriebene, Waisen - die Generation der „Nochnicht- und Schon-Erwachsenen“
- 2.2. „Ohne mich!“ - die unpolitische Jugend
- 2.3. Wohnungsnot - Grenzen jugendlicher Selbstbestimmung
- 2.4. Familienleben und Sexualmoral zwischen Tradition und Fortschritt
- 2.5. Das „Wirtschaftswunder“ - jugendliche Selbstbestimmung im Wandel
- 3. Die „neue“ Jugend - Entwicklung einer Jugendkultur
- 4. Ausbruch aus dem Alltag – die „Halbstarkenkrawalle“
- 4.1. Generation „halbstark“ – ein Klassifizierungsversuch
- 4.2. Die „Erfindung der Halbstarken“
- 5. Das Beispiel Braunschweig
- 5.1. Berichterstattung in der braunschweigischen Tagespresse
- 5.1.1. Braunschweiger Presse
- 5.1.2. Braunschweiger Zeitung
- 6. Ergebnis und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Rezeption des Jugendphänomens der „Halbstarken“ in den 1950er Jahren, insbesondere anhand der braunschweigischen Tagespresse. Ziel ist es, den Kontext dieses Phänomens zu beleuchten und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf zu analysieren.
- Die Situation der Jugend in der Nachkriegszeit
- Die Entstehung einer neuen Jugendkultur im Wirtschaftswunder
- Die Definition und Klassifizierung der „Halbstarken“
- Die „Halbstarkenkrawalle“ als Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen
- Die mediale Darstellung der „Halbstarken“ in der braunschweigischen Presse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung kontert die romantisch verklärte Sicht der 1950er Jahre als kleinbürgerliche Idylle und stellt das Phänomen der „Halbstarken“ als wichtigen Aspekt der damaligen Gesellschaft vor. Sie umreißt den Forschungsansatz, der die öffentliche Rezeption der „Halbstarken“ im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht.
2. Jungsein nach dem Zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensbedingungen der Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg. Es thematisiert die Erfahrungen von Flüchtlingen, Vertriebenen und Waisen, die Auswirkungen der Wohnungsnot auf die jugendliche Selbstbestimmung, sowie die Spannungen zwischen traditioneller Sexualmoral und gesellschaftlichem Wandel im Kontext des Wirtschaftswunders. Das Kapitel betont die Diskrepanz zwischen der frühen Kindheitserfahrung von Not und Unsicherheit und dem scheinbar sicheren Umfeld der Wirtschaftswunderjahre, was als ein wichtiger Hintergrund für das Aufkommen der „Halbstarken“ gesehen wird.
3. Die „neue“ Jugend - Entwicklung einer Jugendkultur: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung einer eigenständigen Jugendkultur im Kontext des Wirtschaftswunders. Der zunehmende Wohlstand führte zu mehr Freizeit und eigenem Geld, wodurch sich ein jugendkulturelles Warenangebot entwickelte, welches sich klar von dem der Erwachsenen abgrenzte. Die Abgrenzung dieser neuen Jugendkultur wird als ein Versuch der Jugendlichen interpretiert, sich der Bevormundung durch Eltern und Schule zu entziehen und den autoritär-patriarchalischen Ansprüchen ihrer Zeit eigene Bedürfnisse entgegenzusetzen.
4. Ausbruch aus dem Alltag – die „Halbstarkenkrawalle“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Halbstark“ und analysiert verschiedene Versuche, dieses Phänomen zu klassifizieren. Es legt den Fokus auf die „Halbstarkenkrawalle“ als Ausdruck jugendlicher Rebellion und gesellschaftlicher Spannungen. Das Kapitel bereitet den Boden für die detaillierte Fallstudie zu den Braunschweiger Krawallen.
5. Das Beispiel Braunschweig: Dieses Kapitel untersucht die Berichterstattung der Braunschweiger Tagespresse über die „Halbstarkenkrawalle“ von 1956. Es analysiert den Vergleich der Berichterstattung zweier Zeitungen und setzt diese in den Kontext der bundesdeutschen öffentlichen Wahrnehmung des Phänomens. Die ausgewählten Krawalle dienen als Fallbeispiel, um die öffentliche Rezeption des „Halbstarken“-Phänomens zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Halbstarke, Jugendkultur, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, öffentliche Rezeption, Braunschweig, Tagespresse, Jugendkriminalität, gesellschaftliche Spannungen, soziale Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Öffentliche Rezeption des Jugendphänomens der „Halbstarken“ in den 1950er Jahren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Rezeption des Jugendphänomens der „Halbstarken“ in den 1950er Jahren, insbesondere anhand der braunschweigischen Tagespresse. Ziel ist es, den Kontext dieses Phänomens zu beleuchten und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf zu analysieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Situation der Jugend in der Nachkriegszeit, die Entstehung einer neuen Jugendkultur im Wirtschaftswunder, die Definition und Klassifizierung der „Halbstarken“, die „Halbstarkenkrawalle“ als Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen und die mediale Darstellung der „Halbstarken“ in der braunschweigischen Presse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Jungsein nach dem Zweiten Weltkrieg, Die „neue“ Jugend - Entwicklung einer Jugendkultur, Ausbruch aus dem Alltag – die „Halbstarkenkrawalle“, Das Beispiel Braunschweig und Ergebnis und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird in Kapitel 2 ("Jungsein nach dem Zweiten Weltkrieg") behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die Lebensbedingungen der Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich der Erfahrungen von Flüchtlingen, Vertriebenen und Waisen, der Auswirkungen der Wohnungsnot und der Spannungen zwischen traditioneller Sexualmoral und gesellschaftlichem Wandel im Kontext des Wirtschaftswunders. Die Diskrepanz zwischen frühen Kindheitserfahrungen und dem Wirtschaftswunder wird als wichtiger Hintergrund für das Aufkommen der „Halbstarken“ dargestellt.
Was ist der Fokus von Kapitel 3 ("Die „neue“ Jugend - Entwicklung einer Jugendkultur")?
Kapitel 3 analysiert die Entstehung einer eigenständigen Jugendkultur im Kontext des Wirtschaftswunders. Der zunehmende Wohlstand führte zu mehr Freizeit und eigenem Geld, was zur Entwicklung eines jugendkulturellen Warenangebots führte, das sich von dem der Erwachsenen abgrenzte. Die Abgrenzung wird als Versuch der Jugendlichen interpretiert, sich der Bevormundung zu entziehen.
Worüber handelt Kapitel 4 ("Ausbruch aus dem Alltag – die „Halbstarkenkrawalle“)?
Kapitel 4 definiert den Begriff „Halbstark“ und analysiert verschiedene Klassifizierungsversuche. Der Fokus liegt auf den „Halbstarkenkrawallen“ als Ausdruck jugendlicher Rebellion und gesellschaftlicher Spannungen. Es bereitet die Fallstudie zu den Braunschweiger Krawallen vor.
Was wird im Kapitel 5 ("Das Beispiel Braunschweig") untersucht?
Kapitel 5 untersucht die Berichterstattung der Braunschweiger Tagespresse über die „Halbstarkenkrawalle“ von 1956. Es analysiert den Vergleich der Berichterstattung zweier Zeitungen und setzt diese in den Kontext der bundesdeutschen öffentlichen Wahrnehmung des Phänomens. Die Braunschweiger Krawalle dienen als Fallbeispiel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Halbstarke, Jugendkultur, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, öffentliche Rezeption, Braunschweig, Tagespresse, Jugendkriminalität, gesellschaftliche Spannungen, soziale Veränderungen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Quelle wird im Text nicht explizit genannt, jedoch wird die Braunschweiger Tagespresse als Hauptquelle für die Analyse der öffentlichen Rezeption genannt.
- Citar trabajo
- Wiebke Westphal (Autor), 2010, "Rabbatz der Halbstarken", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190922