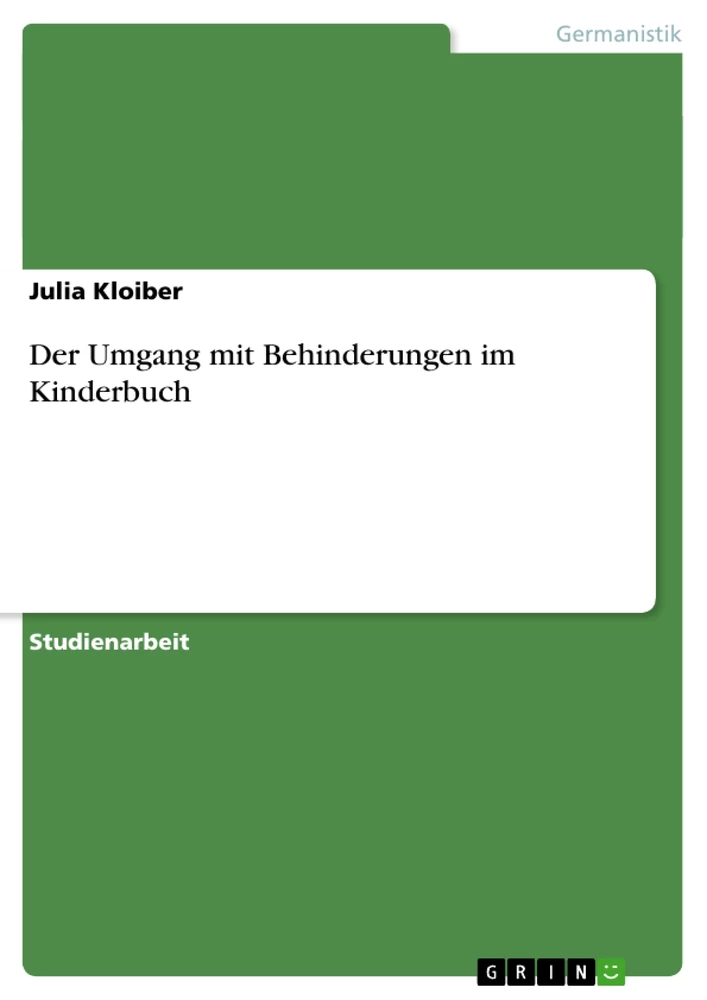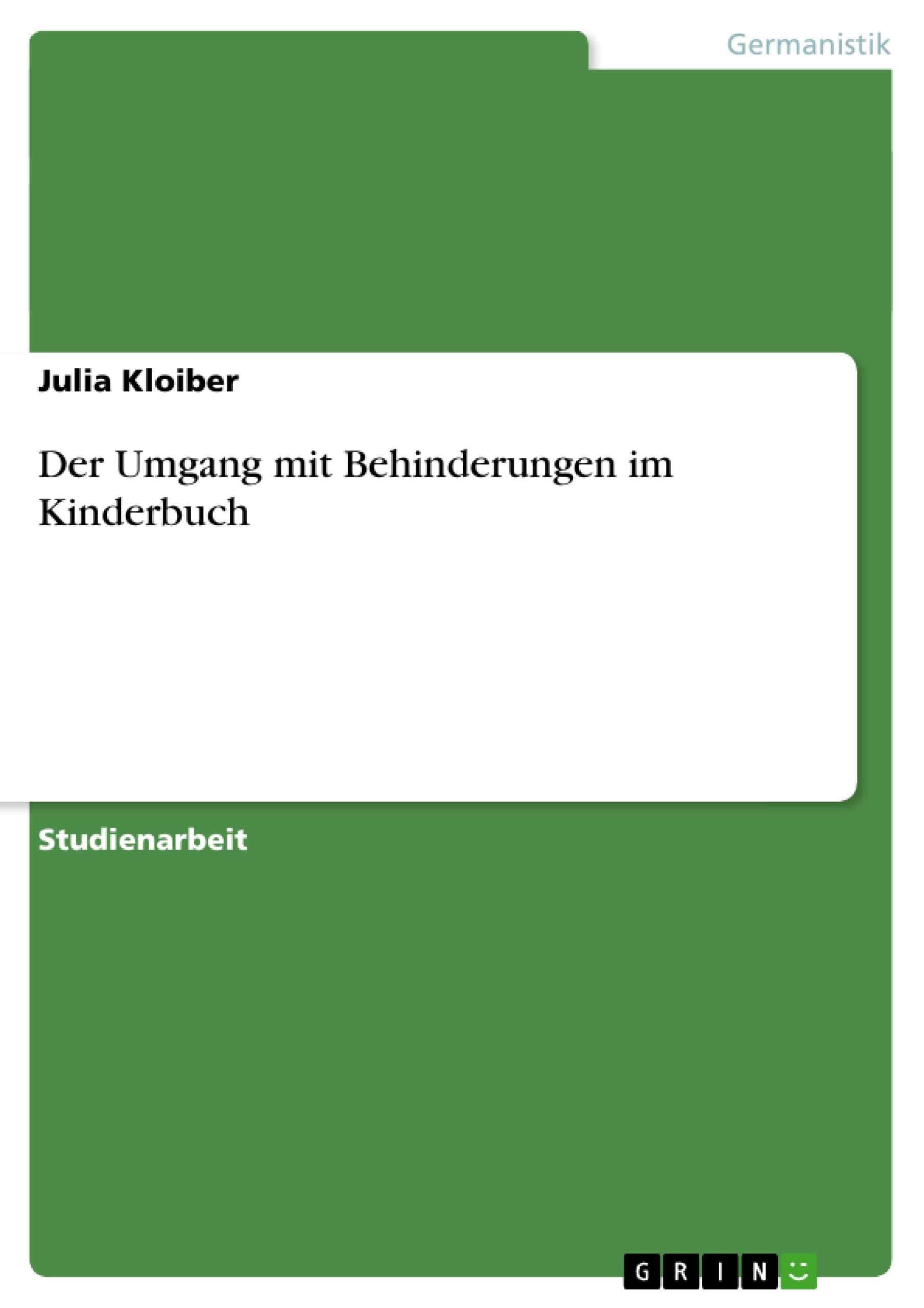Dieser Text soll einen Überblick über das Thema "Geistige Behinderung im Kinderbuch" geben. Um verschiedene Umgangsformen, sowohl in der Familie, als auch unter Freunden und in der Gesellschaft aufzuweisen, wurden zwei Bücher verglichen und zur Analyse herangezogen. Zum Einen das Buch "Tage mit Eddie oder was heißt schon normal" von Janet Tashjian. Dieses Buch wird schwerpunktmäßig zum Einsatz kommen und unterliegt der hauptsächlichen Analyse. Zum Vergleich wurde ein zweites Buch, "Eine wunderbare Liebe" von Kirsten Boie, herangezogen. Dieses wird zum Schluss des Textes als Vergleichsmaterial genutzt.
Geistige Behinderung ist ein Thema, welches in der heutigen Gesellschaft immer noch einem Tabu unterliegt. Es wird kaum darüber gesprochen und betroffene Menschen, vor allem betroffene Kinder, werden ausgegrenzt und erleiden Spott und Kränkungen. Auffällig dabei ist jedoch, dass Erwachsene meist die Personen sind, die Vorurteile gegenüber Behinderten hegen und verbreiten, indem sie diese, meist unbewusst, ihren Kindern weitergeben. Kinder, die keine Vorurteile kennen, gehen sehr vernünftig und unvoreingenommen mit betroffenen Personen um. Diese unterschiedlichen Umgangsformen und Klischees sollen anhand der zwei bearbeiteten Bücher dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Fragestellungen
- Fremdheitswahrnehmung
- Erzählstruktur und Erzählverhalten
- Wie geht True, als gesunde Zwillingsschwester, mit dem Anderen (Eddie) um?
- Konfliktlösung
- Vergleiche
- Wer ist Marlon?
- Wie geht Mona mit einem behinderten Menschen um?
- Monas Eltern und der Umgang mit dem „Anderen“
- Konfliktlösung
- Nachwort
- Pädagogischer Wert des Buches: „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“
- Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung geistiger Behinderung in Kinderbüchern. Ziel ist es, verschiedene Umgangsformen mit Behinderung im familiären, freundschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext aufzuzeigen. Dies geschieht anhand eines Vergleichs zweier Bücher: „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ von Janet Tashjian und „Eine wunderbare Liebe“ von Kirsten Boie. Der Fokus liegt auf der Analyse von „Tage mit Eddie…“, wobei „Eine wunderbare Liebe“ als Vergleichswerk dient.
- Darstellung geistiger Behinderung in der Kinderliteratur
- Umgang mit Vorurteilen und gesellschaftlicher Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung
- Die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds
- Identifikation und Akzeptanz
- Pädagogischer Wert der Kinderliteratur im Kontext von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, verschiedene Umgangsformen mit geistiger Behinderung in Kinderbüchern zu analysieren. Es werden zwei Bücher vorgestellt: „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ von Janet Tashjian (Hauptfokus) und „Eine wunderbare Liebe“ von Kirsten Boie (Vergleichswerk). Die Einleitung betont das Tabu-Thema geistige Behinderung und den oft unreflektierten Umgang damit, besonders von Erwachsenen, im Gegensatz zur unvoreingenommenen Akzeptanz von Kindern. Die Arbeit verspricht, diese unterschiedlichen Umgangsformen anhand der beiden Bücher zu beleuchten.
Inhaltsangabe: Die Inhaltsangabe fasst kurz den Inhalt von Janet Tashjians „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Zwillingsschwestern True und Eddie, wobei Eddie geistig behindert ist. True, die gesunde Zwillingsschwester, bemüht sich intensiv, Eddie ein normales Leben zu ermöglichen und kämpft mit den Reaktionen des Umfelds auf Eddies Behinderung. Der Fokus liegt auf Trues Suche nach einem Heilmittel und ihrer schlussendlichen Erkenntnis, dass Akzeptanz und Unterstützung wichtiger sind als die Suche nach einer "Heilung".
Fragestellungen: Dieses Kapitel legt die zentralen Fragen fest, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Es konzentriert sich auf die formalen Aspekte des Buches „Tage mit Eddie...“, insbesondere die Fremdheitswahrnehmung der Figur Eddie, die Erzählstruktur und das Erzählverhalten, Trues Umgang mit Eddie und die Konfliktlösungen im Buch. Es werden theoretische Ansätze zur Darstellung von Außenseitern in der Literatur herangezogen.
Häufig gestellte Fragen zu „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung geistiger Behinderung in Kinderbüchern, insbesondere in Janet Tashjians „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ und im Vergleichswerk „Eine wunderbare Liebe“ von Kirsten Boie. Der Fokus liegt auf der Untersuchung verschiedener Umgangsformen mit Behinderung im familiären, freundschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext und dem pädagogischen Wert der Kinderliteratur im Hinblick auf Inklusion.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung geistiger Behinderung in der Kinderliteratur, den Umgang mit Vorurteilen und gesellschaftlicher Ausgrenzung, die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds, Identifikation und Akzeptanz sowie den pädagogischen Wert der Kinderliteratur im Kontext von Inklusion. Konkret werden die Fremdheitswahrnehmung, die Erzählstruktur, Trues Umgang mit ihrem Bruder Eddie und die Konfliktlösung im Buch „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ analysiert.
Welche Fragestellungen werden untersucht?
Die zentralen Fragen betreffen die Fremdheitswahrnehmung von Eddie, die Erzählstruktur und das Erzählverhalten des Buches, Trues Umgang mit ihrem geistig behinderten Zwillingsbruder, und die im Buch dargestellten Konfliktlösungen. Zusätzlich wird ein Vergleich mit „Eine wunderbare Liebe“ von Kirsten Boie gezogen, um verschiedene Umgangsformen mit Behinderung zu beleuchten.
Wie wird das Buch „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ zusammengefasst?
Die Inhaltsangabe beschreibt die Geschichte der Zwillingsschwestern True und Eddie, wobei Eddie geistig behindert ist. Der Schwerpunkt liegt auf Trues Bemühungen, Eddie ein normales Leben zu ermöglichen, ihren Kampf mit den Reaktionen des Umfelds und ihrer letztlichen Erkenntnis, dass Akzeptanz und Unterstützung wichtiger sind als die Suche nach einer „Heilung“.
Welchen pädagogischen Wert hat das Buch?
Die Arbeit untersucht den pädagogischen Wert von „Tage mit Eddie oder was heißt schon normal“ im Kontext von Inklusion. Sie beleuchtet, wie das Buch zum Verständnis und zur Akzeptanz von Menschen mit geistigen Behinderungen beitragen kann.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einer Inhaltsangabe, einem Kapitel mit Fragestellungen (Fremdheitswahrnehmung, Erzählstruktur, Trues Umgang mit Eddie, Konfliktlösung), einem Vergleichskapitel mit „Eine wunderbare Liebe“, einem Kapitel zum pädagogischen Wert des Buches und einem persönlichen Fazit.
- Quote paper
- Julia Kloiber (Author), 2003, Der Umgang mit Behinderungen im Kinderbuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19090