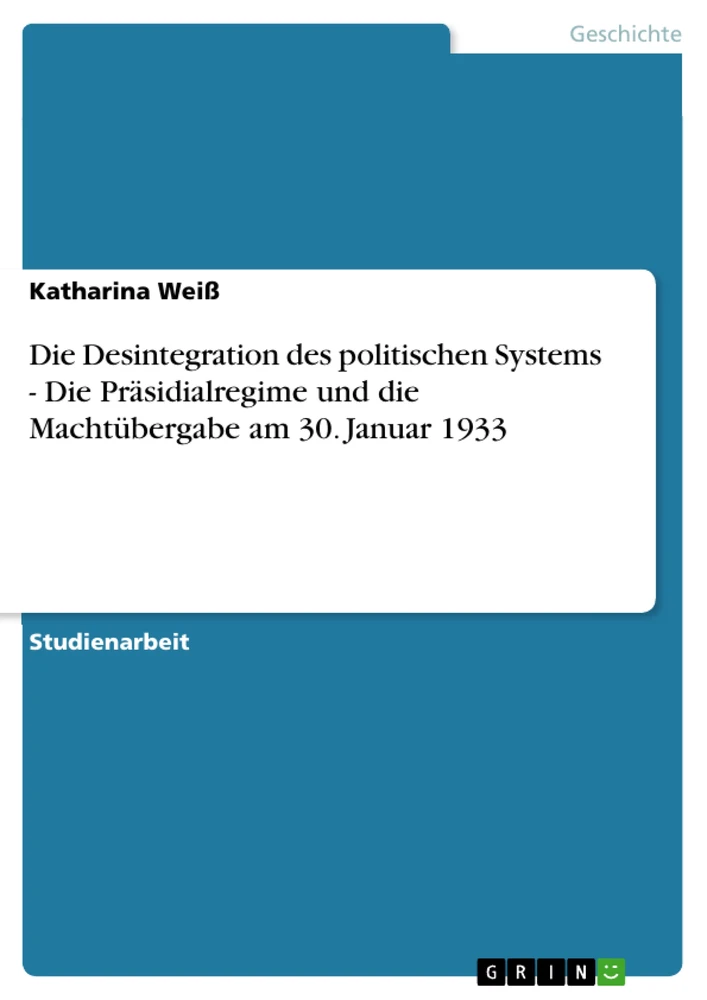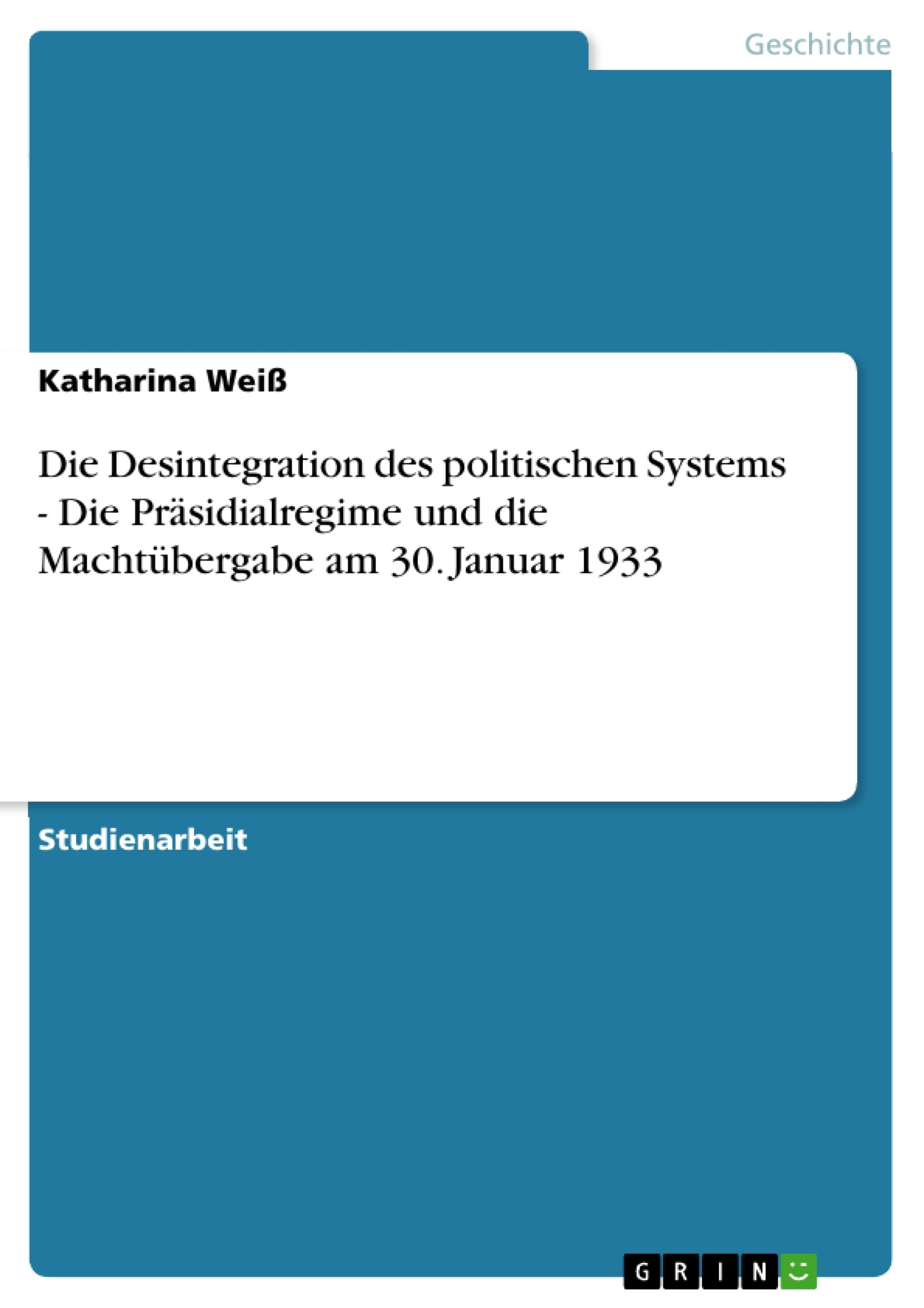Die Zeit der Weimarer Republik ist ein Kapitel der Geschichte Deutschlands, das - nicht nur aufgrund ihres scheinbar schicksalhaften Endes - die Forschung stets beschäftigte. Dennoch ist scheinbar gerade die letzte Phase der Republik besonders interessant, weil damit vermutlich beinahe unweigerlich die danach folgende Katastrophe der Diktatur und des fatalen Krieges verbunden wird. Die Frage nach den Ursachen des Scheiterns war und ist noch immer der Kern des wissenschaftlichen Interesses. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Übergang zu den Präsidialkabinetten ab März 1930 und den Aufstieg der Nationalsozialisten zur Massenbewegung gelegt.1 Auch diese Hausarbeit wird sich mit den Präsidialregimen und der Desintegration des politischen Systems im Hinblick auf den Fall der ersten deutschen Demokratie beschäftigen. Besonders werden hier auch die Präsidialkabinette und deren Auswirkungen auf das demokratische System sowie die Rolle Paul von Hindenburgs als Reichspräsident beleuchtet werden. Vor allem das Kapitel, das auf Hindenburg ausgerichtet sein wird soll einen ganz neuen Aspekt in der Weimarforschung beleuchten. Hier möchte ich die Hindenburg-Biographie Wolfram Pytas2 besonders hervorstellen, da diese eine andere und neue Sichtweise auf die bisherige Forschungslage zu Hindenburg und dem Untergang der Republik bietet. Des Weiteren stütze ich mich in meiner Argumentation vorwiegend auf die Gesamtdarstellungen Andreas Wirschings3 und Eberhard Kolbs sowie auf den Aufsatz Andreas Rödders. Die zeitlichen Grenzen dieses Themas sind jedoch nicht exakt zu bestimmen; die Historiker sind uneins über die Datierung der Endphase und vor allem über die Bestimmung des eigentlichen Endes. Einige Wissenschaftler bezeichnen keineswegs den Machtantritt Hitlers am 30. Januar 1933 als Ende der Republik; sie setzen schon weit früher an. Arthur Rosenberg beispielsweise erklärte den Zeitpunkt nach der Septemberwahl 1930 zur „Todesstunde der Weimarer Republik.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg zur Machtübergabe? Die Präsidialkabinette
- Die Ära Brüning: Anfang vom Ende oder letzte Chance?
- Praxis der Einsetzung der Artikel 48 und 25 der WRV
- SPD-Tolerierungspolitik
- Die Kabinette der Barone
- Franz von Papen
- Kurt von Schleicher
- Paul von Hindenburg: Lage und Handlungsspielräume des Reichspräsidenten
- Zusammenfassung: Der 30. Januar 1933- eine unvermeidbare Konsequenz?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Präsidialregimen und der Desintegration des politischen Systems der Weimarer Republik. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle der Präsidialkabinette und deren Einfluss auf das demokratische System sowie die Rolle Paul von Hindenburgs als Reichspräsident im Kontext der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern die Präsidialkabinette zur Desintegration des politischen Systems und zur Ernennung Hitlers beigetragen haben, ob seine Ernennung eine logische Konsequenz der Ereignisse war und ob es alternative Handlungsmöglichkeiten gegeben hat.
- Die Rolle der Präsidialkabinette und deren Auswirkungen auf das demokratische System
- Die Handlungsspielräume des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg
- Die Desintegration des politischen Systems der Weimarer Republik
- Die Frage nach der Verantwortlichkeit der Präsidialkabinette für den Aufstieg der Nationalsozialisten
- Die Analyse der Entscheidungen und Ereignisse, die zur Machtübergabe an die Nationalsozialisten führten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Präsidialregime und die Desintegration des politischen Systems der Weimarer Republik mit einem besonderen Fokus auf die Rolle von Hindenburg und den Präsidialkabinetten. Die Arbeit setzt den zeitlichen Rahmen von der Ernennung Brünings bis zur Einsetzung Hitlers als Reichskanzler (28. März 1930 - 30. Januar 1933).
- Der Weg zur Machtübergabe? Die Präsidialkabinette:
- Die Ära Brüning: Anfang vom Ende oder letzte Chance?: Das Kapitel beleuchtet die Ernennung Heinrich Brünings zum Reichskanzler am 28. März 1930 und den Beginn der Präsidialkabinette. Die Arbeit diskutiert die kontroversen Ansichten über Brünings Rolle und sein Wirken, insbesondere im Hinblick auf seine Finanzpolitik und die Anwendung des Notverordnungsartikels 48.
- Die Kabinette der Barone: Dieses Kapitel behandelt die Präsidialkabinette unter Franz von Papen und Kurt von Schleicher. Es wird auf die Rolle der Präsidialgewalt und die Desintegration des politischen Systems eingegangen.
- Paul von Hindenburg: Lage und Handlungsspielräume des Reichspräsidenten: Der Abschnitt konzentriert sich auf die Position und die Handlungsmöglichkeiten des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg in der letzten Phase der Republik. Es wird auf die Herausforderungen und Entscheidungen Hindenburgs eingegangen, die zur Machtübergabe an die Nationalsozialisten führten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Aspekte der Weimarer Republik, insbesondere die Präsidialregime, die Desintegration des politischen Systems, die Rolle von Hindenburg und die Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Die Arbeit beleuchtet die Praxis der Einsetzung der Artikel 48 und 25 der Weimarer Reichsverfassung, die Tolerierungspolitik der SPD und die Bedeutung der Präsidialkabinette von Brüning, Papen und Schleicher. Zentrale Konzepte sind die Funktionsweise der Weimarer Republik, die Herausforderungen des politischen Systems, die Rolle des Reichspräsidenten und die Ursachen für den Aufstieg der Nationalsozialisten.
- Citar trabajo
- Katharina Weiß (Autor), 2008, Die Desintegration des politischen Systems - Die Präsidialregime und die Machtübergabe am 30. Januar 1933 , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190845