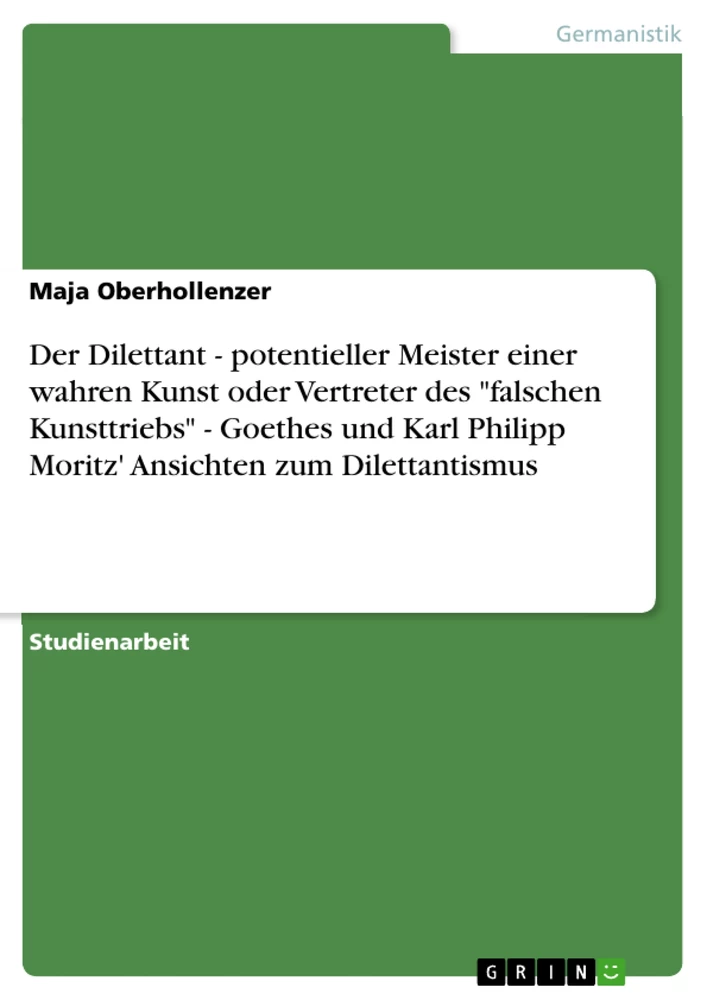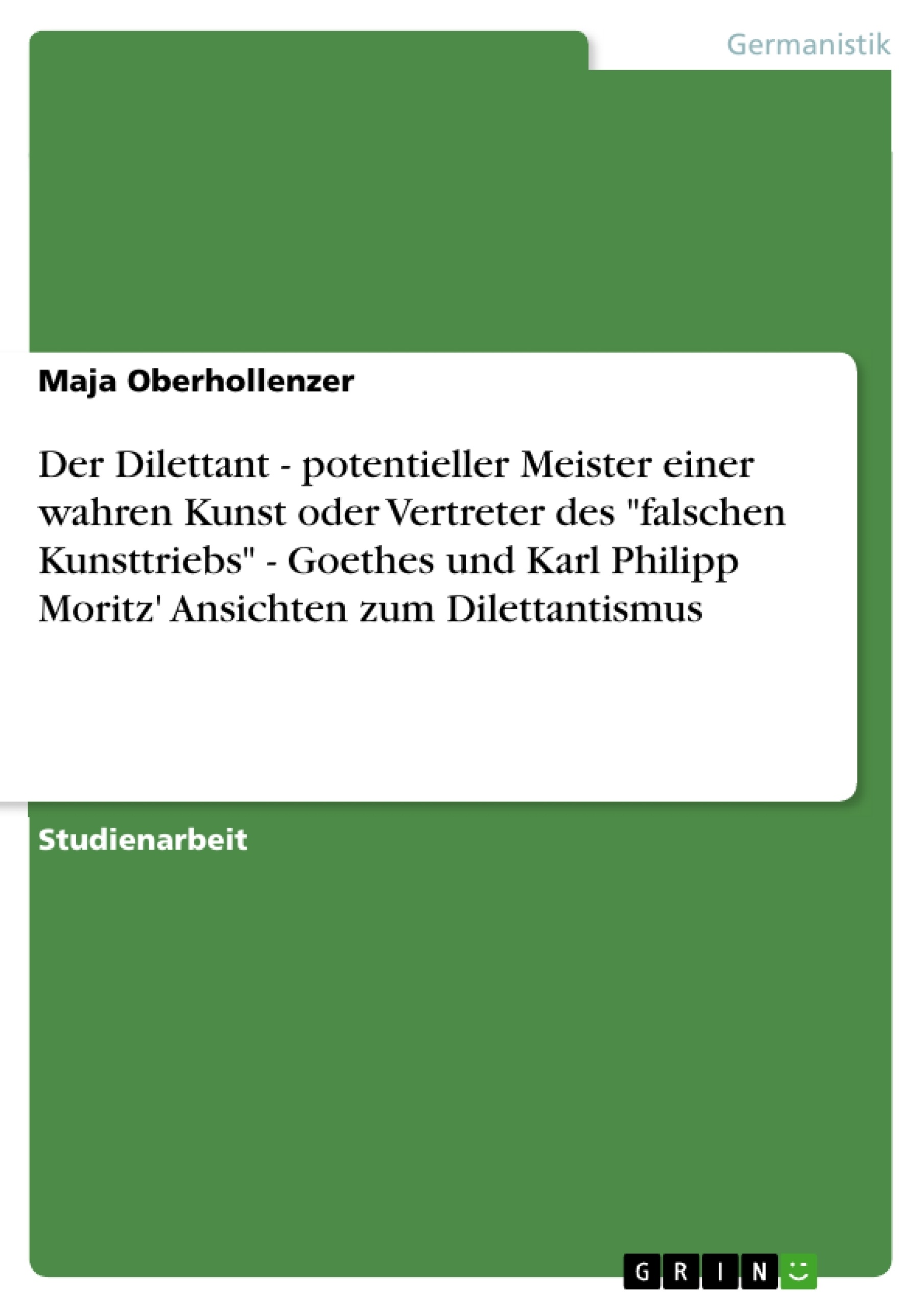Einleitung
„Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.“ (Goethe, Maximen und Reflexionen Nr. 719 HA)
Die Erforschung allgemein gültiger Kunstgesetze zählte zu den zentralen Anliegen in Goethes Arbeit als Wissenschaftler. Dabei begriff der Dichter die Natur als Schlüssel, da sie nach Gesetzen verfahre, deren Kenntnis dem Künstler zum Kunstverständnis und somit zur wahren Künstlerschaft verhelfe. Die Erkenntnis, dass sich feste Kunstbegriffe vermitteln lassen, findet auch Ausdruck in Goethes Dilettantenbild. In dieser Seminararbeit soll vor dem Hintergrund seines literarischen Schaffens gezeigt werden, wie positiv Goethe dieses Bild, im Sinne einer legitimen und ausbaufähigen Kunstübung, zeichnete.
So wird zunächst Goethes persönlicher Erlebnisgehalt beleuchtet, da dieser in enger Verbindung mit seiner Dilettantismusauffassung steht. Anschließend wird diese Auffassung exemplarisch an mehreren Werken, in welchen sie sich besonders gut manifestiert, dargestellt. Insbesondere die Texte aus Goethes klassischer Epoche, die nach seinem zweijährigen Italienaufenthalt, welcher seine Kunstanschauung entscheidend geprägt hat, entstanden, sind hier sehr aussagekräftig. Das gemeinsame Projekt mit Schiller „Über den Dilettantismus“ gibt dabei ebenso Aufschluss über sein positives Dilettantenbild wie auch seine selbstständigen Werke „Der Sammler und die Seinigen“, „Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl“ und „Künstlers Apotheose“.
Im zweiten Teil der Arbeit werden als Gegenbeispiel Karl Philipp Moritz’ ästhetischer Aufsatz „Über die bildende Nachahmung des Schönen“ und seine Auffassung vom „falschen Kunsttrieb“ analysiert, mit dem er zum ersten Mal eine psychologische Ebene in die Diskussion um den Dilettantismus einbrachte. Trotz eines völlig differenten Urteils über das künstlerische Dilettieren, zeigt sich ein Zusammenhang zwischen den Theoremen von Moritz und Goethe, der wahrscheinlich aus den gemeinsamen Kunstgesprächen in Rom resultiert. Abschließend wird noch kurz auf die Dilettantismusproblematik in „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und im „Anton Reiser“ eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethes eigener Dilettantismus
- Das Dilettantismusprojekt mit Schiller
- ,,Über den Dilettantismus“ – die Dilettantismusschemata
- „Der Sammler und die Seinigen“.
- „,,Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl“.
- Die,,einfache Nachahmung“.
- Die,,Manier“
- Der,,Styl“
- Zweiter Teil
- Parallelen zwischen „Der Sammler und die Seinigen“ und „Einfache Nachahmung\nder Natur, Manier, Styl“.
- ,,Künstlers Apotheose“.
- Karl Philipp Moritz – „Über die bildende Nachahmung des Schönen“ und den\n-,
- ,,falschen Kunsttrieb“
- Zwecklosigkeit und Autonomie des Schönen
- Die vier Kräfte.
- Das Genie
- Die Verwechslung von Empfindungskraft und Bildungskraft
- Differenzen zwischen Goethes und Moritz' Konzepten
- ,,Anton Reiser“
- Wilhelm Meister
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Goethes positivem Dilettantenbild im Kontext seines literarischen Schaffens. Sie zeigt auf, wie Goethe dieses Bild, im Sinne einer legitimen und ausbaufähigen Kunstübung, zeichnete und welche Rolle seine persönlichen Erfahrungen dabei spielten.
- Goethes eigene Auseinandersetzung mit dem Dilettantismus anhand seiner künstlerischen Betätigungen.
- Goethes Dilettantismusauffassung in seinen Werken, insbesondere aus der klassischen Epoche.
- Das gemeinsame Projekt „Über den Dilettantismus“ mit Schiller und seine Bedeutung für Goethes Dilettantenbild.
- Ein Vergleich mit Karl Philipp Moritz' Kritik am „falschen Kunsttrieb“ und dessen Einfluss auf die Dilettantismusdebatte.
- Die Darstellung der Dilettantismusproblematik in „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Anton Reiser“.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in Goethes Interesse an allgemeinen Kunstgesetzen und dessen Verbindung zur Natur ein. Sie erläutert, wie sich Goethes Dilettantenbild in seiner Arbeit widerspiegelt und die Seminararbeit thematisiert, wie er dieses Bild positiv zeichnete.
Kapitel 2 beleuchtet Goethes persönliche Erfahrung mit dem Dilettantismus, insbesondere seine Auseinandersetzung mit dem Zeichnen und die daraus resultierenden Erkenntnisse. Goethes Reise nach Italien und seine Begegnung mit der Kunst der Antike und der Renaissance spielten dabei eine entscheidende Rolle.
Kapitel 3 befasst sich mit Goethes und Schillers gemeinsames Projekt „Über den Dilettantismus“. Dieses Projekt, welches tabellarisch den Nutzen und Schaden des Dilettantismus in verschiedenen Kunstformen erforschen sollte, blieb zwar unvollendet, die vorhandenen Schemata geben jedoch wichtige Einblicke in Goethes Dilettantenbild.
Kapitel 4 analysiert Goethes Werke „Der Sammler und die Seinigen“ und „Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl“ im Hinblick auf seine Dilettantismusauffassung. Diese Werke spiegeln Goethes Überzeugung wider, dass der Dilettant durch Studium und Übung zu Meisterschaft gelangen kann.
Kapitel 5 stellt Karl Philipp Moritz' ästhetischen Aufsatz „Über die bildende Nachahmung des Schönen“ und dessen Kritik am „falschen Kunsttrieb“ vor. Moritz' Analyse des Dilettantismus fokussiert auf die psychologische Ebene und stellt somit einen Kontrast zu Goethes positiver Sichtweise dar.
Kapitel 6 untersucht die Unterschiede zwischen Goethes und Moritz' Dilettantismuskonzepten und zeigt gleichzeitig auf, wie ihre gemeinsamen Kunstgespräche in Rom möglicherweise zu ihrer jeweiligen Sichtweise beigetragen haben.
Kapitel 7 behandelt die Dilettantismusproblematik in „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Anton Reiser“. Es analysiert, wie sich Goethes eigene Gedanken zum Dilettantismus in diesen beiden Werken niederschlagen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf Goethes Dilettantismusauffassung und dessen Bedeutung für seine künstlerische Arbeit. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kunstgesetze, Natur, Dilettantenbild, Kunstübung, Selbstverständnis, künstlerische Betätigungen, klassische Epoche, Italienreise, „Über den Dilettantismus“, „Der Sammler und die Seinigen“, „Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl“, „Künstlers Apotheose“, „Über die bildende Nachahmung des Schönen“, „falscher Kunsttrieb“, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, „Anton Reiser“.
- Quote paper
- Maja Oberhollenzer (Author), 2006, Der Dilettant - potentieller Meister einer wahren Kunst oder Vertreter des "falschen Kunsttriebs" - Goethes und Karl Philipp Moritz' Ansichten zum Dilettantismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190718