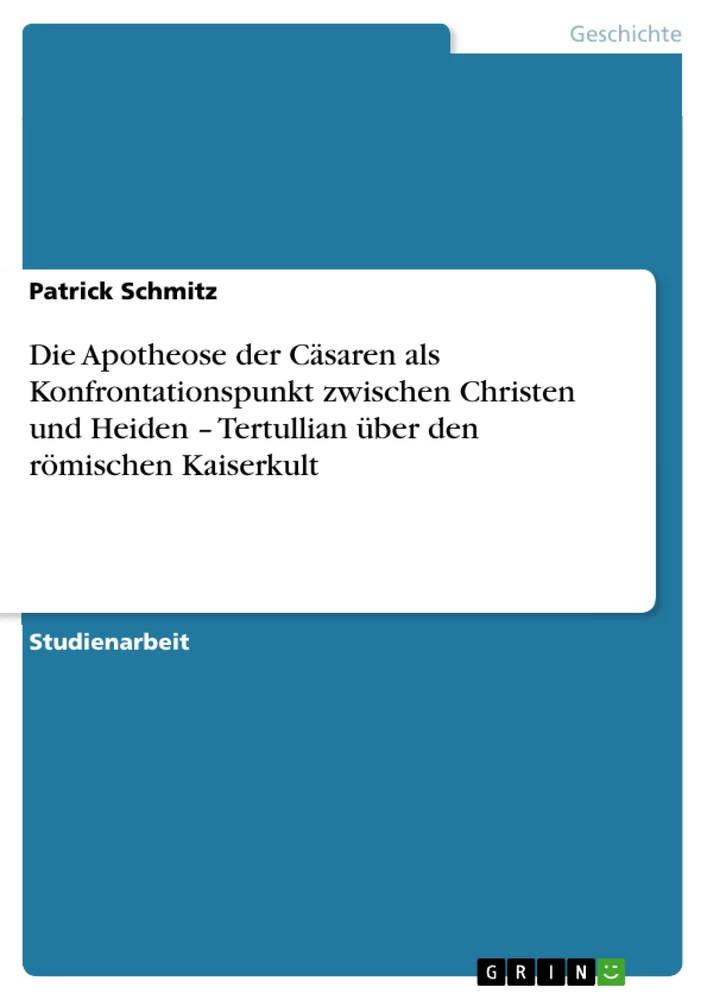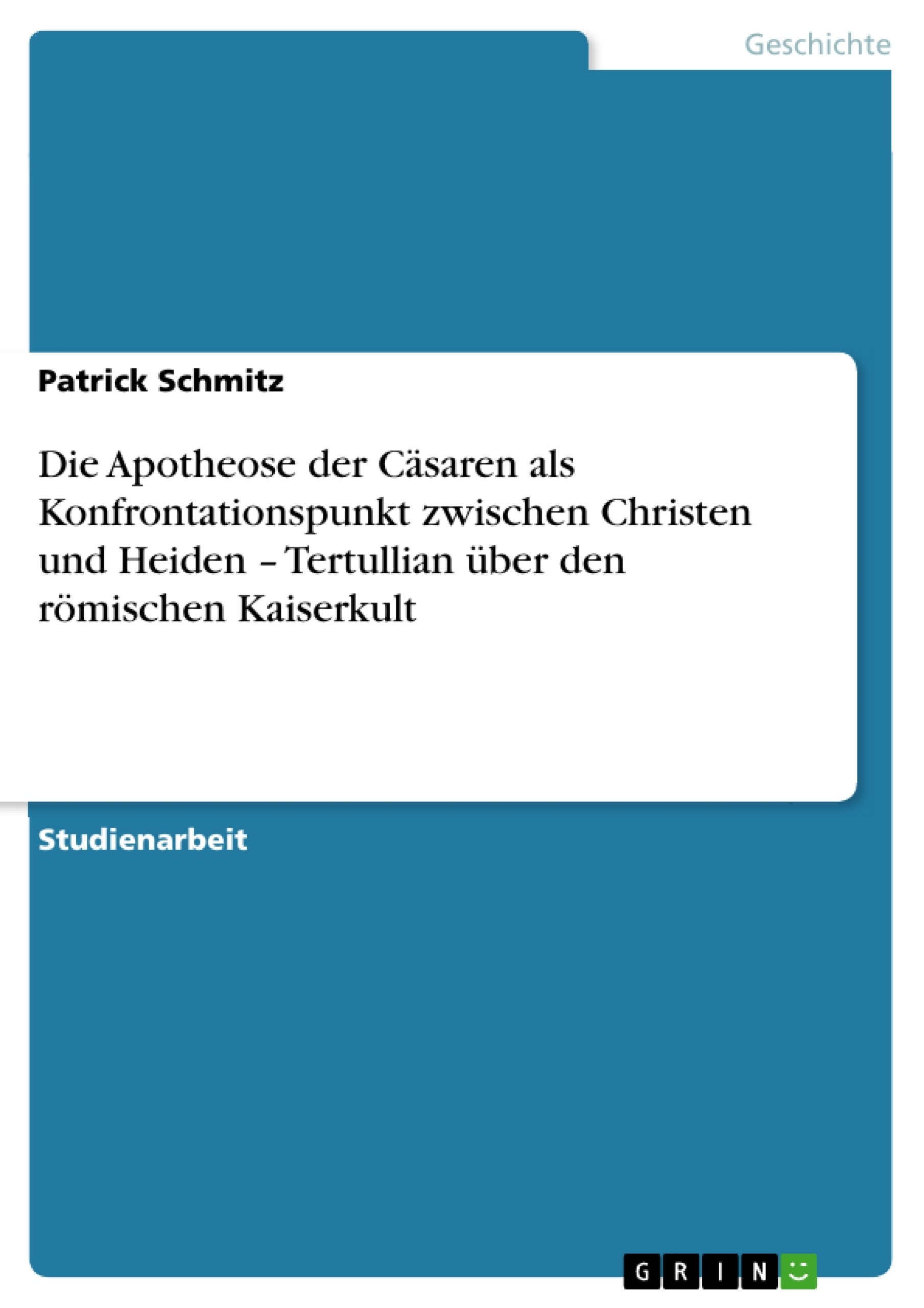Um die Diskussion dieser Punkte verstehen zu können, wird darüber hinaus untersucht werden, ob die Vorwürfe Tertullians tatsächlich der Realität entsprachen, d.h. was die heidnisch-römische Historiographie im Hinblick auf die consecratio, die „rechts- und ritualmäßige Einreihung einer profanen Person … in die Kategorie des Heiligen“5 zu berichten wissen. Auf welche Art und Weise wurden die Kaiser verehrt? Ließen sich alle Kaiser zu Lebzeiten als Gottheiten verehren oder unterlag die Apotheose bzw. Konsekration dieser gewissen Einschränkungen? Zur Diskussion der in dieser Arbeit zu behandelnden Aspekte, namentlich des Kaiseropfers und –schwurs (Kapitel 2), der Hierarchie zwischen Kaiser und Gott (Kapitel 3), des Gebets Vgl. für den Kaiser (Kapitel 4) sowie der Kaisertitulatur (Kapitel 5) werden weitere zeitgenössische Apologien herangezogen. Hierzu dienen die Werke des Theophilus von Antiochia, des Athenagoras, des Origenes, des Minucius Felix sowie des Justin, die
überwiegend im stürmischen Übergang zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert publiziert haben. Widerspricht Tertullian den Ansichten dieser Autoren oder stützen sich die mannigfaltigen Argumentationen gegenseitig? Auch die Quellen der Grundsätze in den Apologien sind eingehend zu beleuchten. Welche Gebote und Verbote finden sich in der Heiligen Schrift, welche werden durch frühe Schriften wie die Briefe des Clemens oder des Polykarp verbreitet? Letztlich ist allerdings kaum flächendeckend zu beweisen, ob die frühen Christen tatsächlich allesamt Kenntnis von den Argumentationen in den Apologien sowie den Anweisungen in den anderen christlichen Quellen hatten und letztere auch befolgten. Ein Blick in die Akten des Heiligen Polykarp, des Heiligen Apollonius und anderer zeitgenössischer Märtyrer erlaubt lediglich die Betrachtung eines (historischen) Ausschnittes der Konfrontation zwischen Christen und Heiden. Auf die quellennahe Analyse der unterschiedlichen Apologien, allen voran des Apologeticums, und deren Prüfung mit Hilfe der heidnischen Geschichtsschreibung ebenso wie der Märtyrerakten erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, welche diese Arbeit gemeinsam mit Bildern von römischen Münzen im Anhang beschließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Kaiseropfer und der Kaiserschwur
- 3. Der Kaiser und seine Konkurrenz zu anderen Gottheiten und dem christlichen Gott
- 4. Die religiöse und weltliche Ebene der Kaiserverehrung
- 5. Tertullians Haltung zur Kaisertitulatur
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Tertullians „Apologeticum“ im Kontext der Christenverfolgung im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. Das Hauptziel ist die Untersuchung von Tertullians Argumentation gegen die Kaiserverehrung und die Einordnung der christlichen Position innerhalb des römischen Kaiserkultes. Es wird beleuchtet, wie weit sich Christen nach Tertullian anpassen konnten, ohne ihren Glauben zu gefährden.
- Tertullians Argumentation gegen die Kaiserverehrung
- Die Christenverfolgung im Römischen Reich
- Das Verhältnis von Christen und Heiden im Kontext des römischen Kaiserkultes
- Die Rolle des Kaiseropfers und des Kaiserschwurs
- Die Akzeptanz und Ablehnung heidnischer Gepflogenheiten durch Christen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Christenverfolgung im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie stellt Tertullian und sein „Apologeticum“ vor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit, die sich auf Tertullians Haltung zur Kaiserverehrung, die Akzeptanz oder Ablehnung römischer Gepflogenheiten und die Analyse seiner Argumentationsstruktur im „Apologeticum“ im Zusammenhang mit dem Anklagepunkt des crimen laesae maiestatis konzentrieren. Die Einleitung umreißt die methodische Vorgehensweise, die die Untersuchung zeitgenössischer Apologien und die heidnisch-römische Geschichtsschreibung umfasst, um Tertullians Position zu kontextualisieren und zu überprüfen.
2. Das Kaiseropfer und der Kaiserschwur: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Kapitel 28 von Tertullians „Apologeticum“, welches die Ablehnung des Kaiseropfers durch Christen thematisiert. Es wird zwischen dem gesetzlichen Zwang zum Opfer und der gesellschaftlichen Erwartungshaltung differenziert, wobei der Fokus auf der letzteren liegt. Das Kapitel analysiert Tertullians Kritik an dem Druck, Christen zum Kaiseropfer zu bewegen, und beleuchtet die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen, die zu diesem Druck führten. Die Argumentation setzt sich mit der Frage auseinander, ob und inwieweit dieser Druck rechtlich verankert war, und verweist auf die späteren Dekrete unter Kaiser Decius als ein Beispiel für die Verschärfung der Verfolgung.
Schlüsselwörter
Tertullian, Apologeticum, Kaiserkult, Christenverfolgung, Römisches Reich, Kaiseropfer, Kaiserschwur, crimen laesae maiestatis, Heiden, Christen, religiöse Toleranz, heidnische Gepflogenheiten.
Häufig gestellte Fragen zu Tertullians Apologeticum und der Kaiserverehrung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Tertullians „Apologeticum“ im Kontext der Christenverfolgung im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. Der Fokus liegt auf Tertullians Argumentation gegen die Kaiserverehrung und der Einordnung der christlichen Position innerhalb des römischen Kaiserkultes. Es wird untersucht, wie weit sich Christen nach Tertullian anpassen konnten, ohne ihren Glauben zu gefährden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Tertullians Argumentation gegen die Kaiserverehrung, die Christenverfolgung im Römischen Reich, das Verhältnis von Christen und Heiden im Kontext des römischen Kaiserkultes, die Rolle des Kaiseropfers und des Kaiserschwurs sowie die Akzeptanz und Ablehnung heidnischer Gepflogenheiten durch Christen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Christenverfolgung und führt in die Thematik ein. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Ablehnung des Kaiseropfers durch Christen, differenziert zwischen gesetzlichem Zwang und gesellschaftlicher Erwartung und analysiert Tertullians Kritik. Weitere Kapitel befassen sich mit der religiösen und weltlichen Ebene der Kaiserverehrung und Tertullians Haltung zur Kaisertitulatur (genaue Kapitelüberschriften siehe Inhaltsverzeichnis).
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Untersuchung von Tertullians Argumentation gegen die Kaiserverehrung und die Einordnung der christlichen Position innerhalb des römischen Kaiserkultes. Es soll beleuchtet werden, wie weit sich Christen nach Tertullian anpassen konnten, ohne ihren Glauben zu gefährden.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit untersucht zeitgenössische Apologien und die heidnisch-römische Geschichtsschreibung, um Tertullians Position zu kontextualisieren und zu überprüfen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Tertullian, Apologeticum, Kaiserkult, Christenverfolgung, Römisches Reich, Kaiseropfer, Kaiserschwur, crimen laesae maiestatis, Heiden, Christen, religiöse Toleranz, heidnische Gepflogenheiten.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang des Dokuments und listet die einzelnen Kapitel auf (Einleitung, Das Kaiseropfer und der Kaiserschwur, Der Kaiser und seine Konkurrenz, Die religiöse und weltliche Ebene der Kaiserverehrung, Tertullians Haltung zur Kaisertitulatur, Fazit).
- Quote paper
- Patrick Schmitz (Author), 2010, Die Apotheose der Cäsaren als Konfrontationspunkt zwischen Christen und Heiden – Tertullian über den römischen Kaiserkult, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190618