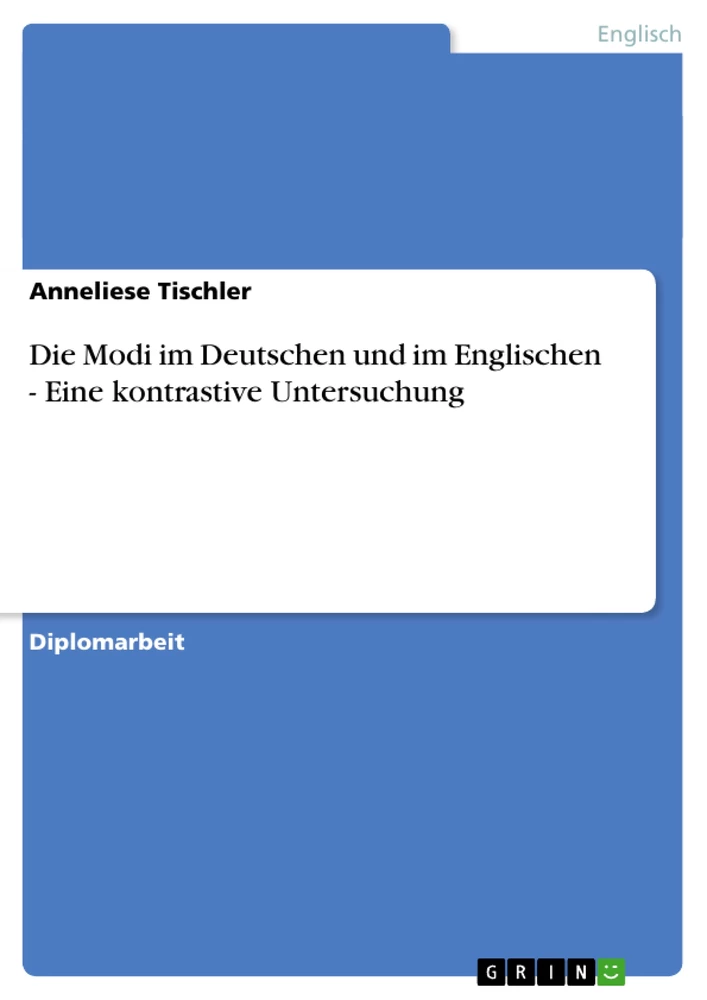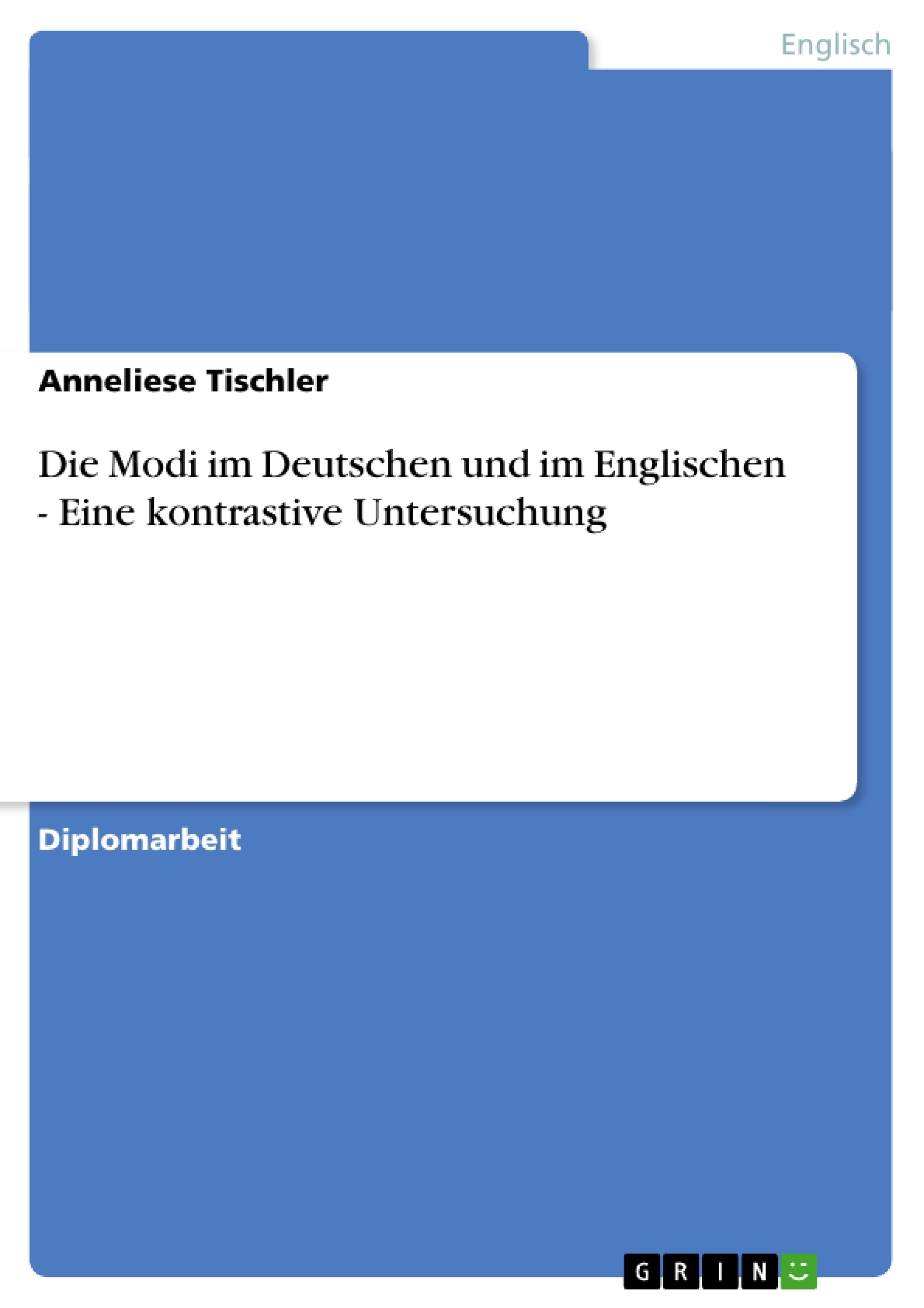Die gegenwärtige Umwelt wird von den raschen Schritten der Technologie- und
Wissenschaftsentwicklung bedeutend geprägt. Da die englische Welt der zentrale Ausgangspunkt
dieser Fortschritte in allen Bereichen des Lebens ist, entwickelte sich die englische Sprache
rasch zu einer internationalen Sprache der allgemeinen Verständigung. So übt diese auf die
meisten Sprachen einen immer stärker und besorgenden werdenden Einfluss aus. Englisch
kristallisiert sich zu der wichtigsten Fremdsprache, deren Erlernen für einen Menschen der
Gegenwart zu einem Muss wird.
Es wurde festgestellt, dass die Muttersprache oft ein Hindernis im Lernen einer Zweitsprache
ist. So entstand die vorliegende Arbeit aus dem Wunsch, eine Übersicht über die Ähnlichkeiten
und Unterschiede der zwei germanischen Sprachen, Englisch und Deutsch, zu bieten. Obwohl
gleicher Herkunft, entwickelten sich die deutsche und englische Sprache in verschiedenen
historischen und kulturellen Kontexten. Wenn das Englische schon eine fast gänzlich analytische
Sprache ist, so ist noch das Deutsche im Prozess des Übergangs von einem synthetischen zu
einem analytischen System.
Da das Verb, als gründende und organisierende Kraft des Satzes, im Mittelpunkt der
Aussagestruktur steht, habe ich dieses Satzglied zum Thema der Arbeit gewählt.
In dieser Arbeit habe ich versucht, das Verb im System der Sprache einzugliedern und die
wichtigsten Charakteristika des Verbs anzugehen. Falls die englischen Verbformen den
deutschen entsprechen und eine Parallele zwischen zwei Sprachen möglich ist, wird in den
Klammern die englische Übersetzung angegeben. Falls die Formen zu differenziert sind, werden
die Unterschiede im gleichen Kapitel separat behandelt, mit einer deutschen Übersetzung der
englischen Beispielen in Klammer.
Inhaltsverzeichnis
- Begründung der Themenwahl
- Überlegungen zur kontrastiven Linguistik
- Allgemeine Betrachtungen zum Gegenstand der Morphologie
- Das Verb
- Verbklassen und Flexionstypen
- Grammatische Kategorien des Verbs
- Tempus
- Modus
- Genus
- Sematische Aspekte
- Sematische Kategorien des Verbs
- Aktionsarten und Aspekte des Verbs
- Modalverben und Funktionsverben
- Flexion (Konjugation)
- Finite Formen
- Die Modi
- Allgemeines
- Paradigmatisch - potentielle Modusbedeutung
- Der Indikativ
- Der Konjunktiv
- Der Imperativ
- Syntagmatisch – aktuelle Modusbedeutung
- Der Indikativ
- Der Konjunktiv
- Der Imperativ
- Gebrauchstypen der Konjunktive
- Obligatorisch fakultativer Gebrauch
- Modale Bedeutungskomplexe
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Modi im Deutschen und Englischen kontrastiv zu untersuchen und Ähnlichkeiten sowie Unterschiede zwischen den beiden germanischen Sprachen aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Verb als zentralem Element der Satzstruktur. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen des Fremdsprachenlernens, insbesondere die Interferenzen zwischen Mutter- und Zweitsprache.
- Kontrastive Analyse des deutschen und englischen Verbssystems
- Untersuchung der Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) in beiden Sprachen
- Herausarbeitung von Ähnlichkeiten und Unterschieden in der morphologischen und semantischen Struktur der Verben
- Analyse der Interferenzen zwischen Deutsch und Englisch im Kontext des Fremdsprachenlernens
- Bedeutung der kontrastiven Linguistik für den Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Begründung der Themenwahl: Die Arbeit begründet die Wahl des Themas mit dem wachsenden Einfluss des Englischen als internationale Sprache und den Herausforderungen, die sich daraus für das Erlernen dieser Sprache ergeben. Die Muttersprache wird als mögliches Hindernis beim Erlernen einer Zweitsprache identifiziert. Die Arbeit will daher einen Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch bieten, wobei der Fokus auf dem Verb als zentralem Element der Satzstruktur liegt. Die Auswahl des Verbs als Thema wird damit gerechtfertigt, dass es die Aussage-Struktur eines Satzes grundlegend beeinflusst.
Überlegungen zur kontrastiven Linguistik: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und die Ziele der kontrastiven Linguistik, sowohl im theoretischen als auch im angewandten Bereich. Es wird die Rolle der kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht hervorgehoben, insbesondere die Analyse von Interferenzen zwischen Mutter- und Zweitsprache. Der Vergleich von Sprachstrukturen, die teilweise oder vollständig voneinander abweichen, wird als wichtiger Aspekt der kontrastiven Linguistik dargestellt. Die Unterscheidung zwischen theoretischen und angewandten kontrastiven Studien wird ebenfalls behandelt.
Allgemeine Betrachtungen zum Gegenstand der Morphologie: Dieses Kapitel definiert den Gegenstand der Morphologie als die Lehre von Wortarten und deren Formveränderungen im Satzkontext. Es erklärt den Begriff der Morphologie und deren Aufgabe, Morpheme, deren Klassen und Kombinationsregeln zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der strukturalistischen Morphologie, die Wortformen in einzelne Morpheme segmentiert und diese klassifiziert. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Morphologie für das Verständnis grammatischer Strukturen.
Schlüsselwörter
Kontrastive Linguistik, Deutsch, Englisch, Verb, Morphologie, Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ), Grammatische Kategorien, Semantik, Interferenzen, Fremdsprachenlernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur kontrastiven Analyse des deutschen und englischen Verbssystems
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kontrastiv die Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) im Deutschen und Englischen. Der Fokus liegt auf dem Verb als zentrales Element der Satzstruktur und den Herausforderungen beim Fremdsprachenlernen, insbesondere den Interferenzen zwischen Mutter- und Zweitsprache. Die Arbeit beinhaltet eine Begründung der Themenwahl, Überlegungen zur kontrastiven Linguistik, allgemeine Betrachtungen zur Morphologie und eine detaillierte Analyse der Verbflexion und -semantik.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Begründung der Themenwahl, Überlegungen zur kontrastiven Linguistik, allgemeine Betrachtungen zur Morphologie, eine detaillierte Analyse des Verbs (Verbklassen, Flexionstypen, grammatische Kategorien wie Tempus, Modus, Genus, semantische Aspekte, Aktionsarten, Modalverben und Funktionsverben), die Flexion (Konjugation), die Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) mit paradigmatischer und syntagmatischer Modusbedeutung, modale Bedeutungskomplexe und Schlussfolgerungen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem deutschen und englischen Verbssystem aufzuzeigen. Sie beleuchtet die Herausforderungen des Fremdsprachenlernens und die Bedeutung der kontrastiven Linguistik für den Fremdsprachenunterricht, insbesondere die Analyse von Interferenzen zwischen Deutsch und Englisch.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kontrastive Methode, um das deutsche und englische Verbssystem zu vergleichen. Die Analyse basiert auf morphologischen und semantischen Kriterien. Die Zusammenfassung der Kapitel verdeutlicht den angewandten Ansatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kontrastive Linguistik, Deutsch, Englisch, Verb, Morphologie, Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ), Grammatische Kategorien, Semantik, Interferenzen, Fremdsprachenlernen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Linguistik, Germanistik, Anglistik und Lehramt, sowie für alle, die sich für den Vergleich von Sprachen und die Herausforderungen des Fremdsprachenlernens interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis im HTML-Dokument bietet eine strukturierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen prägnanten Überblick über den jeweiligen Inhalt.
- Quote paper
- Anneliese Tischler (Author), 2000, Die Modi im Deutschen und im Englischen - Eine kontrastive Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19054