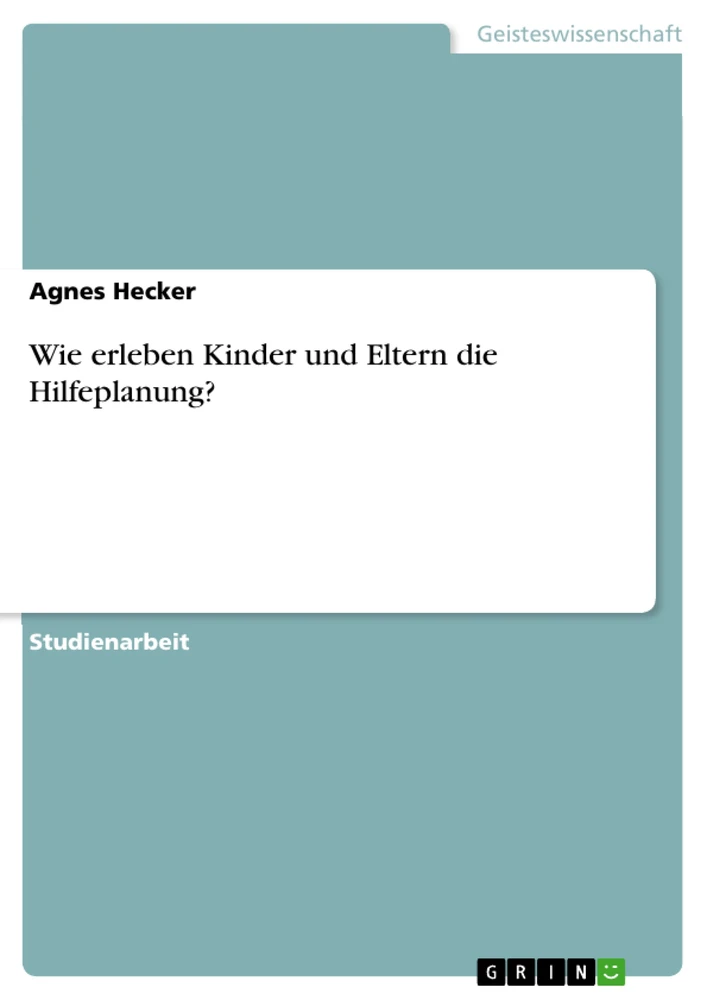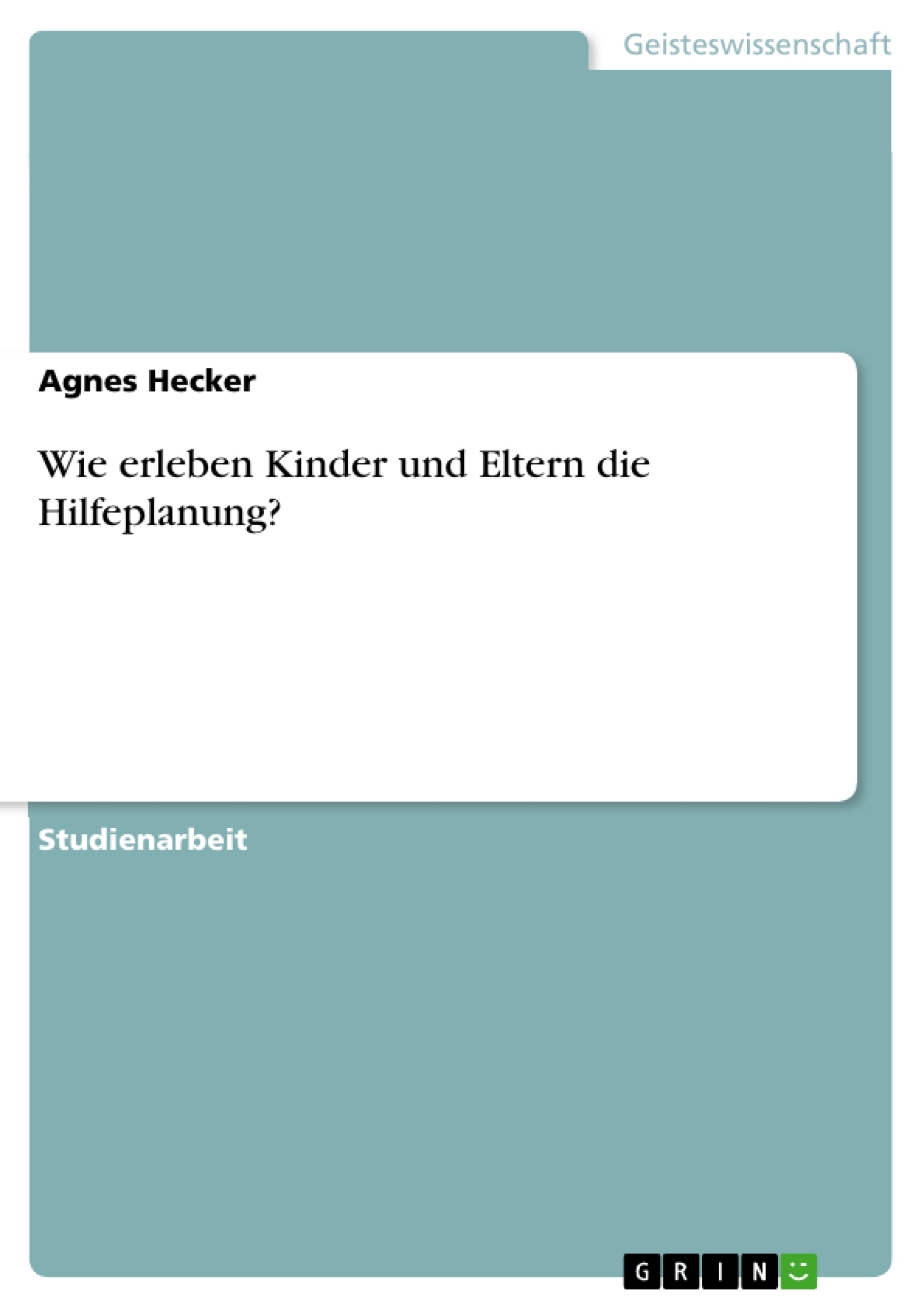In dieser vorliegenden Arbeit wird dargestellt welche Erfahrungen die Eltern und Kinder mit der Hilfeplanung gemacht haben und was es an positiven und negativen Aspekten zu sagen gibt. Vor diesem Hintergrund werden zu diesen Thesen Positionen angenommen.
Zuerst wird der Begriff der Hilfeplanung erklärt und die rechtlichen Grundlagen der Hilfepla-nung als auch der Mitwirkung der Kinder und Eltern dargestellt. Hier sollte hervorgehoben werden, was der Gesetzgeber sich unter dieser Mitwirkung vorgestellt hat. Im weiteren Teil wird dargestellt, wie Eltern und Kinder die Hilfeplanung erleben. Im nächsten Teil werden 2 Typen von Hilfeplangesprächen vorgestellt. Hier wird geprüft, ob die Thesen auch bei unterschiedlichen Vorgehenswesen Bestätigung finden. Im letzten Punkt wird auf das Zusammenwirken von Fachkräften eingegangen und dessen Auswirkung auf die Eltern und Kinder. Zum Schluss werden die wichtigsten Aussagen zu den Thesen noch Mal zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hilfeplanung
- Begrifferklärung
- Rechtliche Grundlagen
- Hilfeplanung
- Beteiligung der Eltern und Kinder
- Hilfeplanung aus Sicht der Eltern
- Der erste Kontakt
- Gestaltung der Zusammenarbeit
- Erfahrungen im Hilfeplangespräch
- Hilfeplanung aus Sicht der Kinder
- Hilfeplangespräche mit unterschiedlicher Beteiligung
- Aushandlungsorientiertes Hilfeplangespräch
- Problemorientiertes Hilfeplangespräch
- Zusammenwirkung mehrerer Fachkräfte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Hilfeplanung in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aus der Perspektive von Kindern und Eltern. Sie untersucht die Erfahrungen, die Eltern und Kinder mit dem Hilfeplanungsprozess machen und analysiert, welche positiven und negativen Aspekte dabei zu Tage treten. Die Arbeit nimmt Bezug auf Thesen von Silke Pies und Christian Schrapper, die die Hilfeplanung als Machtdemonstration von professionellen Helfern beschreiben.
- Erfahrungen von Eltern und Kindern mit der Hilfeplanung
- Rechtliche Grundlagen der Hilfeplanung und der Mitwirkung von Eltern und Kindern
- Unterschiedliche Arten von Hilfeplangesprächen (aushandlungsorientiert vs. problemorientiert)
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachkräften
- Kritik an der Hilfeplanung als Machtdemonstration und die Notwendigkeit einer stärkeren Einbeziehung von Kindern und Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt die Thesen von Pies und Schrapper ein. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Hilfeplanung erläutert und die rechtlichen Grundlagen, insbesondere die Mitwirkung der Eltern und Kinder, vorgestellt. Das dritte Kapitel untersucht die Erfahrungen der Eltern mit der Hilfeplanung, beginnend mit dem ersten Kontakt mit der Jugendhilfe. Es werden die Herausforderungen der Zusammenarbeit und die Gestaltung des Hilfeplangesprächs beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich der Perspektive der Kinder auf die Hilfeplanung. Die beiden folgenden Kapitel analysieren zwei unterschiedliche Typen von Hilfeplangesprächen: das aushandlungsorientierte und das problemorientierte Hilfeplangespräch. Das siebte Kapitel geht auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachkräften und deren Auswirkungen auf Eltern und Kinder ein.
Schlüsselwörter
Hilfeplanung, Kinder- und Jugendhilfe, Elternmitwirkung, Kinderbeteiligung, Hilfeplangespräch, Machtdemonstration, Rechtliche Grundlagen, SGB VIII, Kooperation, Zusammenarbeit, Fachkräfte, aushandlungsorientiert, problemorientiert, Erfahrungen, Perspektiven.
- Quote paper
- Agnes Hecker (Author), 2011, Wie erleben Kinder und Eltern die Hilfeplanung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190209